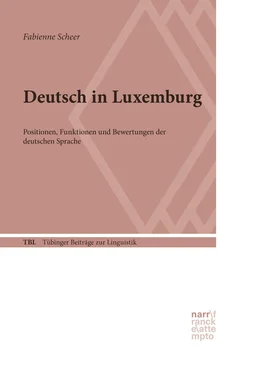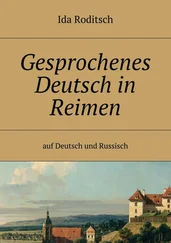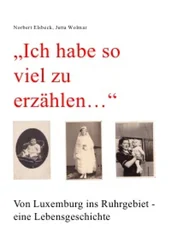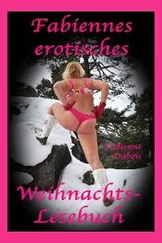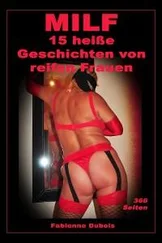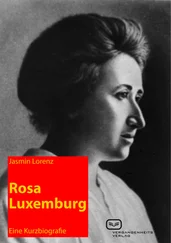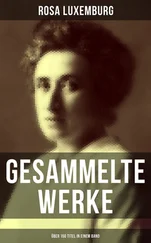Beide Definitionen weisen Parallelen zum Begriff der sozialen Einstellung auf. So meint Hermanns (2002: 81), dass „[e]ine Mentalität […] die Gesamtheit aller usuellen Einstellungen in einer sozialen Gruppe“ (2002: 81) sei und „[…] insofern […] die Mentalitätsgeschichte auch und insbesondere als Geschichte von sozialen Attitüden“ zu verstehen sei (1995: 77f.). Scharloth (2000: 45) bezieht sich auf Sellin (1985) und meint: „Die Gesamtheit der kollektiven Einstellungen konstituiert danach die gruppenspezifische Mentalität.“4 Ich teile Hermanns (2002: 81) Sicht nicht, wenn er meint, die Mentalitätsgeschichte lasse „sich ohne weiteres ersetzen durch die schlichtere Bezeichnung ‚Einstellungsgeschichte’.“ Der Mentalitätsbegriff erfasst viel deutlicher den kollektiven Wissensbestand, dieses Denken-wie-üblich und das damit verbundene Handeln-wie-üblich innerhalb einer Gesellschaft, als der Begriff der Einstellung.5 So hat der Mentalitätsbegriff eine Doppelstruktur; er ist zugleich Gewohnheit und Disposition. In der historischen und linguistischen Forschung führt dies einerseits zu Arbeiten, die mit einem engen, kategorial-epistemischen Mentalitätsbegriff arbeiten und andererseits zu Anwendungen eines weiten, substanziellen Mentalitätsbegriffs (vgl. Scharloth 2005a: 121). Arbeiten, die einen substanziellen Mentalitätsbegriff applizieren, versuchen das Alltagswissen zu erfassen, suchen nach den Inhalten des üblichen Denkens (vgl. ebd.). Kategorial-epistemische Arbeiten versuchen die kollektiven Weisen der Wissensverarbeitung und der Wissensorganisation zu erschließen (vgl. ebd.). Mentalitäten sind vielschichtiger als kollektive Einstellungen und scheinen diesen konzeptuell übergeordnet zu sein. Sie werden empirisch anhand von Einstellungsäußerungen sichtbar.6 Ich betrachte kollektive Einstellungen also in gewisser Weise als Teilmengen von Mentalitäten.7
Der Einfluss des Mentalitätenwissens auf das individuelle Handeln variiert. Es ist in jeweils unterschiedlichem Ausmaß eine Hilfe bei der Entscheidung, wie man sich in diversen sozialen Situationen zu verhalten hat (vgl. Dinzelbacher 1993: XXIX). So stellt es beispielsweise abrufbare Informationen darüber bereit, ob bestimmte Handlungen in der Gesellschaft erwünscht sind. Mentalität ist, in Anlehnung an Lucien Febvre, ein outillage mental und beinhaltet als solches „die Summe der Orientierungsangebote, die in einem Kollektiv jeweils aktuell sind“ (vgl. ebd.: XXIXf.). Der Einzelne ist nicht nur Träger einer Mentalität mit einer Summe x an Orientierungsangeboten des kollektiven Denkens, Fühlens, Sollens und Wollens, sondern ist Träger von multiplen Mentalitäten mit multiplen Orientierungsangeboten und Deutungsmöglichkeiten, die in unterschiedlichem Ausmaß genutzt werden. Somit greift jeder Mensch nicht nur auf das in einer Mentalität gespeicherte Wissen zurück, „Mentalitäten gibt es nicht nur auf einer Komplexitätsebene, in einer bestimmten Konsistenz und immer denselben Ausdrucksformen“ , sondern auf eine Vielzahl, die auf den verschiedenen Ebenen des sozialen Zusammenlebens entstehen (Kuhlemann 1996: 183). Da das Individuum in einer Pluralität von Mentalitäten denkt, benutze ich Mentalität auch stets im Plural. Je nach Situation werden jeweils andere Mentalitätenebenen aktiviert. Die Komplexität von Mentalitäten und die Reichweite ihrer Handlungsvorlagen werden anhand des Mehrebenenmodells von Kuhlemann (vgl. 1996: 193f.) verständlich. Dieser unterscheidet drei aufeinander bezogene Mentalitätenebenen:
Totalmentalität: die epochalen, mehr oder weniger von allen Zeitgenossen (weltweit oder eines Kulturraumes je nach Forschungsperspektive) geteilten Einstellungen und Selbstverständlichkeiten.
Makromentalitäten (Großgruppenmentalitäten): betrifft die Mentalität(en) größerer je nach Forschungsperspektive umgrenzter Kollektive (Nationen, Gesellschaften, Konfessionsgruppen …).
Innerhalb der Makromentalitäten können weitere Partikular- bzw. Mikromentalitäten unterschieden werden (etwa Mentalitäten der Inner- oder Teilgesellschaft: Familie, Schule, Peergroup, Partei …) (vgl. ebd.; vgl. Spitzmüller 2005: 60).
Wichtig ist in Bezug auf Mentalitäten von dieser Mehrebenenstruktur auszugehen. Die vorliegende Arbeit richtet sich in erster Linie auf die Ebene der Großgruppenmentalität, berücksichtigt aber immer auch das bestehende Interdependenzverhältnis zwischen den einzelnen Mentalitätenebenen. Der Versuch von einer isolierten Kultur auszugehen und diese mit dem Staat (der Nation) Luxemburg gleichzusetzen, würde die Realität verkennen – gerade in einer Gesellschaft, die von Mehr- und Interkulturalität im besonderen Maße geprägt ist. Darüber hinaus muss nicht darauf hingewiesen werden, dass die Bevölkerung eines jeden Landes, als Teilgemeinschaft einer globalisierten Welt, in einer Pluralität von Mentalitäten denkt.
Menschen unterscheiden sich voneinander. Sie handeln schon aus diesem Grund unterschiedlich und interpretieren Situationen jeweils anders (vgl. Spitzmüller 2005: 59). Trotzdem ist vieles, was als eine individuelle Meinungsäußerung ausgesprochen wird, im Grunde genommen gesellschaftlich (vgl. Rehbein 2011: 97). Mit Bourdieu ist jedes Individuum immer schon gesellschaftlich gewesen (s. a. ebd.: 87 vgl. Krais/Gebauer 2002: 66,). „Was tue ich, was kein anderer Mensch tut?“ und „Was tue ich, was ich nirgendwo erfahren oder gelernt habe?“ , fragt Rehbein (2011: 97).
Gegenstand dieser Arbeit ist ein spezifischer Teilbereich von kollektiven Wissens- und Handlungsvorgängen, nämlich diejenigen, die sich auswirken auf die Bewertungen, die Funktionen und die Positionen, die den Sprachen in Luxemburg und der deutschen Sprache im Besonderen zugeschrieben werden. ‚Mentalität’ als Schlüsselelement der Untersuchung erlaubt es eine Brücke zwischen Wissen und Verhalten herzustellen. Die Sozialpsychologie betrachtet den Einfluss von Einstellungen auf das Verhalten kritisch (vgl. Scharloth 2000: 45). Eine eingehendere Betrachtung des sozialpsychologischen Konzepts der Einstellung kann Auskunft darüber geben, inwieweit Mentalitäten tatsächlich in das Handeln des Einzelnen einfließen.
EXKURS: Einstellungen und Verhalten
Einstellungen werden sozial geteilt. Es existieren zahlreiche Definitionen, die zu erfassen versuchen, was Einstellungen sind und wie sie genau entstehen. Die meisten rekurrieren nach wie vor auf die bereits im Jahr 1935 von Gordon Allport formulierte Definition:
An attitude is a mental and neural state of readiness, organized through experience, exerting a directive and dynamic influence upon the individual’s response to all objects and situations with which it is related (Allport 1935: 810).
Einstellungen entstehen durch Erfahrungen, die im Verlauf des eigenen Lebens gemacht werden. Sie sind gesellschaftlich gewachsene Bewertungsvorlagen, die sich in der sozialen Interaktion (dem familiären Umfeld, der Peergroup, Bildungsinstitutionen, Medien …) bilden (vgl. Arendt 2010: 8). Indem der Einstellungsträger seine Einstellung gegenüber einem Einstellungsgegenstand abruft, erhält er eine Bewertungs- bzw. Reaktionstendenz. Während einfache Erklärungsmodelle der Einstellungsforschung nur diesen Bewertungsaspekt herausstellen und Einstellungen als evaluatives Maß auf einer eindimensionalen Richtungsskala veranschaulichen, die von maximal negativ bis maximal positiv reicht, ergänzen andere die Erklärungskomponente (nicht mögen – mögen), um eine kognitive Komponente (vgl. Gollwitzer/Schmitt 2009: 150). Sie verdeutlichen, dass Einstellungen vielschichtiger sind und eine geäußerte Bewertung noch lange nicht den Blick auf sämtliche vorhandenen Gedankengänge und Wissensbestände freilegt, die das Einstellungsobjekt betreffen könnten. Seit den 1960er Jahren wird das Drei-Komponenten-Modell zur Erklärung von Einstellungen (nach Rosenberg/Hovland und Katz/Scotland) in der Einstellungsforschung favorisiert (vgl. Hermanns 2002: 74). Die Gründe, die zur Entwicklung einer bestimmten Einstellung geführt haben und auch die Form, in der sich die Einstellung äußert, können, diesem Modell zufolge, kognitive, affektive und/oder konative Züge aufweisen.1
Читать дальше