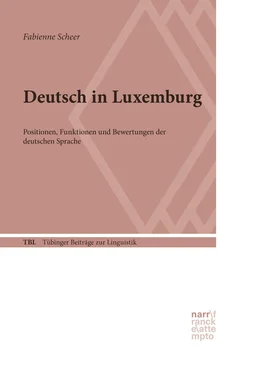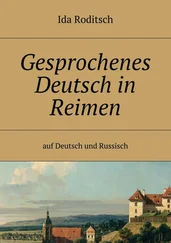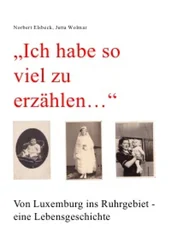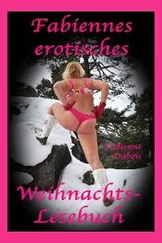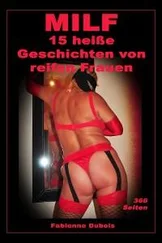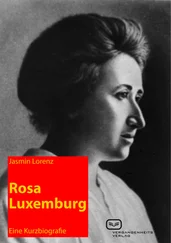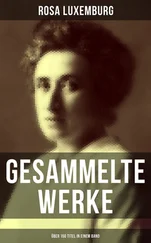III. Das Wissen der Sprecher – Theoretische Grundlagen
1 Über Mentalitätenwissen, Sprachdenken und Sprachhandeln
1.1 „Dieses ‚Denken-wie-üblich‘, wie wir es nennen möchten […]“1
Als ich mich in der Recherchearbeit befand, nach und nach das Untersuchungskorpus zusammenstellte und die ersten Expertengespräche führte, wurde mir des Öfteren gesagt, ich würde eine zentrale Voraussetzung mitbringen, um mich an das Thema ‚Deutsch in Luxemburg’ heranzuwagen, nämlich das teils bewusste, teils unbewusste Wissen über . Hierbei handelt es sich um ein Wissen, das durch die Sozialisation in Luxemburg erworben wird und das weit über die reine Kenntnis der drei offiziellen Landessprachen hinausgeht. Eine erste Definition dieses sogenannten intuitiven Wissens sowie ein Porträt des ‚Un-Wissenden’ formulierte Alfred Schütz in seinem Beitrag Der Fremde. Ein sozialpsychologischer Versuch (1972) . Schütz beschreibt hier die Ausgangssituation, in der sich ein Fremder befindet, wenn er „versucht, sein Verhältnis zur Zivilisation und Kultur einer sozialen Gruppe zu bestimmen und sich in ihr neu zurechtzufinden“ (ebd.: 53). Den Fremden bezeichnet er als einen Erwachsenen, der sich als Immigrant in der „Situation der Annäherung [an eine neue Gesellschaft befindet], die jeder möglichen sozialen Anpassung vorhergeht und deren Voraussetzungen enthält“ (ebd.: 54). Fremde betreten als Unwissende ein neues Feld bzw. mehrere neue soziale Felder, deren Denk- und Handlungsgewohnheiten ihnen zunächst einmal nicht vertraut sind (vgl. ebd.: 55). Immigranten müssen für alle gesellschaftlichen Bereiche das passende Sozialverhalten neu erwerben oder überprüfen. Vorwissen über etwaige Verhaltensmuster der Zielgemeinschaft muss gegebenenfalls revidiert werden.
Der Begriff des lebensweltlichen Wissens bezeichnet bei Schütz den Wissensvorrat eines Menschen. Er fasst den Begriff zunächst weit, indem er annimmt, dass darin Traumwissen, Phantasiewissen, religiöses Wissen und Alltagswissen enthalten sind (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 178). Das Alltagswissen stellt dabei den Kernbereich des lebensweltlichen Wissensvorrats dar und dient als Orientierungsgrundlage (vgl. ebd.; Schütz 1972: 55). Es handelt sich hierbei in erster Linie um Wissen über Denk- und Verhaltensmuster, vergangene Ereignisse, Erfahrungen, individuelle und tradierte Verhaltensroutinen und Verhaltenserwartungen. Das Alltagswissen ist nicht frei von Widersprüchen. Schütz erklärt, dass das „erworbene System des Wissens – so inkohärent, inkonsistent und nur teilweise klar, wie es ist – […] für die Angehörigen der in-group den Schein genügender Kohärenz [hat]“ (ebd.). Die Integration eines Fremden in die Zielgesellschaft ist nur dann vollends gelungen, wenn dieser deren Denk- und Handlungsmuster nicht nur passiv nachvollziehen kann, sondern sie auch aktiv beherrscht und weiß, wie er sich in unterschiedlichen Situationen ‚alltagstypisch’ zu verhalten hat (vgl. ebd.: 63,65):
Au sens psycho-social, l’intégration désigne le processus d’intériorisation qui permet à un individu de réagir conformément aux normes et aux valeurs qui régissent le groupe (Brémond/Gélédan 2002: 294; eigene Hervorh.).
Der Fremde muss in gewisser Weise lernen so zu denken, wie es in der Zielgesellschaft üblich ist. Lernen zu Denken-wie-üblich , bedeutet die inneren Gesetze oder – mit Schütz gedacht – die Rezepte der Gruppe so zu verinnerlichen, dass sie bei den eigenen Handlungen miteinbezogen werden (vgl. Schütz 1972: 58).2 Dieses ‚Rezeptwissen’ stellt intuitiv Lösungen für Probleme, Erlebnisabläufe und Wissen über das gesellschaftlich akzeptierte Verhalten in bestimmten Situationen bereit – und so auch Wissen über das in bestimmten Situationen akzeptierte Sprachverhalten (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 159).
1.2 Makrokontext ‚Luxemburgische Mentalität‘
Der gesellschaftliche Wissensvorrat kann mit dem Schützschen Begriff Denken-wie-üblich umrissen werden. Nützliche theoretische und methodische Anknüpfungspunkte für die Erforschung solcher in einer Nation historisch gewachsenen Orientierungsmuster, Deutungs- und Handlungsrahmen, stellen die Geschichtswissenschaften bereit. Sie bedienen sich nicht des Begriffs Denken-wie-üblich , sondern fragen nach der zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte gültigen Mentalität . Die Elemente jenes Wissens, die sich auf das individuelle Denken über Sprachen und Sprachhandeln in Luxemburg auswirken, indem sie Handlungsvorlagen bereitstellen, werden als Teil des in Luxemburg gültigen und wandelbaren Mentalitätenwissens betrachtet.
1.2.1 Mentalität im Sinne der historischen Mentalitätsforschung
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts richtete sich das Interesse der Historiker zunehmend auf die konkreten Lebensumstände der Menschen in dem Zeitalter, das sie erforschen wollten (vgl. Burguière 2006: 13). Das Forschungsinteresse der Geschichtswissenschaft fokussierte somit wirtschafts-, sozial- und kulturgeschichtliche Aspekte. Alltagsgeschichte, Mikrogeschichte, Kulturgeschichte, Mentalitätsgeschichte und Diskursgeschichte erfuhren innerhalb des Fachs eine Aufwertung. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit mentalitätsgeschichtlichen Aspekten beschränkte sich allerdings zunächst auf den französischen Raum. Auch der wissenschaftliche Terminus mentalité etablierte sich vorerst nur dort (vgl. Chartier 1987: 69).1 Ende der siebziger Jahre wurde die Mentalitätsgeschichte dann auch im deutschsprachigen Raum rezipiert (vgl. Spitzmüller 2005: 56f.). Mentalität ist als ‚Suchbegriff’ zu verstehen (vgl. Hermanns 1995: 73). Bei der Erforschung historischer Ereignisse und Vorgänge soll auch das spezifische Denken der Zeit, welches die menschlichen Handlungen prägte, mitberücksichtigt werden (vgl. ebd.; Küçükhüseyin 2011: 22). Le Goff erklärt, dass
der anfängliche Reiz der Mentalitätsgeschichte gerade in ihrer Unschärfe und in ihrem Anspruch [bestand], den Bodensatz der historischen Analyse, jenes ‚Irgendwo auch’ der Geschichte, ausfindig zu machen (vgl. Le Goff 1987: 18).
Um eine klare Definition von Mentalität formulieren zu können, ist es wichtig, das wissenschaftliche Verständnis des Begriffs klar vom umgangssprachlichen abzugrenzen. Umgangssprachlich bedeutet Mentalität eine „[…] besondere […] Art des Denkens oder Fühlens eines einzelnen Menschen, einer sozialen Gruppe oder eines Volkes […]“ (vgl. Scharloth 2000: 42; 2005b: 44).2 Hervorgehoben werden demnach die charakterlichen Eigenarten eines Menschen, einer sozialen Gruppe oder eines Volkes (vgl. Scharloth 2005a: 120). In der Geschichtswissenschaft wird der Begriff jedoch anders verstanden. Mentalitäten bezeichnen hier die üblichen Denkweisen. Dinzelbacher (1993) definiert das Verständnis des Begriffs aus Sicht der Mentalitätsgeschichte wie folgt:
Historische Mentalität ist das Ensemble der Weisen und Inhalte des Denkens und Empfindens, das für ein bestimmtes Kollektiv in einer bestimmten Zeit prägend ist. Mentalität manifestiert sich in Handlungen (Dinzelbacher 1993: XXIV; Hervorh. im O.).
Die Definition von Dinzelbacher hat sich in der Mentalitätsgeschichte etabliert. Sie deckt sich mit der von Fritz Hermanns (vgl. 1995: 77), die hier an zweiter Stelle angeführt wird, da der Sprachwissenschaftler einen bedeutenden Beitrag zur Übertragung des Mentalitätsbegriffs und der damit verbundenen Konzepte in die Linguistik leistete:3
Eine Mentalität im Sinne der Mentalitätsgeschichte ist, so hat es sich ergeben: 1.) die Gesamtheit von 2.) Gewohnheiten bzw. Dispositionen 3) des Denkens und 4.) Fühlens und 5) Wollens oder Sollens in 6.) sozialen Gruppen (ebd.).
Читать дальше