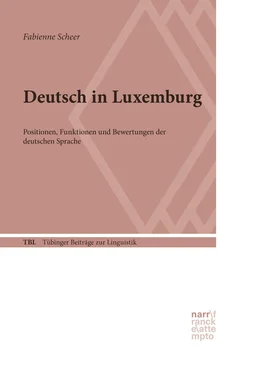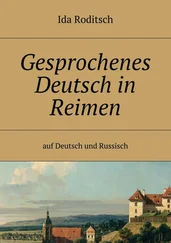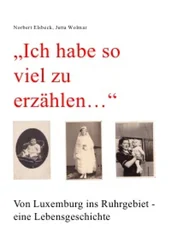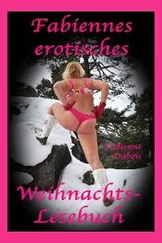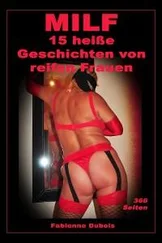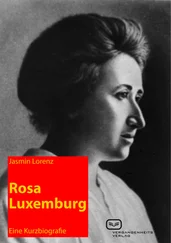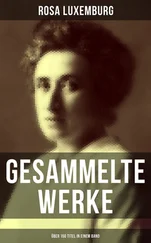Die deutsche Sprache übernimmt in der luxemburgischen Grundschule bedeutende Funktionen: Sie ist aufgrund ihrer Nähe zum luxemburgischen Sprachsystem die Alphabetisierungssprache und die Hauptausbildungssprache. Mit dem Übergang in die Sekundarschule verändert sich, zumindest für die Schüler, die ein klassisches Gymnasium besuchen, die Sprachenhierarchie schrittweise zugunsten der französischen Sprache. Das Französische übernimmt nach Abschluss der neunten Klasse des Gymnasiums die Funktion der Sprache, in welcher der Lernstoff in nahezu sämtlichen Fächern vermittelt wird. Die Bildungselite soll auf diese Weise einen Sprachstand im Französischen erreichen, der den Sprechern eines Landes gerecht wird, das seit 1970 ständiges Mitglied der Organisation internationale de la Francophonie (OIF) , dem Zusammenschluss der französischsprachigen Länder, ist.1 Englisch steht ab der achten Klasse auf dem Lehrplan. Weitere Sprachen, etwa Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Latein oder Altgriechisch können zusätzlich erworben werden. Die Spracherwerbsmöglichkeiten, die das luxemburgische Schulsystem grundsätzlich bietet und die Sprachkompetenzen, die auf diese Weise erreicht werden können, erscheinen beneidenswert. Nicht selten sind sie aber auch der Grund für Schulversagen und versperren Schülern mögliche Ausbildungswege. Die Eindrücke, die in und außerhalb der Schule im Austausch mit Experten gewonnen wurden und die Diskussionen, die im wissenschaftlichen Fachdiskurs sowie im medialen Laiendiskurs seit 1983 geführt wurden, zeigen wie sich die Sicht auf Sprache, auf eine Muttersprache und auf Mehrsprachigkeit in der luxemburgischen Gesellschaft seitdem verändert hat. Über den gesamten Erfassungszeitraum des Diskurses, seit über 30 Jahren, muss sich das Bildungssystem mit dem Vorwurf auseinandersetzen, Kindern mit Migrationshintergrund kein gerechtes Lernumfeld zu bieten. Seit der Veröffentlichung der ersten Pisa-Ergebnisse gilt dieser Vorwurf auch im Bezug auf die Bildungschancen von Kindern aus sozial benachteiligten Familien. Die schulischen Sprachanforderungen und besonders der Stellenwert der deutschen Sprache werden als die Kernprobleme angesehen.2 Die Schule ist „the institution where more High German is spoken than anywhere else“ , findet Schmid (2001: 149). Außerhalb der Schule ist sie dagegen vielfach eine stille Sprache, die zwar viel gelesen und geschrieben wird, aber eigentlich nur in Interaktion mit deutschen Sprechern als gesprochene Sprache verwendet wird. Die Deutschlehrerin Nadine Vandivinit bestätigte im Experteninterview den Eindruck, dass es eine Diskrepanz zwischen der Position des Deutschen in der Schule und der außerschulischen Relevanz der Sprache gibt:
F.S.: „Wat ass dann d’Roll vun der däitscher Sprooch? Ass et eng geliefte Sprooch?“
Nadine Vandivinit(Deutschlehrerin): „Zu Lëtzebuerg?“
F.S.: „Jo.“
Nadine Vandivinit:„Ech géing do d’Däitscht net als geliefte Sprooch ugesinn. Also ech géing d’Däitscht eben als Fach ugesinn, an deem d’Lëtzebuerger alphabetiséiert ginn, well herno, wann een eben d’Strukture [politesch, wirtschaftlech, gesellschaftlech] zu Lëtzebuerg hutt, fënnt déi däitsch Sprooch jo net wierklech eng Plaz oder hutt och keng wierklech Plaz an deem Sënn […]. Ech weess et net. Ech hat ëmmer méi eng Affinitéit zum Däitschen wéi zum Franséischen, mee dass et lo wierklech eng Sprooch ass, déi ech zu Lëtzebuerg permanent gebrauche muss …, gesinn ech et net. Do ass d’Franséischt éischter …“
F.S.: „A wann ee lo vum Wäert vun enger Sprooch schwätzt, dann hutt se villäicht kee richtege Wäert fir virunzekommen lo am wirtschaftleche, beruffleche Liewen [zu Lëtzebuerg]? Si hutt éischter ee Wäert als kulturell Sprooch – villäicht als Zousaatzkultursprooch?“
Nadine Vandivinit:„Jo als Verständigungsméiglechkeet an […]. T’gi jo awer vill Länner, wou d’däitsch Sprooch awer nach geschwat gëtt a vun dohier … Mee ech mengen net, dass se sech, dass se zu Lëtzebuerg sou eng herausragende Rolle eigentlech hutt. An jo – t’ass schwéier, well am Alldag begéint ee se jo sou selten.“3
Dem luxemburgischen Schulsystem war lange Zeit vorgehalten worden zu sehr auf Frontalunterricht zu setzen und den Sprachenunterricht über die Entwicklung des Allgemeinwissens, von Transferkompetenzen und Anwendungswissen zu stellen. Auch gegenwärtig bemerken Lehrkräfte, dass Schüler in Luxemburg in der Ausbildung ihres Allgemeinwissens hinterherhinken:
Damjana Suljana Zorko (Deutschlehrerin am technischen Lyzeum) : „Hier wird ganz viel auf Sprachen gegeben, aber Sprachen sind nur ein Teil des Weltwissens. Ich hab in der 9. Klasse 15-, 16-jährige, die sagen, was ist denn das der Mount Everest und wer ist Mutter Theresa , was ist das für ne Frau, was weiß ich … um nicht zu sagen, dass sie überhaupt auch geschichtliche Sachen gar nicht wissen. Es geht auf Kosten des Weltwissens, das aber in der heutigen Welt genau das ausmacht, den Unterschied zwischen den Leuten, die was wissen und dann jemand werden und den Leuten, die Nobodys werden […].“
F.S.: „Würden Sie auch sagen, dass es daran liegt, dass dieses Schulsystem extrem auf Sprachen aufgebaut ist?“
Damjana Suljana Zorko:„Genau daran. Man verliert enorm viele Stunden für Sprachen, die aber nur ein Teil des Weltwissens sind und man muss andere Sachen einfach auch wissen und können, um in dieser Welt zu bestehen und vor allem, was Zukunft ist, ist Naturwissenschaften. Und die kommen absolut zu kurz. Die Kinder haben Biologie, Chemie vermischt, Physik dann ein bisschen dazwischen – das geht doch nicht, das sind drei verschiedene Wissenschaften!“
Fehlen (2006: 5) spricht von einer „école plombée par les langues“. Wie Bildungs- und Spracherwerb in Luxemburg genau funktionieren und mit welchen Problemen die Lehrkräfte konfrontiert werden, wenn sie die deutsche Sprache vermitteln, wird in diesem Teil der Arbeit dargelegt. Diskussionen um Reformen des Unterrichtssystems werden in Luxemburg emotional geführt. Die Analyse des Bildungsdiskurses zeigt inwieweit das in der Schule vermittelte Sprachwissen und Sprachhandeln im Begriff ist sich zu verändern.
1 Aufbau des luxemburgischen Schulsystems
1.1 Grundschule (école fondamentale)
Lange Zeit beruhte der Aufbau der luxemburgischen Grundschule auf einem verhältnismäßig alten Gesetz. Erst die Bildungsreform, die im Jahr 2009 in Kraft trat, ersetzte ein Schulgesetz aus dem Jahr 1912. Mit dem neuen Schulgesetz vom 6. Februar 2009 wurde der Aufbau der Vor- und Primärschule grundlegend reformiert. Was vor 2009 im Volksmund Spillschoul und Primärschoul genannt wurde, wird nun als ein Ganzes bezeichnet: die école fondamentale . Ab der Einschulung sind nicht mehr acht bzw. neun Schuljahre bis zum Übergang in die Sekundarschule zu zählen, sondern 4 Grundschulzyklen .1
Staatliche und private Krippen nehmen Säuglinge ab drei Monaten auf, die bis zum vierten Lebensjahr, dem Beginn der Schulpflicht, dort betreut werden können. In Kindertagesstätten, die dem luxemburgischen Bildungsministerium unterstehen, muss Luxemburgisch geredet und der Erwerb der Sprache beim Kind gefördert werden. Private Kindertagesstätten müssen sich nicht an diese Vorgaben halten. Ein Großteil der privaten Krippen wird von französischsprachigem Personal betrieben, andere werben wiederum gezielt mit mehrsprachiger Erziehung (vgl. Die Grenzgänger 2010).2 Jede luxemburgische Gemeinde ist dazu verpflichtet, eine fakultative Früherziehung (éducation précoce) für Kinder ab drei Jahren anzubieten. Die école fondamentale beginnt mit zwei Jahren obligatorischer Vorschule im Grundschulzyklus 1. Sie endet mit dem Abschluss des Zyklus 4.2 (vormals sechste Klasse).
Читать дальше