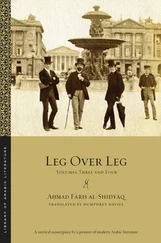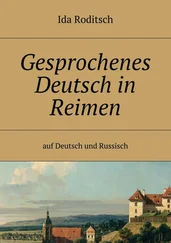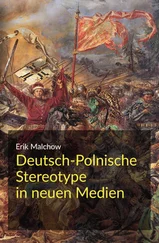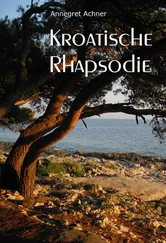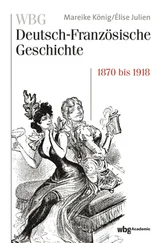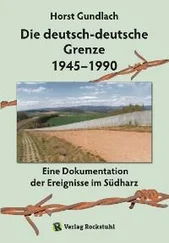Im gemeinsamen Staat kam es zum gegenseitigen Einfluss auf Kultur und Sprache, wobei indirekt auch viele deutsche Lehnwörter über das Ungarische in die kroatische Sprache entlehnt wurden (Talanga, 1990: 131). Aus dieser Zeit stammen Begriffe wie: kro. frtalj < ung. fertály < ahd. fiorteil, nhd. Viertel; kro. grof < ung. gróf < mhd. grāve, nhd. Graf; kro. hahar < ung. hóhér < mhd. hāhaere < nhd. Henker; kro. marva < ung. marha < mhd. mar(i)ha < nhd. Mähre; kro. mužar < ung. mozsár < ahd. morsari < nhd. Mörser; kro. perec < ung. perec < ahd. brez(i)tella < nhd. Brezel; kro. puška < ung. puska < ahd. buhsa < nhd. Büchse; kro. rit < ung. rit, ret < ahd. (h)riot < nhd. Ried u.v.m. Aus dem Althochdeutschen wurden in der Zeit von 1000 bis 1300 ebenfalls viele Ausdrücke für neue Gebrauchsgegenstände oder andere Innovationen, die die Kroaten von den Deutschen übernommen haben, entlehnt: kro. izba < slaw. *istbba < ahd. stuba, nhd. Stube; kro. kanta < ahd. channata; nhd. Kanne; kro. kotar < ahd. kataro, nhd. Gatter (dial. Kotter); kro. kuhati < ahd. kochōn < vlat. cocere, nhd. kochen; kro. kuhinja < ahd. chuhhina < vlat. cocina, nhd. Küche; kro. letva < ahd. latta, nhd. Latte; kro. mlin < ahd. muli(n) < lat. molina, nhd. Mühle; kro. mošt < ahd. most < lat. mustum, nhd. Most; kro. pehar < ahd. beehari < mlat. bicarium < griech. bikos, nhd. Becher; kro. škaf < ahd. scaf, scaph, nhd. Schaff; kro. škare < ahd. skâre, nhd. Schere; kro. škoda < ahd. scado, nhd. Schaden; kro. škrinja < ahd. scrini < lat. scrinium, nhd. Schrein; kro. štagalj < ahd. stadal, nhd. Stadel; kro. truba < ahd. trumba, nhd. Trompete; kro. vaga < ahd. vaga, nhd. Waage; kro. žaga < ahd. saga, nhd. Säge. Einige dieser Gebrauchsgegenstände oder Bezeichnungen für unterschiedliche Alltagserscheinungen gab es auch vor der Übernahme des Fremdwortes, jedoch in anderer Form oder mit gewissem Unterschied in technologischer Hinsicht. So gebrauchten die alten Slawen statt dem Ausdruck kuhatidas Verb variti, das auch heute noch verwendet wird, allerdings war das althochdeutsche Wort angemessener für die Bezeichnung der fortgeschrittenen Art dieser kulinarischen Aktivität als das urslawische variti,was auf eine Handlung am Feuerplatz referiert. Ähnlich auch die Synonyme mlinund das slawische žrvanj, das eine mit der Hand betätigte Mühle bezeichnete, während das althochdeutsche mulin, heute mlin,eine Mühle bezeichnete, die mithilfe von Wasserkraft bewegt wird. Vom sprachlichen Aspekt ist, wie oben schon angedeutet, das Zusammenleben mit den Ungarn äußerst interessant, weil nämlich im Laufe der über 400 Jahre im gemeinsamen Staat die kroatische Sprache oftmals eine Mittlerrolle bei der Entlehnung deutscher Wörter ins Ungarische hatte, wie z.B. das kroatische Wort kuhinja, das aus dem althochdeutschen Wort chuchhinaübernommen wurde und im Ungarischen durch Metathese zu konyhawurde. Ebenfalls einflussreich war auch die ungarische Sprache bei der Vermittlung deutscher Wörter ins Kroatische. In dieser Zeit wurde eine große Zahl deutscher Entlehnungen indirekt über das Ungarische übernommen (Talanga, 1990: 131). Sprachlich manifestiert sich diese Tatsache darin, dass die deutschen Wörter durch Metamorphose nach phonologischen und morphologischen Regeln der ungarischen Sprache in die kroatische gelangten. Die größte Zahl der Entlehnungen stammt aus dem Bereich der staatlichen Verwaltung und des Rechtssystems, was auch auf die Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens der Kroaten hindeutet (vgl. Hadrovics, 1985). 3.4 Entlehnungen in der mittelhochdeutschen Periode 3.4.1 Kolonisierung und Migration Ethnokulturelle Kontakte der Menschen und Gemeinschaften wurden im Mittelalter noch mehr durch Migrationsbewegungen während des 12. Jahrhunderts gefördert. Sie führten dazu, dass Einwanderer aus den umliegenden Gebieten Teile des heutigen Kroatien besiedelten und sich dadurch an der Entwicklung der kroatischen Gesellschaft beteiligten. Die kroatischen Gebiete eigneten sich seit jeher wegen günstiger klimatischen und geografischen Bedingungen zur Besiedlung. Zu dieser Zeit kam es zur intensiven Kolonisierung, wobei die Hauptrichtungen der Besiedlung von Westen nach Süden und gleichzeitig von Norden nach Osten reichten. Aus dem Westen kamen Germanen, die den größten Einfluss auf kroatischen Gebieten hinterließen. Die ersten deutschen Einwanderer kamen im frühen Mittelalter (Geiger/Kučera, 1995: 85). Dies ist auch der Beginn der kontinuierlichen Verbindung Kroatiens zum deutschsprachigen Raum. Die neuen Zuwanderer hatten den Status von hospitesbzw. Königsgästen. Dies war ein Beschluss des ungarischen Königs Stephan I. der Heilige (998–1035), der die „getreuen Gäste“ zur Urbarmachung des Siedellandes, Belebung von Wirtschaft und Handel, Abgaben im Frieden und Lebenseinsatz bei der Grenzverteidigung im Kriegsfall aufrief. Ihre Künste – Handwerk und Handel, wie auch unterschiedliche Sprachen hatten für den Staat eine große Bedeutung. Stephans Nachfolger führten seine Besiedlungspolitik weiter. Die Kolonisten besiedelten slawonische Grundbesitze und nahmen an der Gründung der ersten städtischen Siedlungen im Gebiet zwischen den Flüssen Save, Drau und Donau teil (vgl. Raukar, 1997: 141). Die älteste deutsche Siedlung in Kroatien befindet sich in Varaždin, dem König Andreas II. im Jahre 1209 den Titel einer freien Königsstadt verlieh. Das wichtigste Privilegium, dass den Einwohnern der Stadt damit zukam, war das Recht, ihren eigenen Richter zu wählen, den sie rihtarnannten (Gabričević, 2002: 28). Dieser Germanismus zeugt von dem großen Einfluss der deutschsprachigen Zuwanderer, obwohl diese Gebiete von deutschen Einwanderern erst nach dem Jahr 1527 im bedeutenderem Ausmaße besiedelt wurden. Nach dem Statut von Gradec, später Zagreb, wurde zwischen 1377 und 1436 der Stadtrichter abwechselnd gewählt: 1. lingua slavonica, 2. lingua hungarica, 3. lingua theutonica, 4. lingua latina = gallica. Im Privilegium von Vukovar aus dem Jahre 1231 sind folgende Zuwanderer angeführt: Deutsche, Sachsen, Ungarn und Slawen. Mit der Entwicklung dieser beiden Städte ging auch die Entwicklung der Städte Virovitica, Petrinja, Samobor, Zagreb, Križevci, Koprivnica u.a. unter Zuwanderung vieler Deutsche einher. Dazu trug vor allem die Goldene Bulle von König Bela IV. bei, der nach den Verwüstungen der Tataren im Jahre 1242 mit zahlreichen Privilegien Handwerker vor allem aus deutschen Ländern zur Zuwanderung bewegte. Aus diesen Siedlungen wurden schnell freie Königsstädte, so Gradec bei Zagreb, Samobor (1242), Križevci (1252), Petrinja, Jastrebarsko (1257) und andere (Antoljak, 1994: 61). Mit diesen Privilegien stieg das Vasallentum auf. Unter der Führung der Sachsen entwickelte sich der Bergbau in Bosnien. Besonders die Einwohner der Stadt Dubrovnik kamen mit ihnen in Kontakt, weil sie als Anmieter der Bergwerke und Händler mit den Kolonisten die gleichen Ortschaften bewohnten und somit sicherlich von ihnen Einiges übernahmen und lernten (Rešetar VDG, 1995: 102).1 Auch die anderen Küstenstädte Dalmatiens regten die Ansiedlung von fachlich gebildeten Zuwanderern an, insbesondere Handwerker, Notare, Ärzte und Lehrer. Die größte Zahl der Zuwanderer kam aus dem benachbarten Italien, aber viele kamen auch aus den westeuropäischen Ländern (Raukar, 1997: 141). Das kroatische Küstenland und Dalmatien standen sowohl kulturell als auch wirtschaftlich unter starkem Einfluss Italiens, so dass leicht der Eindruck gewonnen werden kann, dass dieser Teil Kroatiens nicht mit der deutschen Zivilisation in Berührung gekommen ist. Vom Einfluss des deutschen Elementes neben dem italienischen in dieser Zeit zeugt jedoch das älteste kroatische Rechtsdenkmal, das Gesetz von Vinodol aus dem Jahre 1288, das neben Italianismen ( pošišion, tovarnar, kredenče, kvaderna, falso, mankaju)2 auch einige Germanismen enthält (Talanga, 1990: 133). So das Wort likovo, das heute die Bedeutung von «Getränk, das der Verkäufer (oder Besteller) dem Käufer (oder Arbeiter) nach dem abgewickelten Geschäft bezahlt» trägt. Dieses Wort erscheint im Gesetz von Vinodol in der Form likuf,3 was auf das mhd. lîtkoufzurückgeht. In den nordkroatischen Ortssprachen wird dafür aldumašoder aldomašgebraucht, was auf das ungarische Wort áldomászurückgeht. Ebenfalls im Gesetz von Vinodol findet sich das deutsche Wort bandin der Bedeutung von «Urteil oder Strafgeld». Dieses Wort kam in die kroatische Sprache voraussichtlich über das Italienische bandooder das Mittellateinische bannum, die beide auf das Deutsche Bannzurückgehen.4 Vereinzelt findet man auch in Urkunden Belege über deutsche Siedler an der Küste. Im Jahre 1454 wird unter den venezianischen Soldaten in Split ein gewisser Lodovicus Teutonicus erwähnt, der offensichtlich deutscher Herkunft war. Dass es noch mehr solcher Soldaten deutscher Abstammung gab, ergeht aus dem Beschluss des Rates der Zehn der Republik Venedig vom 23. März 1458, das Kroaten, Ungarn und Deutschen verbot, in den venezianischen Streitkräften in Dalmatien zu dienen. 1455 hat der Raber Vassal Nikola Scaffa im Namen seiner Ehefrau Jelena einen Vertrag mit dem Vizekommissar Martin Mojsović von der Insel Krk unterzeichnet, der von einem deutschen Notar namens Moses Guthnecker beeidet wurde. In Šibenik befanden sich im 15. Jahrhundert unter den venezianischen Soldaten auch sog. Stipiendiarii, Söldner deutscher Herkunft. Auf der Insel Rab wird 1499 ein Deutscher namens Jacobus de Colonia, ein offitialis curie magnifici domini comitiserwähnt. Auch einige Offiziere deutscher Herkunft werden in Dokumenten aus dieser Zeit erwähnt, wie z.B. der Kommandant der venezianischen Garnison in Šibenik, Christoph Martin von Degenfeld, oder etwas später der Kommandant der Armee der Republik Venedig, Marschall von der Schulenburg, Anfang des 18. Jh. der deutsche General Friedrich Nostritz und viele mehr. Es liegt der Schluss nahe, dass Deutsche noch im frühen Mittelalter nach Dalmatien zogen, jedoch dort keine sichtbaren Spuren in demographischer oder kultureller Sicht hinterließen (Pederin, 1995: 15). Die Zuwanderer haben in der neuen Gemeinschaft das Bewusstsein über ihre Herkunft bewahrt, so auch ihr sprachliches und geistiges Erbe. Das hinderte sie jedoch nicht daran, sich vollkommen in die neue Gemeinde zu integrieren. So kam es zur vollständigen Assimilation, die nicht überall gleicher Intensität war. Vor allem Siedler deutscher Herkunft verweigerten den Prozess der Anpassung, worüber die Aufzeichnungen des Magistrats in Varaždin Zeugnis ablegen. War nämlich der Richter ein Deutscher, so wurden die Prozesse ausschließlich auf Deutsch geführt und nicht wie sonst auf Latein. Die deutschen Siedler hatten auch ihre eigenen Institutionen: eine Zeche, eine eigene bewaffnete Stadtverteidigung – compagniam germanicae nationis, eigene Schulen, alles mit der Absicht, die Stadt Varaždin zu einer deutschen Stadt zu machen (Gabričević, 2002: 46). Die deutschen Siedler brachten auch ein neues ethnisches Element mit, voller Fleiß und Unternehmungslust, das häufig übermächtig hinsichtlich der technischen Kultur war. Auf diese Weise haben die deutschen Siedler auf fruchtbare Art und Weise bestimmte gesellschaftliche und produktive Prozesse stimuliert, womit sie zum gesellschaftlichen Fortschritt und Entstehung des Bürgertums beitrugen (Štuka VDG, 1995: 97). Kolonisten, Handwerker und Händler haben als Träger der deutschen Sprache und Kultur nicht nur an der Gründung von Städten in den nordwestlichen Gebieten Kroatiens teilgenommen, sondern durch ihre Präsenz auch die wirtschaftlichen und sprachlichen Kontakte mit dem deutschsprachigen Raum gefestigt. Eine große Zahl deutscher Entlehnungen kam auf direktem Wege in die kroatische Sprache. Aus dieser Zeit stammen folgende Entlehnungen (Talanga, 1990: 132): kro. ceh < mhd. zech(e), nhd. Zeche; kro. cilj < mhd. zil, nhd. Ziel; kro. cimer «Handelswappen» < mhd. zimier < frz. cimier < lat. cyma; kro. cvek < mhd. zwëc, nhd. Zwecke; kro. cvilih < mhd. zwil(i)h, nhd. Zwillich; kro. drot < mhd. drāt, nhd. Draht; kro. falinga < mhd. *vaelunge, nhd. Fehler; kro. faliti < bair./österr. fālen, nhd. fehlen; kro. farba, farbati < mhd. varwe, dial. farben; akro. fištar < mhd. fister, vister, nhd. Bäcker; kro. funta < mhd. pfunt, nhd. Pfund; kro. galge < mhd. galge, nhd. Galgen; kro. gmajna < mhd. gemeine, nhd. Gemeindehutweide; kro. graba < ahd. grabo, nhd. Graben; kro. helam < mhd. helam, nhd: Helm; kro. hip < mhd. hieb, heute: Augenblick; kro. karta < mhd. karte < frz. carte < lat. charta < griech. chartes, nhd. Karte; kro. klaftar < mhd. klafter; nhd. Klafter; kro. klamfar < mhd. klampfer, nhd. Klampfe; kro. krama < mhd. krām, nhd. Krambude; kro. kuga < mhd. koge, heute: Pest; kro. ladica < mhd. lade, nhd. (Schub-)Lade; kro. lanac < mhd. lanne, heute: Kette; kro. lanci < dtsch. Lands(-knecht), Abkürz. von ital. lanzo; kro. lojtre < österr. loitr, dtsch.: Leiter; kro. malar < mhd. mālaere, nhd. Maler; kro. mantra < mhd. marter, nhd. Marter; kro. pancir, pancer < mhd. panzier < altfrz. pancier, nhd. Panzer < lat. pantex; kro. pintar < mhd. pinter, nhd. Fassbinder; kro. plac < frühnhd. plaz < frz. place, nhd. Platz; kro. pleh < mhd. blëch, nhd. Blech; kro. pošta < frühnhd. post, nhd. Post; kro. purgar < mhd. burgaere, nhd. Bürger (dial. Purger); kro. ribež < mhd. rīben, nhd. Reibeisen; kro. rihtar < mhd. rihtaere, nhd. Richter; kro. risati < mhd. rīzen, nhd. ritzen; kro. šalica < mhd. schāle, nhd. Schale; kro. šina < mhd. schine, nhd. Schiene; kro. šindra < mhd. schindel, nhd. Schindel; kro. šnicar < mhd. snitzaere, nhd. Schnitzer; kro. šnidar, žnidar < mhd. s(ch)nîder, nhd. Schneider; kro. sokla < mhd. sockel, nhd. Sockel; kro. šoštar < mhd. schuo(ch)ster, nhd. Schuster; kro. šporar < mhd. sporaere, nhd. Sporenmacher; kro. špot, špotati < mhd. spot, nhd. Spott; kro. štibra, štivra < mhd. stiura, nhd. Steuer; kro. tišlar < mhd. tischler, nhd. Tischler; kro. ura < mhd. ūr(e) < lat. hora, nhd. Uhr; kro. žlahta < mhd. slahte, nhd. (Ge-)schlecht (dial. Kschlacht). Einige dieser Entlehnungen sind heute außer Gebrauch, weil auch die Dinge, die sie benennen heute nicht mehr gebraucht werden. Einige Entlehnungen sind den heutigen Sprechern in dieser Form nicht bekannt, sondern in der Form, in der sie einige Jahrhunderte danach erneut übernommen wurden, wie beispielsweise das kro. pekarvom deutschen Bäcker. Ein Teil der Wörter erhielt sich im Substandard der kroatischen Sprache. So gebraucht man in einigen kroatischen Dialekten auch heute noch die Wörter moleraus dem nhd. Maler(südd. dialektale Aussprache «moler»). Das Wort šnajderstammt vom deutschen Schneiderstatt dem mittelhochdeutschen šnidaroder žnidar, wie šusterstatt šoštarvom nhd. Schuster. Der Ausdruck šoštardiente noch im 13. Jh. als Toponym für die neue deutsche Siedlung am Fuß der Stadtmauern von Gradec, die sie Schusterdorfbzw. Šoštarskanannten. Das Wort žlahtawird heute nur noch als Bezeichnung für die Weinsorte žlahtinagebraucht. 3.5 Entlehnungen in der frühneuhochdeutschen Periode 3.5.1 Zeit der osmanischen Expansion Seit der zweiten Hälfte des 14. Jh. dringen die Osmanen immer weiter in die südöstlichen Teile Europas vor. 1396 fielen sie zum ersten Mal in Slawonien ein. Als 1463 Bosnien vollständig unter die Herrschaft der Osmanen fiel, kam es immer häufiger zu heftigen Einfällen der Türken in kroatisches Gebiet, denen auch dauerhafte Eroberungen folgten. Dies hatte gewaltige Folgen für die gesellschaftliche Entwicklung der kroatischen Gebiete, aber auch für das kroatische Königtum. Im Laufe des 15. Jahrhunderts versuchten die ungarisch-kroatischen Könige erfolglos gemeinsame Verteidigungslinien zu organisieren. So kam es zu einer Krise für die kroatisch-ungarische Staatsgemeinschaft, die nach der Schlacht bei Mohács im Jahre 1526 zerfiel. Es setzte eine massenhafte Fluchtbewegung des Adels und der bäuerlichen Bevölkerung aus Kroatien in Richtung Slawonien und zur Küste ein. Die Grenzgebiete verödeten. Ein großer Teil der Bevölkerung wurde getötet oder von den Osmanen in die Sklaverei verschleppt. Ab diesem Zeitpunkt wurde die Nähe der osmanischen Herrschaft zum entscheidenden Faktor der weiteren Entwicklung in Kroatien. 1519 verleiht Papst Leon X. Kroatien den ehrwürdigen Titel Antemurale Christianitatisbzw. «Vormauer des Christentums» (Antoljak, 1994: 80). Kroatische Intellektuelle wie Marko Marulić, Petar Zoranić und Bernardin Zane und viele andere schrieben von den Untaten der Osmanen und versuchten somit, das Problem der Verteidigung von den Türken zu internationalisieren und Hilfe von den Habsburgern und Europa zu erhalten. Die Kroaten haben nämlich nicht nur ihr eigenes Land verteidigt, sondern auch das christliche Europa. Außer etwas Geld vom Papst und moralischer Unterstützung, Segen und Mitleid kam jedoch nichts (Samaržija, 2001: 162). 3.5.2 Fortführung der Personalunion und die Militärgrenze Nach dem Scheitern der politischen Verbindung zwischen Kroatien und Ungarn suchte die kroatische Aristokratie Unterstützung im Westen und wählte im Jahre 1527 den Habsburger Ferdinand zum kroatischen König. Dies war der Beginn einer festen und andauernden Verbindung Kroatiens zu Österreich und somit auch die Grundlage für die direkten (österreichisch)deutsch-kroatischen Sprachkontakte (Žepić, 2002: 214). Kroatien wurde somit Teil der Habsburgermonarchie, und diese politische Gemeinschaft dauerte bis zum Zerfall der österreich-ungarischen Monarchie im Jahre 1918. Dieser direkte Sprachkontakt führte zur intensiveren Entlehnung in beide Richtungen, obwohl der Einfluss der deutschen Sprache auf die kroatische immer stärker war als umgekehrt (Babić, 1990: 214) und die Sprachkontakte somit asymmetrisch angelegt waren. Es gibt mehrere Faktoren, die die Übernahme deutscher Entlehnungen begünstigten. Dies war vor allem die Errichtung der sog. Militärgrenze im 17. Jh., die die Habsburger als Schutz gegen die vordringenden Türken gründeten und die sich größtenteils durch kroatisches Gebiet erstreckte. Entlang der Grenze mit dem Osmanischen Reich wurden mehrere kleinere Festungsanlagen gebaut, in denen sich deutsche und kroatische Infanteristen befanden (vgl. Rothenberg und Zoglmann, 1970). Von 1849 bis 1866 war die Militärgrenze ein eigenes Kronland, das direkt unter dem k.u.k. Kriegsministerium stand, nach dem Ausgleich mit Ungarn wurde sie diesem einverleibt und Ende des 19. Jahrhunderts nach dem Rückzug der Osmanen aufgelöst. Innerhalb der Militärgrenze galt Deutsch als Amts- und Kommandosprache, so dass sich ein funktionaler kroatisch-deutscher Bilingualismus entwickelte, der sich auf ganz bestimmte Bereiche bezog. Die Träger des Sprachkontakts waren hier vor allem Soldaten (Piškorec, 2005: 56). Nach Einrichtung der Militärgrenze kam einigen Städten wie Karlovac und Varaždin eine besondere Rolle zu, da sie zum Mittelpunkt der Militärmacht wurden und die Kommandos dort untergebracht waren. Die Kommandanten waren größtenteils Deutsche (Gabričević, 2002: 70). Erzherzog Karl verwaltete im 16. Jh. die Militärgrenze und unterstützte im Jahre 1579 die Gründung der Stadt Karlovac, die zum zentralen Stützpunkt der Militärgrenze wurde. Somit entstand ein neues militärisch-politisches Territorium auf kroatischem Boden, das nicht dem Ban und Kroatischen Sabor unterlag (Antoljak, 1994: 96). Da Deutsch die Amts-, Kommando- und Unterrichtssprache war, gelangten viele deutsche Lehnwörter aus der administrativen und militärischen Terminologie in die kroatische Sprache, die auch heute noch aktiv gebraucht werden: kro. gruntovnica < dtsch. Grundbuch, kro. inspektor < dtsch. Inspektor < frz. inspecteur, kro. kancelar < dtsch. Kanzler < lat. cancellarius, kro. kancelarija < dtsch. Kanzlei < lat. cancelli. Viele Ausdrücke der Militärterminologie stammen ursprünglich aus dem Französischen und wurden über die deutsche Sprache ins Kroatische übernommen, z.B. kro. mušketir < dtsch. Musketier < frz. musquetaire «mit einer Muskete ausgerüsteter Soldat», kro. granadir < dtsch. Grenadier < frz. grenadier «für Granaten zuständiger Soldat», kro. artiljerist < dtsch. Artillerist < frz. artillerie u.v.a. Ein großer Teil dieser Ausdrücke ist auch heute noch im militärischen Wortschatz der kroatischen Sprache aktiv: kro. geler < dtsch. Geller, kro. kapetan < dtsch. Kapitän, kro. kaplar < ung. káplár < dtsch. Korporal < ital. caporale, kro. kasarna < dtsch. Kaserne < frz. caserne, kro. logor < dtsch. Lager, kro. lozinka < dtsch. Losung(-swort), kro. maršruta < dtsch. Marschroute < frz. marche-route, kro. oficir < dtsch. Offizier < frz. officier, kro. orden < dtsch. Orden, kro. ranac < dtsch. Ranzen, kro. regrut < dtsch. Rekrut < frz. recrue, kro. šanac < dtsch. Schanze, kro. šljem < dtsch. Helm, kro. šmajser < dtsch. schmeißen, kro. špalir < dtsch. Spalier, kro. šrapnel < dtsch. Schrapnell < engl. shrapnel, kro. štab < dtsch. Stab, kro. štucne < dtsch. Stutzen, kro. štuka < dtsch. kurz für Sturzkampfflugzeug, kro. trupa < dtsch. Trupp < frz. troupe. Seit der Eigenständigkeit Kroatiens 1991 wurden viele Militärausdrücke, insbesondere diejenigen deutscher Herkunft, durch kroatische Äquivalente ersetzt. Es handelt sich dabei um die Wiederbelebung alter kroatischer Bezeichnungen, die mit dem Dekret aus dem Jahre 1918 verboten wurden (vgl. Samardžija, 2003: 111). Aber auch heute haben sich einige Termini in der Fachsprache des Militärs bewahrt wie geler, logor, lozinka.1 Einige Ausdrücke sind in einzelnen Ortssprachen gebräuchlich und haben ihre ursprüngliche Bedeutung verloren, z.B. der Ausruf Wer ist da?,den die Grenzler entlang der Militärgrenze ausriefen, wenn sich jemand annäherte, und von den Einheimischen, die kein Deutsch verstanden, als Ber do?wahrgenommen wurde und aufgrund volksetymologischer Deutung im Verb berdokatin einigen Teilen Likas in der Bedeutung von 'laut rufen' wiederzufinden ist (Dasović/Kranjčević, 2003: 141). 3.6 Entlehnung in der neuhochdeutschen Periode 3.6.1 Neue Kolonisierungen In den ersten Jahrhunderten der Neuzeit erlebte das kroatische Volk seine schwierigsten Zeiten. Das kleine Kroatien befand sich zwischen zwei Großmächten – im Osten die Osmanen, im Westen die Habsburger, deren Kriege vor allem auf den Gebieten des heutigen Kroatien ausgeführt wurden. Die Osmanen drangen immer weiter vor und eroberten Gebiete unter dem Bannus und dem Sabor. Das kroatische Territorium wurde bis zum Ende des Jahrhunderts um mehr als die Hälfte reduziert, so dass eine systematische Kolonisierungspolitik von Seiten des Wiener Hofes (Karl VI., Maria Theresia und später Josef II.) folgte. Der Hauptstrom der Zuzügler kam aus dem sog. Vorderösterreich (Schwaben), aber auch aus anderen Teilen des Deutschen Reiches (Rheinland, Luxemburg) oder aus Österreich. Aus dieser Periode stammt auch die gemeinsame umgangssprachliche Bezeichnung aller Deutschsprachigen im Kroatischen Švabo(»der Schwabe«). Gerade die Donauschwaben bildeten in den Städten Slawoniens zusammen mit den k.u.k. Militärs entlang der Militärgrenze zum damaligen Osmanischen Reich seit dem 18. Jh. eine bürgerliche Schicht, die auf moderne Strömungen in der kroatischen Gesellschaft großen emanzipatorischen Einfluss ausübte. Die erste große Welle der deutschsprachigen Kolonisten kam Ende des 17. Jh., als die Habsburger 1687 die Türken aus den östlichen Teilen des heutigen Kroatien vertrieben. Die langjährigen Kriege gegen die Türken verwüsteten große Teile Kroatiens. Viele Kroaten kamen im Kampf gegen die Türken ums Leben, viele flüchteten in andere Teile Kroatiens (hauptsächlich an die Küste) und ein großer Teil wurde islamisiert. Diese Gebiete mussten neu angesiedelt werden. Deshalb gehörte es zu den Prioritäten der Habsburger Monarchie, die neu hinzugekommenen Gebiete mit Menschen, die der Dynastie treu waren und die große Verantwortung für den Wiederaufbau der verwüsteten Gebiete auf sich nahmen, planmäßig zu besiedeln. Das deutsche ethnische Element spielte dabei eine tragende Rolle (Štuka VDG, 1995: 98). Auch strategische Gründe sprachen dafür, dass die Deutschen so schnell wie möglich die wirtschaftliche Grundlage für neue Kriege gegen die Türken schaffen sollten, um Österreich zu ermöglichen, über den Balkan in den Osten vorzudringen. Die Besiedlung Nord- und Ostkroatiens von Seiten deutscher Einwanderer im 17. und 18. Jh. begünstigte erneut den Bilingualismus. Unter den neuen Siedlern befanden sich zahlreiche Handwerker. Viele von ihnen waren aus Bayern, aus der Rheingegend, aus Österreich, der Steiermark und Kärnten. Die neuen Zuwanderer übten einen großen Einfluss auf die autochthone Bevölkerung aus, der sich in allen Lebensbereichen abzeichnet und in den vielen deutschen Lehnwörtern im Kroatischen widerspiegelt. Unter dem Einfluss der deutschen Siedler bildete sich in der slawonischen Stadt Osijek sogar eine Mischsprache, das Essekerische, heraus (vgl. Petrović, 2001). Der Zuwachs der städtischen Bevölkerung gab vielen deutschen Handwerkern und Händlern Grund, sich auch in diesen Städten anzusiedeln. Die Migrationsströme flossen aus allen Richtungen in städtische Zentren und wurden auf diese Weise zum Hauptfaktor der demographischen Entwicklung. Die Kolonisten waren nicht nur Handwerker und Händler, sondern auch Landarbeiter, die sich wirtschaftlich schnell entwickelten und bald ihre eigenen Manufakturen und Fabriken gründeten und somit den Kern des wachsenden Bürgertums bildeten (Gabričević, 2002: 74). Die Gebiete, die stärker von der deutschen Kolonisierung betroffen waren, sind Slawonien und Nordkroatien. Die erste Besiedlungswelle im Banat, Bačka und Baranja erfolgte in der Zeit der Verwaltung des Gouverneurs Graf Klaudius Ferdinand Mercy, der von 1722 bis 1727 vor allem Handwerker und Bauern, etwa 10000 in 57 Siedlungen ansiedelte. Die zweite Welle folgte zwischen 1768 und 1771 in der Regierungszeit von Maria Theresia und zählt etwa 5000 Familien, die 50 neue Siedlungen und 30 schon bestehende besiedeln. Die dritte Welle beginnt zur Zeit der Herrschaft Joseph II. (1784–1787). Der Großteil der deutschen Ortschaften in Slawonien entstand um die Städte Osijek, Vinkovci und Vukovar herum. Die Kolonisierung der Deutschen im Südosten Europas wurde nach dem Wiener Frieden im Jahre 1810 intensiver, vor allem kamen Siedler aus Württemberg, Baden und Hessen. Ende des 18. Jh. und Anfang des 19. Jh wurden vor allem die Gebiete um Đakovo besiedelt (Geiger, 2001: 60). Vor der deutschen Kolonisierung bebauten die alteingesessenen Einwohner das Land auf traditionelle Art und Weise, durch Brachlegung, während die zugewanderten Deutschen die Fruchtfolge verwendeten. Die modernen Arbeits- und Anbaumethoden und neue verbesserte Viehrassen, die die deutschen Kolonisten einführten, wirkten innovativ auf die anderen Ethnien ein, hinterließen aber auch in der kroatischen Sprache ihre Spuren. So stammen aus dieser Zeit: kro. cvikcange < dtsch. Zwickzange, kro. rundhamer < dtsch. Rundhammer, kro. špicange < dtsch. Spitzzange, kro. švasati < dtsch. schweißen u.a. Das enge Zusammenleben der deutschen Siedler und Kroaten sowie die starke Position der deutschen Sprache im 18. und 19. Jh. führte zum starken Einfluss auf die autochthone Bevölkerung in allen Lebensbereichen. Die bis dahin mit Stroh bedeckten und Feuerstellen beheizten Häuser ersetzten die auf römische Art gebauten Häuser, deren Elemente die deutschen Siedler übermittelten: kro. cigla < dtsch. Ziegel < lat. tegula, kro. letva < dtsch. Latte, kro. malter < dtsch. Mörtel, kro. planka < dtsch. Planke, kro. šalovanje < dtsch. Verschalung, kro. šindra < dtsch. Schindel usw. Die Häuser wurden mit Kachelöfen (> kro. kaljeva peć) und später mit Sparherden (> kro. špaher) geheizt. Die deutschen Siedler beeinflussten ebenfalls auch die räumliche Gestaltung der Häuser: kro. forcimer < dtsch. Vorzimmer, kro. ganjak < dtsch. Gank, kro. hala < dtsch. Halle, kro. špajza < dtsch. Speisekammer, kro. štenge < österr. Stiege u.a. Hilfsräume: kro. šajer < österr. Scheuer, kro. štala < dtsch. Stall, kro. šupa < dtsch. Schuppen, sowie die Wohnkultur selbst: kro. firange < dtsch. Vorhang, kro. hoklica < österr. Hockerl, kro. mebl < dtsch. Möbel < frz. meuble, kro. pult < dtsch. Pult, kro. tepih < dtsch. Teppich. Bei dieser Übernahme spielten besonders größere Städte wie Zagreb, Osijek und Varaždin, wo sich das Bürgertum konzentrierte, eine bedeutende Rolle. Von dort aus verbreitete sich das diesbezügliche Sprachgut auf die ländliche Umgebung (Schneeweis, 1960: XIX). In die Provinz gelangte das Neue auch durch den Handel, weil viele deutsche Händler und Handwerker Hausrat verkauften bzw. anfertigten und damit Wörter, die sie benannten, verbreiteten: kro. batrol < dtsch. Backrohr, kro. bratvan/protvan /protvanj < dtsch. Bratpfanne, kro. beštek < dtsch. Besteck, kro. cukerdoza < dtsch. Zuckerdose, kro. cukerpiksla < österr. Zuckerpiksl, kro. dunstflaša < österr. Dunstflasche 'Einmachglas', kro. escajg < dtsch. Esszeug, kro. faselj/faslin < österr. Fasslein, kro. flajšmašina < dtsch. Fleischmaschine, kro. flaša < dtsch. Flasche, kro. flašica < dtsch. Fläschchen, kro. fraklić < österr. Frackele/Frackl, kro. glažak < dtsch. Glas, kro. holjba < dtsch. Halbe, kro. kafelefl < dtsch. Kaffeelöffel, kro. kafemil < dtsch. Kaffeemühle, kro. kostšale < dtsch. Kostschale, kro. krigla/krigl/kriglin/krigljin < österr. Krügel, kro. nudlbret/ nudlpret < dtsch. Nudelbrett/Nudelprett, kro. pajtmlin < dtsch. Beutelmehl 'Mühle', kro. piksa/piksla < dtsch. Büchse / österr. Büchsel, kro. platna < dtsch. Herdplatte, kro. pleh < dtsch. Blech, kro. rajngla < österr. Reine, kro. ribež < dtsch. Reibeisen, kro. ringla < dtsch. Herdring/Ringl, kro. rerna/rol/ror < dtsch. Röhre, kro. roštilj < österr. Roschtl, dtsch. Grillrost, kro. sajtlik < österr. Seidelglas /Seitel, kro. supntopf/zupntopf < dtsch. Suppentopf, kro. šeflja/šerfa < dtsch. Schöpflöffel, kro. šola/šolja < dtsch. Schale, kro. šnešlager < dtsch. Schneeschläger, Schneebesen, kro. špajservis < dtsch. Speiseservice, kro. štampl < österr. Stamperl, kro. šparhet/šparet/šporet < dtsch. Sparherd, kro. šprica < dtsch. Spritze, kro. štoplciger < dtsch. Stoppelzieher, kro. taca/tacn/tacna < dtsch. Tasse, österr. Tazzerl, kro. termosflaša < dtsch. Thermosflasche u.a. Die relativ große Zahl der Bezeichnungen für Gefäße und Behälter lässt sich dadurch erklären, dass die Denotate meistens durch die deutschsprachigen Handwerker und Händler verbreitet wurden. Außerdem verbreiteten sich mit dem Aufstieg des Bürgertums auch neue Etiketten und Tischsitten, die unter anderem auch die Benutzung von unterschiedlichem Besteck einschlossen. Dies führte auch zu Veränderungen in der Tradition und den Bräuchen. So wurde die kroatische Speiselandschaft mit neuen Lebensmitteln bereichert: kro. ajeršpajz < dtsch. Eierspeise, kro.ajgemaht/ajgemakt/ajmokac/ajngemahtec/ajngemaht/ajngemahtes/hajmoc < dtsch. Eingemachtes, kro. ajnpren/amprensupa/ajnprenjuha1 < dtsch. Einbrennsuppe, kro. aufšnit < dtsch. Aufschnitt, kro. brizle < dtsch. Briese, kro. cukmiz < dtsch. Zugemüse, kro. cušpajz/čušpajz < dtsch. Zuspeise, Beilage, kro. cvibok < dtsch. Zwieback, kro. dunst < dtsch. Dunstobst, kro. ekstrabušt/ekstravuršt < dtsch. Extrawurst, kro. ementaler < dtsch. Emmentaler, kro. fišpaprikaš < dtsch. Fisch + ung. paprikás, kro. flam < österr./bair. Fläme, kro. flek(l)e < dtsch. Fleckchen/Fleckerl, kro. forbiks < dtsch. Bartwichs, kro. frišljing < dtsch. Frischling, kro. geršl/geršla/gešlo < dtsch. Gersche/Gerste, kro. griz < dtsch. Gries, kro. grizknedla/krisknedla < dtsch. Grießknödel, kro. griznokle < dtsch. Grießnockerl, kro. jeger < dtsch. Jägerwurst, kro. jesih < dtsch. Essig, kro. kajzerica < dtsch. Kaisersemmel, kro. kajzeršmarn < dtsch. Kaiserschmarren, kro. knedl/knedla < dtsch. Knedl/ Knödel, kro. kramlpogačice < dtsch. Grammelpogatsche, kro. krautflekerli < dtsch. Krautfleckerl, kro. krumpir < dtsch. Grundbirn/Krumpire, kro. lebervuršt < dtsch. Leberwurst, kro. liptauer < dtsch. Liptauer, kro. lungnbratn < dtsch. Lungenbraten, kro. meršpajz < dtsch. Mehlspeise 'Nudeln', kro. mudlin/nudle < dtsch. Nudel, kro. nokrl/noklice/nokle < dtsch. Nockerl, kro. pajšl < dtsch. Beuschl, kro. parizer < dtsch. Pariser, kro. perec < österr. Brezen, kro. pohendle < österr. Backhendl, kro. prezbušt/prezmušt/prezvuršt < dtsch. Presswurst, kro. putar < dtsch. Butter, kro. reštano < dtsch. Röstkartoffeln, kro. ričet < österr. Ritscher(t), kro. rolšunka < dtsch. Rollschinken, kro. rostbraten < dtsch. Rostbraten, kro. saft < dtsch. Saft 'Fleischgericht, Soße', kro. sulc < dtsch. Sülze, kro. sulcflajš < dtsch. Sulzfleisch, kro. supa/župa < dtsch. Suppe, kro. šmarn < österr. Schmarren, kro. šol < dtsch. Scholle, kro. šnicl/ šnicla < dtsch. Schnitzel, kro. šnitlauh < dtsch. Schnittlauch, kro. špek < dtsch. Speck, kro. špek fileki < Speck + österr. Kuttelflecke, kro. štercl < österr. Sterz, kro. šunka < österr. Schunken, kro. švargla < dtsch. Schwargel/Schwarte, kro. vaseršpacne < Wasserspatzen, kro. virfcuker < dtsch. Würfelzucker, kro. viršl/viršla < südd. Wirschtl/Würstel, kro. zemlknedl < österr. Semmelknödel, kro. žemla/žemlja < österr. Semmel, kro. žlundra < dtsch. Schrunde, kro. žmalc < dtsch. Schmalz u.v.a. Die traditionelle kroatische Bauernküche bestand hauptsächlich aus Eintopfgerichten (Rittig-Beljak, 2002: 91). Die erhaltenen deutschen Entlehnungen zeugen von der Übernahme von Getreide- und Gemüsekulturen, Mehl- und Fleischspeisen sowie deren Zubereitungsarten. Manchmal geht es aber nur um neue Bezeichnungen für schon Bekanntes, wie beispielsweise bei ajeršpajz(e)(< Eierspeise), putar(< Butter) oder špek(< Speck). Die Fülle an Ausdrücken für Wurst- und Fleischprodukte ist ein direkter Einfluss der deutschsprachigen Kolonisten, die in ihre neue Heimat nicht nur viele bisher unbekannte Ausdrücke, sondern auch ihre Erfahrungen in der Verarbeitung von Wurst- und Fleischprodukten mitbrachten (ebd. 176). Dank der Entdeckung der Mahlgutreinigungsmühle durch Ignaz Paur im Jahr 1810 kommt feines, kleingemahlenes Mehl auf den Markt. Die österreichischen und deutschen Müller haben diese Innovation mit als erste übernommen. Die deutschsprachigen Siedler brachten in ihre neue Heimat diese Technologie mit, die die Zubereitung einer ganzen Reihe von Mehlspeisen ermöglichte: kro. bakpulver < dtsch. Backpulver, kro. cvajer < dtsch. Zweier(mehl), grob gemahlenes Mehl, kro. dunst < dtsch. Dunst 'Mehlsorte', kro. fil/fila < dtsch. Fülle/Füllung, kro. flok < dtsch. Flocke, kro. germa < dtsch. Germ, kro. germitij/germtajg < dtsch. Germteig, kro. glazura < dtsch. Glasur, kro. grif/grifik < dtsch. griffig 'Mehlsorte', kro. grinc/grincajg < dtsch. Grünzeug, kro. gris/griz/kriz < dtsch. Grieß, kro. grizmelj < dtsch. Grießmehl, kro. gvirc < dtsch. Gewürz, kro. ingver < dtsch. Ingwer, kro. lorber < dtsch. Lorbeer, kro. me(j)la /melja/mel/muntvel < dtsch. Mehl, kro. mirbetajg < dtsch. Mürbeteig, kro. pac < dtsch. Beize/Peize, kro. pajtlin < dtsch. Beutelmehl, kro. prezle < dtsch. Brösel/Pröslein, kro. šam < dtsch. Schaum 'Eischnee', kro. šne < dtsch. (Ei)Schnee, kro. štaub/štaubcuker/štaubcukar/štaubšećer < dtsch. Staubzucker, kro. štoverak/štolver < dtsch. Stowellwerke2 'Würfelzucker' u.a. Außerdem wurden neue Zubereitungsarten von Speisen in die bisher eher einfache kroatische Küche aufgenommen: kro. ajpaniren < dtsch. einpanieren, kro. braunati < dtsch. bräunen, kro. denfati/tenfati < dtsch. dämpfen, kro. dinstati < dtsch. dünsten, kro. faširati < dtsch. faschieren, kro. filati/filovati < dtsch. füllen, kro. garbati < dtsch. gärben, kro. pajtlati < dtsch. beuteln, kro. pohati/pohovati < dtsch. bachen, backen 'panieren', kraot. poštaubati < dtsch. stäuben, kro. rašpati < dtsch. raspeln, kro. restati < dtsch. rösten, kro. ribati < dtsch. reiben, kro. špikati/špikovati < dtsch. spicken, kro. špinati < dtsch. spinnen, kro. šprudlati < dtsch. sprudeln usw. Kuchen und andere Süßspeisen werden schon in den Werken kroatischer Schriftsteller aus dem 15. Jh. erwähnt, und im 18. Jh. sind sie in der Küche aller Schichten vertreten (ebd. 12). Aber erst das Erscheinen des Sparherdes mit Backrohr ermöglichte ihre leichtere, häufigere und auch mannigfaltigere Zubereitung. Die erhaltenen deutschen Entlehnungen zeugen davon, dass viele – obwohl aus anderen Sprachen stammend – durch deutschsprachige Vermittlung ins Kroatische übernommen wurden. kro. buhtla < österr. Buchtel, kro. firzitšnita < dtsch. Pfirsichschnitte, kro. grizkoh/koh < österr. Grießkoch, kro. indijaner < dtsch. Indianerkrapfen, kro. išler < österr. Ischler, kro. kifl/kifla < österr. Kipfel/Kipfl, kro. kitnkez < österr. Kütte + käse, Quittenmus, kro. krafna < österr. Krapfen, kro. kremšnita < österr. Cremeschnitte, kro. kuglof < österr. Gugelhupf/Kugelhopf, kro. lincer < österr. Linzer, kro. londoner < dtsch. Londoner, kro. melšpajz < österr. Mehlspeise 'Kuchen', kro. milihbrot/ milbrot/milibrot /miliprot/miliprut < österr. Milchbrot, kro. oberst/obrst < österr. Obers, kro. pogača < österr. Pogatsche, kro. puslice < österr. Busserl, kro. rajskoh < österr. Reiskoch, kro. šampita/šaumpita < österr. Schaum + türk. pita, kro. šamšnita < österr. Schaumschnitte, kro. šamrola < österr. Schaumrolle, kro. šlag < österr. Schlagobers, kro. šnenokli < österr. Schneenockerl, kro. štanglice < österr. Stangl, kro. štrudla/štrukli < dtsch. Strudel, kro. tačak < dtsch. Tasche, kro. tačkerli < österr. Tascherl u.a. Das Essen wurde in den Großfamilien bei den Kroaten in einer großen Schüssel serviert. Bei den deutschen Kolonisten, die eher in Kleinfamilien lebten, war es jedoch üblich, die Hauptmahlzeit in mehreren Gängen einzunehmen. Darauf lässt sich die Übernahme der Bezeichnungen für Mahlzeiten und Gänge zurückführen (vgl. Ivanetić/Stojić, 2009: 105): kro. fruštik/fruštuk < dtsch. Frühstück/ Fruhstuck, kro. gablec < österr. Gabelfrühstück, kro. jauzn/jauzna < österr. Jause, kro. nahšpajz < österr. Nachspeise, sowie Verben wie fruštukati/ fruštukovati, jauznati u.a. In einige Gegenden Kroatiens gelangten neue Benennungen auch durch deutschsprachige Arbeiter, wie z.B. in Gorski kotar, wohin bayerische Holzhacker das Bohnengericht Bartwichs mitbrachten und die dortige Bevölkerung es als vorbiksentlehnte (Schneeweis, 1960: 27).3 Eine weitere wichtige Rolle spielten deutschsprachige Kochbücher, die es in der Habsburgermonarchie seit 1686 gab. Das bekannteste Kochbuch der Monarchie, jenes der Grazerin K. Prato von 1858, wurde vom bilingualen kroatischen Bürgertum im Original benutzt, obwohl es in alle 16 Sprachen der Monarchie übersetzt worden war. Das erste Kochbuch auf Kroatisch stammt aus dem Jahr 1813 (Rittig-Beljak, 2002: 27ff). Der stärkere Einfluss des Deutschen im Norden hat sich nicht nur auf die Zahl der deutschen Lehnwörter ausgewirkt, sondern hat die gesamte Ess- und Trinkkultur stärker beeinflusst als die der Küstenregion. Letztere zeichnet sich nämlich als Teil des Mittelmeergebietes durch ihre traditionelle mediterrane Ess- und Trinkkultur aus. Trotzdem wurden einzelne Zutaten und Speisen, z.B. Sahne und Torten, auch hier populär und in lokale Kochbücher aufgenommen (ebd. 78). Daran erkennt man ebenfalls, dass Entlehnungsprozesse immer auch ein Resultat von Kulturkontakten sind. Falls hier Bezeichnungen für Gerichte und Getränke übernommen wurden, konkurrieren sie meistens mit schon vorhandenen Lexemen verschiedener Herkunft, so dass sich mit der Zeit koexistierende Dubletten herausgebildet haben, z.B. njoki(ital. gnocchi) versus noklice(dtsch. Nockerl) versus valjušci(kro.), oder šufigat(ital. soffocare) versus dinstati(dtsch. dünsten) versus pirjati(kro.). Eine andere Situation zeigt sich an der vorwiegend von österreichischen Touristen besuchten Nordadria, wohin mitteleuropäische Gerichte und die sog. Wiener Küche, die ein „Konglomerat verschiedener internationaler Berührungen“ war, gelangten (ebd. 14). Mit ihnen kamen auch entsprechende Entlehnungen. Eine weitere Innovation zeigt sich im Bereich der Bekleidung: kro. falda < dtsch. Falte, kro. fudra < dtsch. Futter, kro. šnala < dtsch. Schnalle, kro. španga < dtsch. Spange, kro. štof < dtsch. Stoff, kro. veš < dtsch. Wäsche, kro. žniranci < dtsch. Schnürsenkel u.a. Mit den neuen Kleidungsgegenständen kam auch eine bis daher unbekannte Art und Weise ihrer Bearbeitung und Ausarbeitung: kro. heftati < dtsch. heften, kro. heklati < dtsch. häckeln, kro. peglati < dtsch. bügeln, kro. štepati < dtsch. steppen, kro. štirkati < dtsch. stärken usw. Die deutschen Kolonisten und ihre Nachfolger wurden, wie schon erwähnt, von den Einheimischen Švabegenannt, nach dem deutschen Volk der Schwaben,4 die aus dem Westen Bayerns und aus Württemberg kamen, die geographisch Kroatien am nächsten sind. Aber aus dem Schwabenland kam nur ein Teil der deutschen Siedler, viele kamen auch aus dem Sudetenland, Hessen, der Pfalz, Lothringen und dem Saarland. Ein Grund, weshalb die Kroaten die Deutschen auch heute noch pejorativ als Švabebezeichnen, liegt wahrscheinlich darin, dass sich ihre Sprache wesentlich von der der anderen deutschen Siedler unterschied. Außerdem haben sich die Donauschwaben vor allem in abgeschiedenen, national homogenen Dörfern angesiedelt. Die anderen Zuwanderer kamen meistens einzeln und siedelten sich kontinuierlich in städtischen Zentren an und wurden von der einheimischen Bevölkerung schnell angenommen (Žepić, 2002: 215). Die deutschen Zuwanderer, die aus unterschiedlichen deutschsprachigen Teilen in größeren Gruppen kamen, hatten keine ausgeprägte nationale oder politische Identität oder ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Dieses wuchs erst nach ihrer Ansiedlung, insbesondere wegen der sprachlichen und kulturellen Distanz gegenüber den Einheimischen und Siedlern aus dem nicht-deutschsprachigen Raum. Dies führte zu einer engen Gemeinschaft der deutschsprachigen Siedler gleich zu Beginn, die untereinander Deutsch sprachen und für eine lange Zeit die gleichen Bräuche und Lebensweise praktizierten. Auf diese Weise widerstanden sie der Assimilation und bewahrten ihre Sprache und Kultur noch viele Jahre nach ihrer Zuwanderung (Geiger/Kučera VDG, 1995: 88). 3.6.2 Zeit der Aufklärung und des aufgeklärten Absolutismus Im 18. Jh. stieg der Status des Deutschen in Kroatien wegen der Sprachpolitik der Habsburger Monarchie unter der Herrschaft der Aufklärer Maria Theresia (1740–1780) und ihrem Sohn Joseph II. (1780–1790). Diese Zeit kennzeichnete der Wille zur Germanisierung und Zentralisierung, sowie zur Fortführung der pangermanischen Politik, geleitet vom Drang nach Osten. Die Amtssprache innerhalb der Militärgrenze war seit ihrer Gründung das Deutsche. Mit der Allgemeinen Schulordnung für die deutschen Normal-, Haupt- und Trivialschulen in sämmtlichen kais.-königl. Erbländernrichtete Maria Theresia 1774 das Bildungswesen innerhalb der Militärgrenze neu ein: Die Unterrichtssprache ist grundsätzlich Deutsch. Für den ungarisch-kroatischen Teil der Monarchie verfügte Maria Theresia mit der sog. Ratio educationis totiusque rei literariae per regnum Hungariae et provincias eidem adnexasim Jahre 1777, dass als Unterrichtsprache diejenige Sprache empfohlen wird, die in diesem Bezirk gesprochen wird. Daneben können aber auch Deutsch und die Anfänge des Lateins gelernt werden (Häusler, 2000: 60). Der Beschluss von Joseph II. zeugt noch mehr von der Absicht der Herrscherfamilie, die kroatischen Gebiete zu germanisieren. Ihm nach sollte die deutsche Sprache nämlich zur zentralen Verwaltungs- und Verkehrssprache der Monarchie werden. 1784 erließ der Kaiser den Beschluss, den Unterricht in kroatischen Gymnasien auf Deutsch zu halten und zwar auf der Grundlage deutscher Lehrbücher. Ebenfalls habe jeder Beamter innerhalb von drei Jahren Deutsch zu lernen (Antoljak, 1994: 112). Auf diese Weise kam der deutschen Sprache bis zum Ende des 18. Jh. in der sozialen Struktur der kroatischen Gesellschaft eine besondere Rolle zu: Latein war noch immer die Sprache der Politik und Wissenschaft, Deutsch die Umgangssprache der höheren Gesellschaftsschicht und das Kroatische diente zur Kommunikation mit den Bediensteten und der unteren Gesellschaftsschicht (Kessler, 1986: 73). Joseph II. musste 1789 unter dem Druck der Magnaten diese Beschlüsse zurückziehen. Latein wurde wieder zur Unterrichtssprache und die Lehrer, die früher wegen des Nicht-Beherrschen der deutschen Sprache entlassen wurden, bekamen ihre Arbeitsplätze zurück. Seither ist die deutsche Sprache ein Unterrichtsfach wie jedes andere (Häusler, 2000: 65). Der Widerstand gegen die sog. josephinischen Sprachverfügungen konnte jedoch die Vorreiterstellung der deutschen Sprache in der überregionalen Kommunikation nicht schwächen. Die gesellschaftliche Dominanz des Deutschen war unaufhaltbar (Kessler, 1986: 72). Dies bedingte die Stellung des Deutschen innerhalb der Habsburger Monarchie. Die deutsche Sprache konnte sich nämlich im 18. Jh. als Standardsprache im gesamten deutschsprachigen Raum durchsetzen. Der wohlhabende Adel, Militäroffiziere und Händler, die die dominante Schicht der städtischen Bevölkerung bildeten, nahmen sich zu dieser Zeit Wien als Vorbild und übernahmen 1770 Deutsch als Verkehrssprache der alltäglichen Kommunikation. Deutsch war somit die Prestigesprache der oberen Schicht und wurde schnell zur Konversationssprache der Intellektuellen, des Handels und der Wirtschaft, des Bon Tons und der Literatur, während Kroatisch von den Handwerkern und Kaufleuten, die die Dorfbewohner und kleinbürgerliche Klientel bedienten, gesprochen wurde (Kessler, 1981: 12). Bis zum Ende des zweiten Jahrzehntes des 19. Jh. bewahrte die deutsche Sprache diesen Status insbesondere in den Städten Zagreb, Varaždin und etwas später in Karlovac. Dies unterstützte auch die Herausgabe deutscher Zeitungen, die in Zagreb erschienen ( Luna, Kroatischer Korrespondent, Agramer Zeitungu.a.). Von 1749 bis 1860 wurden die Theaterstücke ausschließlich auf Deutsch aufgeführt. Die Einwohner Zagrebs, die sich selbst als purgeri(< dtsch. Bürger) bezeichnen, nennen ihre Stadt auf Deutsch Agram. Das Deutsche der purgergewann an sozialer Bedeutung: Wer Deutsch sprach, gehörte zur „besseren“ und „feineren“ Gesellschaft des Stadtlebens (Kessler, 1986: 73). 3.6.3 Slawonien Ein anderes sprachliches Bild präsentierte sich in Slawonien. Der Stadtbevölkerung fehlte das autochthone Element, weil sie größtenteils aus den Zuwanderern der anderen Länder der Monarchie bestand. Die Situation in der Stadt Osijek war wegen ihrer geographischen Lage spezifisch, vor allem nach der Befreiung von den Türken. Seither wurde die Stadt in den darauffolgenden zwei Jahrhunderten im Zuge mehrerer großer Wellen von deutschen Siedlern besiedelt, so dass sie ca. 50 % der Bevölkerung ausmachten. Zählt man noch einige Tausend Juden, die größtenteils Deutsch sprachen, sowie das dort stationierte Militär, das vorwiegend aus deutschen Soldaten bestand, dazu, liegt der Schluss nahe, dass Deutsch zu dieser Zeit dominierte (Kordić, 1991: 89). Die deutsche Umgangssprache prägte vor allem die bairische und österreichische Varietät, aber es gab auch andere deutsche Dialekte, die die deutschen Einwanderer sprachen. In dieser sprachlichen Umgebung entwickelte sich in den täglichen regen Kontakten der Träger unterschiedlicher Kulturen und Sprachen ein besonderes Idiom des Deutschen, das Essekerische,1 heraus (Petrović, 2001: 4). Diese Sprechart gebrauchten die Angehörigen der unteren sozialen Schicht, vor allem Deutsche, mit der Zeit jedoch auch die anderen Einwohner Osijeks. Auch heute existieren noch einige Varianten, abhängig vom deutschen Dialekt, der als Grundlage für dieses Idiom diente, aber auch wegen der Intensität des Einflusses, den die autochthone Bevölkerung der Stadt ausübte. Das Essekerische entstand auch im Umkreis der ungebildeten deutschen Einwanderer, so dass seine sprachliche Struktur von der deutschen Standardsprache abweicht, z.B. im Bereich der Adjektivendungen:2 Majn anciga Anton, sou a lat!(Mein einziger Anton, so ein Leid!); Main jingere soun hot a klana pub(Mein jüngerer Sohn hat einen kleinen Buben) u.a. Osijek wurde im Laufe des 19. Jh. zum Mittelpunkt des Druckwesens für ganz Slawonien, wobei auch auf Deutsch publiziert wurde, z.B. die Zeitungen Der Volksredner, Esseker Lokalblatt, Landbote, Die Drau, Slawonische Presse, Esseker allgemeine Zeitung. Es wurde auch die deutschsprachige Literatur gepflegt. So veröffentlichte der deutsche Schriftsteller Roda Roda, der in Slawonien aufwuchs, seine ersten Bücher in den deutschen Zeitungen Die Drauund Slawonische Presse. Auch im Stadttheater von Osijek gab es Aufführungen in deutscher Sprache. In anderen Teilen Slawoniens entstanden deutsche Dorfsiedlungen, die ihre eigenen Schulen hatten, so dass sich ihre Einwohner im nationalen Sinne als Deutsche empfinden konnten. Das kroatische „Deutschtum“ war eine gesellschaftliche Konvention der oberen gesellschaftlichen Schicht, ein Prestige der herrschenden Klasse. Das Deutsche, das in unterschiedlichen kroatischen Gebieten gesprochen wurde, darf jedoch nicht als eine homogene Sprache betrachtet werden. 3.6.4 Istrien, das kroatische Küstenland und Dalmatien Während der Herrschaft von Maria Theresia kam es zu einem leichten wirtschaftlichen Aufschwung. Die Kaiserin befahl den Bau von Straßen in Slawonien und Sriem wegen ihrer militärisch strategisch wichtigen Lage. Daraufhin entschloss sich auch ihr Nachfolger Joseph II. zum Bau einer neuen Straßenverbindung zwischen Karlovac und den Küstenstädten Bakar und Senj. Die Straße wurde nach ihm benannt, die Josephina (kro. Jozefina). Sie ermöglichte die Entwicklung des Handels im kroatischen Hinterland und innerhalb der Militärgrenze (Samaržija, 2003: 29). Kurz nach dem Bau dieser Straße wurde auch der regelmäßige Eilpostweg von Wien nach Senj eingerichtet. Der Bau der Straße zwischen Gospić und Karlobag wurde 1786 beendet und bekam den Namen Theresiana (kro. Terezijana). Dies führte zum direkten Kontakt zwischen den Einwohnern der Küste mit der Bevölkerung des deutschsprachigen Raumes, den Baumeistern und Händlern. Im Jahre 1768 zählte die Zuckerfabrik in Rijeka 704 Angestellte, von denen 21 aus Hamburg waren, ein Angestellter kam aus Preußen. Im Jahre 1770 begann der Bau des Hafens in Kraljevica, der zum österreichischen Kriegshafen werden sollte (Ivanetić, 1997: 111). Die zahlreichen deutschen Lehnwörter in den Mundarten des Kroatischen Küstenlandes zeugen von diesem intensiven Sprachkontakt (vgl. Ivanetić, 1997; Turk, 2005). Die meisten gehören zum Bereich der sog. materiellen Kultur und umfassen Technik allgemein, Wohnkultur, Gastronomie, Bekleidung. Von der sozialen Sphäre zeugen z.B. Personenbezeichnungen und Ausdrücke für Spiel- und andere Geselligkeitsformen. Auf ökonomische und historische Verhältnisse verweist die Lexik im Bereich historischer Handwerke (Pferdeschmiede), Gewerbeformen (Fuhrwerk) und vor allem des Militärs (Exerzierregeln und Kommandos), zum Beispiel: celjt< Zelt (Pferdedecke aus Zeltstoff), cugalj< dtsch. Zügel, furman< dtsch. Fuhrmann, sotlar< dtsch. Sattler, vagir< dtsch. Wagendeichsel; aptak< dtsch. Habt Acht, bajbok< dtsch. Bei Wache, befel< dtsch. Befehl, durmarš< dtsch. Durchmarsch u.Ä. Mit dem Frieden von Campo Formio 1797 zwischen Napoleon und Österreich bekam die Habsburger Monarchie den ehemaligen Besitz der Republik Venedig als Vergütung für die beträchtlichen territorialen Verluste im Westen. Auf diese Weise kamen das venezianische Istrien und die Kvarnerinseln unter österreichische Herrschaft und kurz darauf auch das venezianische Dalmatien mit den Inseln und der Boka (Šidak, 1990: 21). Die Nachricht von dem Anschluss Istriens und Dalmatiens an die Habsburger Monarchie stieß auf große Begeisterung, da damit die Voraussetzungen für die Vereinigung Dalmatiens mit dem kroatischen Binnenland erfüllt waren. Als das österreichische Militär das Gebiet der ehemaligen Republik Venedig besetzte, wurde als Oberhaupt Dalmatiens der österreichische Graf Reimond Thurn bestimmt, der den Befehl ausgab, dass sich die Einwohner Dalmatiens den väterlichen und gutmütigen Absichten seiner Majestät anzupassen haben und vom Wunsch, Teil des ungarischen Königreichs zu werden, zurücktreten sollen (Samaržija, 2003: 28). Damit fiel jede Hoffnung auf eine Vereinigung. Die Habsburger beließen Dalmatien und Istrien so, wie sie sie vorfanden. Obwohl Österreich Dalmatien nicht germanisieren wollte, führte die österreichische Regierung die gleichen Veränderungen durch, wie sie sich in ganz Europa im Laufe des 19. Jh. abspielten. In dieser Zeit wurden in Dalmatien nämlich eine moderne Verwaltung, ein Zeitungswesen, Druck, ein allgemeiner Militärdienst, eine allgemeine Schulpflicht sowie ein Parteiensystem eingerichtet. Ebenfalls wurden Archive und Bibliotheken sowie Museen organisiert. Die Initiative kam aus Wien und wurde mithilfe der einheimischen Bevölkerung realisiert (Pederin VDG, 1995: 16). Mittel der Reorganisierung der Gesellschaft war das Kasino, das nach den Richtlinien des Kaisers handelte und erstmals im Jahre 1800 in Makarska und 1817 in Split erwähnt wurde. Es handelt sich um einen geschlossenen Club, in dem Zeitungen gelesen und Billard gespielt wurde und Theatervorstellungen stattfanden. Die Mitglieder waren Offiziere, alle Adeligen der Monarchie, alle Beamten, der Bürgermeister, Domherren, Gymnasiallehrer und Anwälte. Diese Gesellschaft war geschult und wohlhabend und auf ihr beruhte der Staatsapparat. Bis zur Mitte der dreißiger Jahre sprach die Mehrheit der Mitglieder des Kasinos in Dalmatien Italienisch, die Offiziere und einige Beamte jedoch Deutsch. Im Jahre 1797 wurde das Felbinger Gesetz über das allgemeine Schulwesen für deutsche „normale“ und „triviale“ Schulen in allen kaiserlich-königlichen Nachfolgeländern herausgegeben, die sog. Allgemeine Schulordnung. Italienisch bewahrte in Dalmatien jedoch seine Dominanz und blieb während der gesamten sog. ersten österreichischen Herrschaft (1797–1806) die Unterrichtssprache. Im neuen Krieg zwischen Österreich und Napoleon 1805 verlor die Habsburger Armee und Napoleon übernahm die Herrschaft über Istrien und Dalmatien. Schließlich wurden 1809 alle kroatischen Gebiete südlich der Save der französischen Verwaltung unterstellt und bekamen den Namen "Illyrische Provinzen" mit der Hauptstadt im slowenischen Ljubljana. Interessant ist, dass Napoleon seine Proklamation an das kroatische Volk im Jahre 1809 auf Deutsch hielt und während seiner Herrschaft französische Gesetze auf Kroatisch und Deutsch veröffentlicht wurden. Das feudale Staatssystem der Habsburger wurde durch ein modernes, zentralistisches abgelöst. Unter der aufgeklärten Regierung des Marschalls Marmont wurden Verwaltung und Justiz reorganisiert. Das öffentliche Schulwesen wurde nach französischem Muster umorganisiert und neue Ideen eingebracht. Napoleons Herrschaft vereinte viele Kroaten zum ersten Mal in einer Verwaltungseinheit, und die Idee der südslawischen Gemeinschaft mit den Slowenen wurde in dieser Zeit geboren (Seton-Watson, 1913: 13). Diese Herrschaft dauerte bis zum Jahre 1813 als Napoleon in der Völkerschlacht bei Leipzig verlor. Das französische Militär musste sich daraufhin aus Dalmatien zurückziehen und die Verwaltung ging bis zum Zerfall der Österreich-ungarischen Union im Jahre 1918 wieder an Österreich. In der Zeit seiner zweiten Herrschaft in Dalmatien, wurde 1814 der Beschluss ausgegeben, Französisch in Gymnasien einzustellen und dafür Deutsch als Unterrichtsfach einzuführen (Pehar VDG, 1995: 66). In den Gymnasien der dalmatinischen Städte Zadar, Split und Dubrovnik wurde nach dem Modell des österreichischen Schulwesens gearbeitet. Die besten deutschen Lehrbücher wurden ins Italienische übersetzt, weil Italienisch auch weiterhin die Unterrichtssprache war. Mit dem Beschluss aus dem Jahre 1814 bekam jedes Gymnasium einen Deutschlehrer. In Zadar wurde 1822 das zweijährige philosophische Lyzeum und der Lehrstuhl für Deutsch eröffnet, die auf das Studium an einer der österreichischen Universitäten in Wien und Graz vorbereiteten. Das Ministerium des öffentlichen Unterrichts in Wien regte zum Lernen der deutschen Sprache an dalmatinischen Gymnasien an, weil die Dalmatiner seit Anfang des 19. Jh. gerne an österreichischen Hochschulen studierten (Pederin VDG, 1995: 20). Die deutsche Sprache sollte die Sprache der Monarchie und die Quelle des Gesetzwesens werden, während Italienisch für die Bedürfnisse des Seehandels gelernt werden sollte. Die österreichische Verwaltung betrachtete das Italienische als Sprache der Kultur, trotzdem wollte man, dass alle Beschäftigten in Dalmatien Deutsch lernen (Pederin, 1996: 95). Deutsch erreichte jedoch in Dalmatien nie den Status, das es in Nordkroatien genoss. Österreich hatte hauptsächlich einen guten Ruf und wurde als Zivilisationsmacht gesehen. 3.6.5 Zeit der Illyrischen Bewegung Nach dem Tod von Joseph II. im Jahre 1790 veränderten sich die politischen Systeme in den kroatischen Ländern ständig. Das war die Zeit der ungarischen Hegemonie, gegenüber der die kroatischen Intellektuellen und Geistlichen einen Widerstand entwickelten. Nach dem Fall Napoleons und der Stabilisierung des politischen Systems kam in der bürgerlichen Schicht zuerst die Idee einer politischen Einheit aller Kroaten auf. Junge kroatische Intellektuelle, die vornehmlich in Wien, Pest, Graz und Prag studierten und dort auf fortgeschrittene Ideen trafen, wurden zu den Trägern des Prozesses der nationalen Vereinigung. Im Jahre 1827 wurde der kroatische Adel gezwungen, Ungarisch in den Schulen als obligatorisches Pflichtfach anzuerkennen. Der Adel, bisher der Verteidiger der nationalen Idee, war nicht mehr imstande, die Kroaten vor der Magyarisierung zu schützen. In Kroatien hatten sich aber inzwischen eine Bürgerschicht und intellektuelle Kreise herausgebildet, die die neuen Ideen aufgriffen und sich an die Spitze der "nationalen kroatischen Wiedergeburt" stellten, die Illyrische Bewegung. Der wichtigste Vertreter dieser Idee war Ljudevit Gaj und sein erster Schritt in Richtung Vereinigung der kroatischen Länder war die Schaffung einer einheitlichen Schriftsprache für alle Kroaten, weil es unterschiedliche Traditionen der kroatischen Schriftsprache gab. Dabei kam der deutschen Sprache in Kroatien eine wichtige Rolle zu. Sie hatte nämlich einen wesentlichen Einfluss in den Städten, wo einzelne Führungskräfte der nationalen Bewegung der deutschen Sprache besser als ihrer eigenen Muttersprache kundig waren. Im Bestreben um die Standardisierung der kroatischen Sprache auf der Grundlage des neustokavischen Dialektes stellte die Kommunikation auf Deutsch im Nordwesten Kroatiens und der Stadt Zagreb die einzige Möglichkeit des Austausches von Ideen der Gebildeten und so auch der Vertreter der Illyrischen Bewegung dar. Einige von ihnen wirkten unter kroatischem Pseudonym um somit „kroatischer“ zu klingen, z.B. der bekannte Komponist Ignatius Fuchs, dessen Pseudonym Vatroslav Lisinki lautet oder Jakob Frass, der heute bekannter unter dem kroatischen Namen Stanko Vraz ist (Samaržija, 2003: 43). Deutsch war Statussprache, weil die mittlere und obere Schicht auf Deutsch verkehrte. Die Landessprache war für sie die Sprache des einfachen Volkes. Diese gesellschaftliche Dominanz bewahrte das Deutsche in den kroatischen und slawonischen Städten bis zum Zerfall der österreich-ungarischen staatlichen Gemeinschaft im Jahre 1918. Somit war Deutsch eigentlich eine Brückensprache. Ljudevid Gaj und Ivan Kukuljević verfassten ihre politischen Ideen zunächst auf Deutsch und übersetzten sie daraufhin in die Volkssprache. Der kroatische Schriftsteller Ivan Trnski schrieb 1839: „Auch ich bediente mich früher des Lateins und des Deutschen, ich war ihr Sklawe“ („I ja sam prije latinštini i nemčarenju služio, njima sam robovao“; Kessler, 1986: 74). Die Illyristen wollten das Nationalbewusstsein stärken und befanden sich vor dem Sprachproblem, weil Sprache Medium, aber auch Identitätsstifter eines Volkes ist. Deshalb war es ihr Bestreben, die Volkssprache durch die Publikation ihrer neuen Rechtschreibung Kratka osnova horvatsko-slavenskoga prapopisanja(Grundzüge der kroatisch-slawischen Rechtschreibung) im Jahre 1830 zu institutionalisieren. Gaj schlug als Amtssprache der Kroaten den kajkavischen Dialekt vor, später entschloss er sich jedoch für die stokavische Varietät. Die illyrischen Ideen verbreiteten sich über Lesesäle und offizielle Amtsblätter wie Novine Horvatzke s književnim prilogom Danicza Horvatzka, Slavonzka y Dalmatinzka, die 1835 zu erscheinen begannen. Gaj initiierte 1842 die Herausgabe des Wörterbuches Nĕmačko-ilirski slovar,den Ivan Mažuranić und Jakov Užarević redigierten. Das Wörterbuch umfasste etwa 40000 Wörter und es war das erste Wörterbuch, mit dem versucht wurde, die neue Wissenschafts- und Bildungssprache umfassend darzustellen (Šidak, 1990: 138). Das Hauptmotiv zur Gestaltung dieses Wörterbuches war der Wunsch, fremde Wörter aus der Volkssprache zu tilgen. Da es aber für eine Großzahl deutscher Wörter kein kroatisches Äquivalent gab, wurden diese übersetzt. Auf diese Weise hinterließ das Deutsche in der kroatischen Sprache in Form von Lehnübersetzungen für immer seine Spuren (Kessler, 1986: 159). Den allgemeinen Durchbruch in alle Sphären des öffentlichen Lebens erreichte die Volkssprache durch die Ernennung des Kroatischen als Amtssprache in Kroatien im Jahre 1847 und daraufhin durch die Reformation des Grundschulwesens im Jahre 1848. Damit brachten die Illyristen ihr Vorhaben zum Ende. 3.6.6 Bachs Absolutismus Der Begründer des Absolutismus, der Innenminister der österreich-ungarischen Monarchie Alexander von Bach, führte auf Beschluss von Franz Joseph eine zentralistische Verwaltung durch, durch die der kroatische und ungarische Sabor ihr Recht zur Bestimmung und Erlassung von Gesetzen verloren. Beamtenpositionen in Kroatien übernahmen Bachs treue Angestellten, die das Volk Bachs Husaren nannte. Sie führten eine Germanisierung durch, gegen die die Kroaten starken Widerstand leisteten. 1854 wurde die deutsche Sprache als Unterrichtssprache in höhere Gymnasialklassen eingeführt. Daraufhin forderten einige Mitglieder des Kroatischen Sabor, Deutsch vollkommen als Unterrichtsfach in kroatischen Schulen einzustellen. Der Sabor lehnte das ab, was die Bedeutung der deutschen Sprache in Wissenschaft und Kultur unterstreicht (Žepić, 2002: 219). Die Maßnahmen von Bachs Absolutismus erregten unter der kroatischen Bevölkerung doch einen Protest, der sich im Boykott deutscher Aufführungen im Theater manifestierte. Aber auch dies hinderte nicht die Dominanz der deutschen Sprache in der oberen Schicht und unter den Intellektuellen. 3.6.7 Zeit zwischen 1860 bis 1914 Obwohl Bachs Absolutismus die Errungenschaften der kroatischen Illyristen zerstören wollte, stärkte die kroatische Sprache immer mehr. Die Dominanz des Deutschen, die in den letzten Jahrzehnten des 18. Jh. begann, wurde bis zum Zerfall der Monarchie immer schwächer. Die Sprecher des Deutschen durchliefen eine allmähliche Assimilation: Deutsche Ausdrücke wurden zu kroatischen, indem sie zuerst als Entlehnungen erschienen, in der Literatursprache als Fremdwörter abgelehnt wurden und während der Ausbildung immer mehr aus der Umgangssprache verschwanden (Kessler, 1986: 76). Trotzdem blieb das Deutsche bis zum Ende der österreichisch-ungarischen Monarchie die Sprache der überregionalen Kommunikation. Es war die Sprache der Politik, der Wirtschaft und der Wissenschaft für die gesamte Öffentlichkeit innerhalb der Monarchie. Wer von der Gesellschaft anerkannt werden wollte, musste Deutsch verstehen (ebd. 72). Die sprachliche Situation um die Jahrhundertwende zeigt sich auch in der Beschreibung der bürgerlichen Schicht vom kroatischen Schriftsteller Miroslav Krleža: U doba kada su po sobama svijetlile hengelampe, a hausfrau ni dala popraviti ausgus ili štenge ili fensterštok na lihthofu, a kod Palancegerov je bi majandaht, a placmuzika Zehcenerska je svirala na Zrinjiplacu ili na Francjozefplacu, a gospon oberlajtnant je kod Jegerhorna bil na gablecu i ni donesel na banhof kofer, a filarke su klafrale…(Krleža, 1903: 370). Diese Mischsprache erhielt sich bei den alteingesessenen Einwohnern Zagrebs bis zum heutigen Tage. 3.6.8 Kroatien nach der österreichisch-ungarischen Herrschaft Nach dem Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie hat Kroatien keinen direkten Sprachkontakt mehr zum deutschsprachigen Raum. Eine Ausnahme bilden die Deutschen in Kroatien, die von 1920 bis 1941 größtenteils im sog. schwäbisch-deutschen Kulturbund vereint waren. Dieser Verein diente vor allem zur Bewahrung und Verbreitung der deutschen Kultur. Nach dem Zerfall des Königreiches Jugoslawien blieb der größte Teil der Volksdeutschen im Unabhängigen Staat Kroatien, der im Einklang mit den Beschlüssen der Wiener Konferenz die Verpflichtung übernahm, die Volksdeutschen in allen Fragen mit den Kroaten auszugleichen und ihnen eine kulturelle und Selbstverwaltungsautonomie zu gewähren. Nach dem Zweiten Weltkrieg verschlechterte sich dieser Status sehr: Die Zahl der Volksdeutschen, die vor dem Krieg ca. eine halbe Million ausmachte, verringerte sich bis zur ersten Volkszählung nach dem Krieg im Jahre 1948 um das Zehnfache. Die meisten deklarierten sich als Kroaten. Seit Beginn der 1950er Jahre kam es zur massenhaften Auswanderung der Angehörigen der deutschen und österreichischen Minderheit in Jugoslawien, weil ihnen alle bürgerlichen und politischen Rechte in Titos Regime genommen wurden (Geiger/Kučera, 1996: 92). Der Status der deutschen Sprache in der Schule war sehr ungünstig. Deutsch wurde als Sprache der Nationalsozialisten und Besetzer betrachtet (Žepić, 1996: 318). Belgrad wollte das Schulwesen im gesamten Land ohne Berücksichtigung der Tradition und Bedürfnisse der einzelnen Republiken vereinen. Wegen der traditionellen Verbindung Serbiens zu Frankreich wurde das Französische zuerst in kroatischen Gymnasien eingeführt und unterdrückte daraufhin die deutsche Sprache mit der Begründung, das Französische sei als romanische Sprache für Gymnasialprogramme angebrachter als das Deutsche. Während des Krieges gab es die Möglichkeit, zwischen dem Deutschen und Italienischen zu wählen. Nach 1945 war Deutsch jedoch die Sprache des Feindes und wurde nicht als Schulfach angeboten. Erst nach dem Bruch Jugoslawiens mit der Sowjetunion wurde das Deutsche wieder zum Schulfach in Kroatien und nahm die zweite Stelle nach dem Englischen ein (Žepić, 2002: 220). Während der sechziger und siebziger Jahre des 20. Jh. kam es zur massenhaften Auswanderung der Kroaten, die im Ausland Arbeit suchten. Der größte Teil ging in die deutschsprachigen Länder. Neben Sprachmischung, die vor allem bei Kindern, die im Ausland geboren wurden oder dort aufgewachsen sind, kam es auch zu Entlehnungen im Kroatischen. So beispielsweise die Wörter gastarbajter, ofental, bauštela, robauu.a. In neuerer Zeit lässt sich auch weiterhin der Einfluss der deutschen Sprache auf das Kroatische feststellen. Die Entwicklung der Technik und Telekommunikation hat alle physischen Hürden bewältigt, so dass heute enge Kontakte auch zu weit entfernten Sprach- und Kulturkreisen über Internet oder andere Medien möglich sind. Seit Jahren besteht die Möglichkeit, deutschsprachige TV-Programme über Satellit in Kroatien zu empfangen. Schließlich kann auch die Einführung des deutschen Fernsehsenders RTL in Kroatien, der viele deutschsprachige Serien und Filme mit kroatischen Untertiteln ausstrahlt, als moderne Fortsetzung der deutsch-kroatischen Sprachkontakte betrachtet werden. Ebenso die freie Marktwirtschaft, die in Kroatien zum Import vieler deutscher und österreichischer Artikel führte, die ihre deutsche Bezeichnung behalten haben und im Kroatischen oft appelativiert wurden, z.B. kinderjaje(dtsch. Kinderei) , milhšnita(dtsch. Milchschnitte), buterštanga(dtsch. Butterstange) u.a. Nicht zu vergessen ist der heute stark entfaltete Tourismus, in dem die deutsch-kroatische Sprachbegegnung in Kroatien heute weitestgehend erfolgt. Zweifellos haben alle diese Kontakte, die noch vor der Ansiedlung der Kroaten in ihr neues Heimatland begannen und kontinuierlich mit unterschiedlicher Intensität bis heute andauerten, eine tiefe Spur in der älteren und neueren Geschichte Kroatiens hinterlassen. In welchem Maße dieser Einfluss im Bereich der Lexik der kroatischen Sprache bemerkbar ist, wird in den folgenden Kapiteln thematisiert. 4 Deutsche Lehnwörter im Kroatischen 4.1 Identifikation deutscher Lehnwörter Es wurde schon in der Einleitung hervorgehoben, dass ein wichtiger Faktor bei der Beschreibung des Einflusses der deutschen Sprache auf die kroatische die Bestimmung der integrierten lexikalischen Einheit in der Nehmersprache als Replik ist. Deshalb wird neben der Identifikation der lexikalischen Einheit in der Nehmersprache auch die Identifikation der zugrundeliegenden lexikalischen Einheit in der Gebersprache, die als Modell diente, vorgenommen. Das bedeutet also, dass sich Modell und Replik gegenseitig bedingen. In vielen Fällen stellt die Identifikation der deutschen Entlehnungen sowie die Identifikation des Modells ein Problem dar. Obwohl bisher die wichtigsten Grundlagen zu den deutsch-kroatischen Sprachkontakten vorliegen, gibt es keine Belege über die sprachliche Kompetenz und den Sprachgebrauch der Sprecher der Gebersprache zum Zeitpunkt des Sprachkontaktes. Somit gründet die Verbindung der Replik mit dem Modell oftmals nur auf einer Annahme. In einigen Fällen hat sich die Replik zudem in ihrer phonologischen Form in dem Maße von der phonologischen Form des Modells entfernt, dass die Rekonstruktion weder mit Hilfe etymologischer noch Dialektwörterbücher möglich ist.1 Deshalb wird nachfolgend, wie in den meisten Beiträgen über den Einfluss des Deutschen auf die kroatische Sprache, für die Großzahl der Wörter von der deutschen Standardvarietät ausgegangen, was aus methodologischen Gründen gerechtfertigt erscheint. Wie aus dem Kapitel über den gesellschaftlich-geschichtlichen Kontext der deutsch-kroatischen Sprachkontakte klar hervorgeht, liegt diesen Kontakten vorwiegend die süddeutsche Varietät bzw. der bairisch-österreichische Dialekt zugrunde. Nach Žepić (1996: 93) ging es bei der deutschen Sprache auf dem kroatischen Gebiet immer um das österreichische Deutsch. Beweis dafür liefert die Analyse der Beschreibungen der Aussprache einzelner Laute in deutschen Grammatiken und Wörterbüchern kroatischer Autoren.2 So wird beispielsweise die Aussprache des Lautes eals avorgeschrieben, äals a, ozwischen ound asowie efür alle e-Diphthonge, was auf die Charakteristika der bairisch-österreichischen Dialekte hinweist. Neben phonologischen Merkmalen der bairisch-österreichischen Dialekte gibt es auch morphologische Merkmale (z.B. die Deminutivbildung mit den Suffixen – l, -el, -erl,die typisch für bairisch-österreichische Dialekte ist), sowie lexikalische Besonderheiten (z.B. die Austriazismen fras, jauzn, sajtlik, deren Modelle Fras, Jause, Seitellauten). Ebenfalls muss bedacht werden, dass für manche Repliken das Modell nicht im heutigen Standarddeutsch zu suchen ist, sondern in älteren Formen wie z.B. für copra(vom mhd. zouberin, heute Zauberin) oder firnajz(vom frühnhd. firnais, heute Firniss). Deshalb werden bei solchen evidenten Entlehnungen zum Modell auch Angaben zur sprachlichen Varietät und der Zeit der Entlehnung gegeben. Gewisse Schwierigkeiten bei der Bestimmung der wahren Herkunft der Entlehnung bereiten auch die etymologischen Angaben in den kroatischen Wörterbüchern, insbesondere, wenn es um die genaue Angabe der Gebersprache bei indirekten Entlehnungen mit verschiedenen lautlichen und wortbildenden Varianten geht. In manchen Wörterbüchern wird bei solchen Wörtern diejenige Sprache als Herkunft angeführt, die zuletzt vermittelte. Ein Beispiel dafür ist das Wort palačinka, neben dem im Wörterbuch von Klaić (1988) die Angabe mađ. (ung.) steht, was nicht ganz korrekt ist, weil dieses Wort in die kroatische Sprache durch Vermittlung der österreichischen Varietät gelangte und das Modell somit Palatschinkelautet. Auch dieses ist eine Entlehnung aus dem ungarischen Wort palacsinta, und dieses wiederum aus dem Rumänischen placintǎ. Das rumänische Wort geht auf die lateinische Form placentazurück (Talanga, 1996: 32). Im Wörterbuch von Anić (2005) wird manchmal die Mittlersprache angegeben, so steht beispielsweise beim Wort huncutals Herkunftssprache Deutsch und Ungarisch. Dieses Verfahren ist jedoch nicht konsequent. So wird, wie im Wörterbuch von Klaić, zum Wort palačinkawieder nur das Ungarische als Gebersprache angeführt. Es kommt sogar vor, dass die Etymologie bei manchen Entlehnungen falsch oder mangelhaft angeführt ist, was die Bestimmung der Gebersprache noch mehr erschwert. So ist beispielsweise im Wörterbuch von Anić (2005) das Wort bajbok, bajbukals Orientalismus gekennzeichnet, obwohl es auf das deutsche Syntagma bei Wachezurückgeht. Šonje (2000) ist ebenfalls inkonsequent, wenn es um etymologische Angaben, insbesondere hinsichtlich der Mittlersprache, geht. Beispielsweise wird zum Stichwort roštiljUngarisch als Herkunftssprache angeführt, obwohl es die Mittlersprache war, während das Deutsche als Gebersprache überhaupt nicht angeführt ist. Andererseits wird beim Stichwort štrajkdas Englische als Herkunftssprache angeführt, obwohl dieses über das Deutsche in die kroatische Sprache gelangte. Beim Wort šalwird als Herkunftssprache das Iranische angeführt, das Englische als Mittlersprache, das Deutsche überhaupt nicht, obwohl es aus dem Deutschen ins Kroatische übernommen wurde. Aus allen diesen Gründen erfolgt die Klassifikation der deutschen Entlehnungen nach ihrer Herkunft aufgrund der Analyse der oben angeführten Wörterbücher sowie für alle Wörter, die das Deutsche aus anderen Sprachen entlehnt hat, aufgrund der Angaben im Deutschen Wörterbuch(1994) von Gerhard Wahrig. Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «ЛитРес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Читать дальше