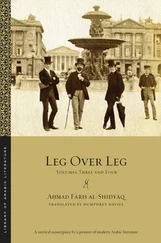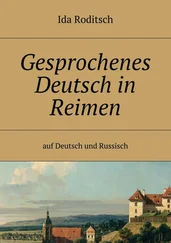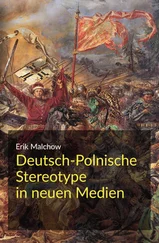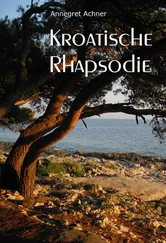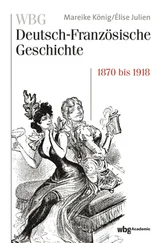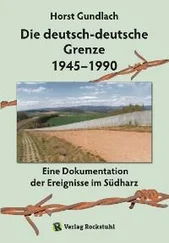In den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts verwenden Sprachwissenschaftler wieder Haugens Terminus borrowingbzw. Entlehnung, womit die unterschiedlichsten Formen von Übernahme des Elementes einer Sprache in eine andere bezeichnet werden. Von den Arbeiten Haugens und Weinreichs ausgehend, führt der kroatische Sprachwissenschaftler Rudolf Filipović die kroatische Terminologie in die Sprachkontaktforschung ein, deren Gegenstand Berührungen und Konflikte zwischen Sprachen, Zwei- und Mehrsprachigkeit, Übersetzungswissenschaft, Erst- und Zweitspracherwerb sowie sprachliche Interferenz und Integration umfasst (vgl. Filipović, 1986: 15). Wichtig dabei ist immer die Rolle, die die Sprachen im Kontakt im Entlehnungsprozess innehaben. Die Ebenen, auf denen die Beschreibung der sprachlichen Interferenzen möglich und notwendig ist, sind die phonologische, morphologische, semantische, lexikalische, syntaktische und stilistische (ebd. 53). Das Innovative an Filipović Theorie ist die Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer sprachlicher Adaption. Im Zuge der primären Adaption wird die Entlehnung dem sprachlichen System der Nehmersprache angepasst, während im Zuge der sekundären Adaption diese assimilierte Entlehnung Veränderungen durchlaufen kann, wie jedes andere native Wort. Die ursprüngliche Form des Wortes in der Gebersprache heißt Modell, die übernommene Form in der Gebersprache Replik (ebd. 38). Die Replik erscheint in drei Formen: 1. in der gleichen Form wie das Modell, es handelt sich um einfache Übernahme aus einer Sprache in die andere; 2. in einer Kompromissform, d.h. die Replik hat sich dem Modell gegenüber aufgrund von Interferenzen auf einer oder mehreren sprachlichen Ebenen verändert; 3. in integrierter Form, so dass die Replik nicht mehr als fremdes Wortgut erkannt wird, weil es im Prozess der Adaption vollkommen an die Nehmersprache angepasst wurde. Im Laufe ihrer Entwicklung ist die Sprachkontaktforschung zu einem weiten, interdisziplinären Forschungsfeld geworden, das sich bei der Untersuchung abstrakter sprachlicher Systeme im Kontakt ebenfalls mit Fragen der Psycho- und Soziolinguistik, Anthropologie, Kulturgeschichte, (Sprach-)politik, Pädagogik, Kommunikations- und Literaturwissenschaften auseinandersetzt (Oksaar, 1984: 853). In neuerer Zeit beschäftigt sich auch die Ökolinguisitk mit diesem sprachlichen Phänomen, mit dem Ziel, Unterschiede zwischen Entlehnungen im gesamten Sprachsystem, Entlehnungen in Dialekten und Entlehnungen in Soziolekten festzustellen (Sočanac, 2004: 31). 2.2 Lehnwortforschung Die Lehnwortforschung ist eines der ältesten Forschungsgebiete der Sprachkontaktforschung, die sich insbesondere mit den Wirkungen des sprachlichen Kontaktes sowohl auf der Ebene des Sprachsystems (Sprachkontakt im engeren Sinne) als auch auf der Ebene der Individuen (Zwei- oder Mehrsprachigkeit) beschäftigt. Das Ziel ist die Identifikation und Analyse der einzelnen Spuren des Sprachkontaktes mithilfe synchronischer Diagnosen (Bechert/Wildgen, 1991: 57). Die Lehnphänomene lassen sich sprachebenenspezifisch gliedern (Tesch, 1978: 83ff) in phonetisch-phonologische, die Phonemimport, Phonemschwund bzw. Phonemzusammenfall verursachen, grammatikalische, die in der Entlehnung der Wortbildungsmorpheme und Flexionssubstitution ihren Ausdruck finden, lexikalisch-semantische, die in der Übernahme bzw. Nachbildung der Lexeme bestehen, syntaktische, wodurch sich Lehnkonstruktionen und Lehnwortstellung im Satz ergeben. Die Übernahme betrifft jedoch vor allem die lexikalische Ebene, weil Wörter wegen ihrer allgemeinen Dynamik am einfachsten zu entlehnen sind. Der lexikalische Einfluss geht insbesondere auf inner- und außersprachliche Gründe zurück. Im Unterschied zu grammatischen und syntaktischen Elementen und Beziehungen innerhalb des Sprachsystems, die primär eine innersprachliche Funktion (z.B. Rektion, Koordination, Wortfolge) ausüben oder eine allgemeine Beziehung zur außersprachlichen Wirklichkeit (Tempora, Deiktika etc.) darstellen, steht bei den lexikalischen Einheiten die denotative Funktion im Vordergrund. Der Sprecher kann lexikalische Einheiten einer anderen Sprache am einfachsten wahrnehmen und lernen, weil diese explizit mit der außersprachlichen Wirklichkeit verbunden sind. Darüber hinaus ist die Lexik innerhalb des Sprachsystems mehr oder weniger offen und deshalb dynamischer bei der gegenseitigen Beeinflussung als das grammatische System. Dies stellt die strukturelle und kognitiv-semantische Grundlage des lexikalischen Einflusses einer Sprache auf eine andere dar. Ein weiterer Grund ist das universale Bedürfnis für die Benennung neuer Entitäten. Die Motive können innersprachlich, z.B. geringe Verwendungshäufigkeit, schädliche Homonymie und der stetige Bedarf an Synonymie sein (vgl. Weinreich, 1977: 80ff). Diese Motive dürfen jedoch nicht als absolute Determinanten betrachtet werden, sondern sind vielmehr als Tendenzen zu verstehen. Die Gefahr ist groß, dass selten benutzte Wörter durch Lehnwörter ersetzt werden. Bei dem Grundwortschatz ist diese Gefährdung durchaus geringer. Homonymie ist ein großer Anreiz für lexikalische Entlehnungen, da die phonetische Übereinstimmung unterschiedlicher Begriffe den Sprecher verwirrt und das anders klingende Lehnwort gute Chancen hat, im weiteren Verlauf das ursprüngliche Wort zu verdrängen. Ein anderer Grund ist der Bedarf an gleichbedeutenden Wörtern, Synonymen. Dies kommt auch vor, wenn der Sprecher das Gefühl hat, dass ein Wort „mehr“ als das native Wort aussagt. Filipović (1986: 26) nennt sprachexterne Gründe für Entlehnung: das Bedürfnis nach Benennung eines übernommenen Produktes (soziologischer Grund) sowie das Bedürfnis des Sprechers nach Verschönerung seines Sprachgebrauchs mit modernen Ausdrücken aus fremden Sprachen (psychologischer Grund). Ein weiterer außersprachlicher Grund besteht in der subjektiven Bewertung einer Sprache, die dazu führt, dass die in der Gesellschaft verwendeten Sprachen unterschiedlichen Prestigewert besitzen. Der Sprecher, der die Sprache mit dem höheren Prestigewert benutzt, strebt einen höheren sozialen Status an und möchte damit seine Fremdsprachenkenntnis demonstrieren (vgl. Weinreich, 1977: 83). Somit können in Anlehnung an Bechert und Wildgen (1991: 77) drei grundlegende Motive für die lexikalische Entlehnung angeführt werden: 1. sprachliche Bedarfsdeckung beim Kulturtransfer (Kulturwörter); 2. Modeerscheinungen (Modewörter) und 3. Sprachwechsel. 2.3 Resultate lexikalischer Entlehnung Der Terminus Entlehnung gilt als Oberbegriff für alle Arten der Übernahme sprachlicher Phänomene aus einer Sprache in die andere und wird meistens im weiteren Sinne benutzt, d.h. er bezieht sich nicht nur auf das Ergebnis, sondern auch auf den Vorgang dieser Übernahme. Nach Weinreich (1976: 69) regulieren diesen Vorgang zwei grundlegende Mechanismen: 1. Einheiten der Sprache A werden in die Sprache B übernommen; 2. Morpheme der Sprache B werden anstelle ihrer gleichbedeutenden Morpheme der Sprache A benutzt. Diese Mechanismen sind bei jedem Entlehnungsvorgang präsent, allerdings werden die Resultate in der Sprachwissenschaft unterschiedlich benannt. Dabei spielen die Wortbedeutung und die Wortform bzw. die Inhalts- und Ausdrucksseite als zwei Komponenten jedes Wortes bei allen Definitionsversuchen die ausschlaggebende Rolle. Der Hauptunterschied birgt sich in der Frage, ob die äußere Form des Wortes zusammen mit seiner Bedeutung oder nur die Bedeutung übernommen wird. Betz (1949: 27f) versucht als einer der ersten die Resultate der lexikalischen Entlehnung zu klassifizieren und führt dabei neue Fachbegriffe ein. So unterscheidet er zwischen dem ‘äußeren Lehngut’ – Lehnwort (Übernahme der Wortform und der Wortbedeutung – Morphemimport) und dem ‘inneren Lehngut’ – Lehnprägung (Übernahme nur der Wortbedeutung – Morphemsubstitution). Das Lehnwortteilt er weiter in Fremdwortund assimiliertes Lehnwort, die Lehnprägungin Lehnbildung(Neologismus) und Lehnbedeutung(semantische Entlehnung).
Читать дальше