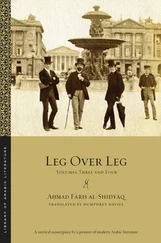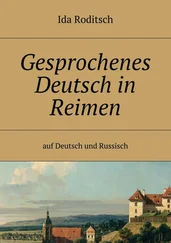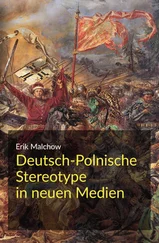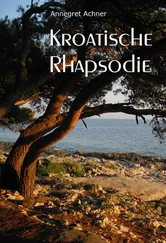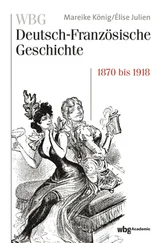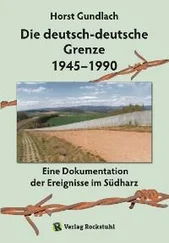Am Ende des Bandes erfolgen das Schlusswort und das Quellenverzeichnis.
An dieser Stelle danken wir den Gutachterinnen Prof. Dr. Nada Ivanetić (Universität Rijeka) und Prof. Dr. Jadranka Gvozdanović (Universität Heidelberg) herzlich für ihre konstruktiven Hinweise, mit denen sie maßgeblich zur Qualität dieses Bandes beigetragen haben. Ein großer Dank gilt auch unseren Familien für ihre Unterstützung. Ihnen ist diese Monographie gewidmet.
2 Terminologische Vorüberlegungen In der Sprachkontaktforschung findet man eine Vielzahl verschiedener Definitionen bzw. Interpretationen der verwendeten Terminologie bzw. Erweiterungen, Ergänzungen oder Umdeutungen des bereits existierenden terminologischen Apparates. Deshalb werden nachfolgend zuerst die Entwicklung der linguistischen Teildisziplin, die sich mit Sprachen in Kontakt beschäftigt, sowie wichtige Begriffe, die sie verwendet und die Gegenstand dieser Arbeit sind, erklärt. Am Ende des Kapitels erfolgt die Bestimmung der zugrundeliegenden Begriffe. 2.1 Sprachkontaktforschung Die Erforschung von Sprachkontakten setzt relativ spät ein, obwohl die gegenseitige Beeinflussung von Sprachen schon in der Antike von Philosophen wie Platon, Quintilian und Priscian thematisiert wurde. Sie schenkten diesen Phänomenen jedoch keine besondere Bedeutung. Wissenschaftliches Interesse an Zwei- oder Mehrsprachigkeit und deren Auswirkungen ist erst im 19. Jahrhundert zu vermerken (Oksaar, 1996b/12: 1). Diese Disziplin wurde im Laufe ihrer Entwicklung mit unterschiedlichen Namen versehen. Zunächst gebrauchte man die Bezeichnungen linguistische oder sprachliche Entlehnungen. In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts ist seit der Veröffentlichung der klassischen Monographie von Uriel Weinreich, Languages in Contact(1953), der Terminus Sprachkontakt in Gebrauch. In neuerer Zeit wird jedoch für den Zweig, der sich mit den Sprachkontakten befasst, immer mehr der Ausdruck Kontaktlinguistik verwendet. Sprach- und Kulturkontakte entwickelten sich vor allem mittels der Wissenschaft. Bis zum Mittelalter benutzte man auf dem Gebiet des heutigen Europa am meisten das Griechische als Wissenschaftssprache. Danach übernahm diese Rolle das Lateinische, das mit der Zeit seine Anwendung ausweitete: Es wurde zur Sprache der Gebildeten, zur Quelle der Fachterminologie sowie zur Grundlage einiger Fachsprachen, so der Rechts-, Wirtschafts- und Kirchensprache. Mehrsprachigkeit war im damaligen Europa eine alltägliche Erscheinung. Daher wurden Mehrsprachigkeit und Sprachkontakt durch die Jahrhunderte von unterschiedlichen Aspekten betrachtet, jedoch vom wissenschaftlichen Interesse erst in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts unter dem Einfluss der historischen und vergleichenden Linguistik. Es kommt zur intensiven Erforschung der Entwicklung der unterschiedlichen Sprachfamilien. Im Mittelpunkt stehen folgende Fragestellungen: Welches sind die Sprachwurzeln, welche Unterschiede bestehen zwischen den Sprachen, was sind die Gründe für den Sprachwandel? Einige Antworten darauf gaben einige Phänomene der Kontaktlinguistik, wie z.B. die Substrat-Theorie und die sprachliche Entlehnung. Schon damals stellte sich die uneinheitliche Terminologie in der Sprachkontaktforschung als offensichtliche Schwierigkeit heraus. Die Einflüsse der Sprachkontakte wurden in der Kontaktlinguistik unterschiedlich benannt. Die traditionelle Linguistik gebraucht die Begriffe Sprachmischung und Mischsprache. Die Linguisten des 19. Jahrhunderts vertreten diesem Phänomen gegenüber unterschiedliche Meinungen. Die Möglichkeit, dass Mischsprachen existieren, bestreiten vor allem Philosophen (Rasmus Rask, August Schleicher und Max Müller). Ihrer Meinung nach gibt es keine gemischten Sprachen, weil Sprachkontakte nur die Lexik beeinflussen, während die Struktur selbst äußeren Einflüssen nicht ausgesetzt ist (Filipović, 1986: 19). Die bedeutendsten Vertreter der Theorie von Mischsprachen waren der Keltologe Ernst Windisch und der Österreicher Hugo Schuchardt, der glaubte, dass es keine Sprache gäbe, die nicht gemischt sei. Ernst Windisch (1897: 118) versteht unter dem Begriff Mischsprache eine Sprache, in der 1. fremde Wörter auf Kosten der nativen gebraucht werden, 2. zur Bezeichnung der Sache vollständig ausreichende native Wörter durch fremde ersetzt werden, 3. es viele Lehnwörter gibt, 4. Lehnwörter in einfachen Ausdrücken und Sätzen gebraucht werden, 5. nicht nur Substantive, sondern auch Verben und sogar Zahlwörter und morphologische Formen sowie andere zum Organismus des Satzes gehörigen Formen fremden Ursprungs sind. Für H. Schuchardt gründet Sprachmischung auf Zweisprachigkeit, beziehungsweise Sprachmischung ist eine Form der unvollständigen Zweisprachigkeit, die immer auch auf die Sprachentwicklung einwirkt (1884). Schuchardt beschäftigte sich mit der Erforschung des Sprachkontaktes der slawischen, romanischen und germanischen Völker in der Habsburger Monarchie und untersuchte die phonologische und lexikalische Interferenz sowie den Einfluss der sog. „inneren Form“ auf die Sprachentwicklung, für die zehn Jahre darauf Duvau den Ausdruck calque(Lehnübersetzung) einführte. Nach den Vorstellungen von Herrmann Paul beginnt die Sprachmischung schon auf der Ebene der Individualsprachen. Sie entsteht eigentlich in dem Augenblick, in dem sich zwei Personen miteinander unterhalten, wodurch sie die Sprache, deren Syntax, Morphologie, Phonetik und deren Wortschatz im gegenseitigen Austausch auf der Ebene der Idiolekte prägen. Seiner Meinung nach ist die Sprachmischung im Grunde ein genuiner Bestandteil der Sprache. Pauls Meinung nach spielt bei der Sprachmischung die Zwei- oder Mehrsprachigkeit eine wichtige Rolle (Filipovič, 1986: 19). Die Linguisten des 20. Jahrhunderts verwerfen hauptsächlich den Begriff der Mischsprachen. Für Antoine Meillet (1936: 83) wie auch für viele andere Sprachwissenschaftler ist dieser Begriff nicht angebracht, weil man Elemente aus einer anderen Sprache übernehmen kann, ohne dass es gleich auch zur Sprachmischung kommt. Die Entlehnung betrifft vor allem die Lexik, während Phoneme und grammatische Strukturen nur im Ausnahmefall entlehnt werden. Deshalb kann man auch nicht davon sprechen, dass sich zwei Sprachsysteme vermischen. Edward Sapir gebraucht den Terminus Wortentlehnung und versteht darunter die einfachste Art von Einfluss einer Sprache auf die andere. Die Entlehnung ganzer Wörter erfolgt meist nicht nur auf der rein sprachlichen Ebene, sondern steht vielfach im Zusammenhang mit einem Kulturtransfer. Neue, unbekannte Güter werden übernommen und damit oft auch die Bezeichnungen dafür (1972: 174). Der amerikanische Sprachwissenschaftler Bloomfield versteht unter Entlehnung drei Typen sprachlicher Veränderungen: Entlehnungen kultureller Begriffe, Entlehnungen aufgrund eines unmittelbaren Sprachkontakts, der durch territoriale oder politische Nähe zustande kommt (intime Entlehnung) und dialektale Entlehnungen, die aus Dialekten in die Hochsprache gelangen (1933: 444ff). Nach Jan Baudouin de Courtenay gibt es keine reine, ungemischte Sprache. Vielmehr ist jede Sprache das Resultat von Sprachmischung. Dabei kann die Mischung auf zwei Ebenen erfolgen: geographisch-territorial und chronologisch. Letzteres liegt bei der gegenseitigen Beeinflussung einer alten religiösen bzw. rituellen Sprache und einer modernen vor, ersteres ist die Voraussetzung für jede auf natürlichem Wege verlaufende Mischung. Der Einfluss der Sprachmischung bewirkt zweierlei: 1. in eine Sprache werden (lexikalische, syntaktische, phonetische) Elemente einer anderen Sprache übernommen und 2. die Unterschiede zu anderen Sprachen werden geringer (1963: 94ff). Primäre Voraussetzung für die Übernahme fremden Wortgutes in eine Sprache ist der sprachliche Kontakt. Weinreich vertritt die Auffassung, dass zwei Sprachen in Kontakt stehen, wenn sie von ein und derselben Person abwechselnd verwendet werden (vgl.
Читать дальше