Die Kämpfe um die Nachfolge Nadir Schahs und die fortschreitende Schwäche der Mogulherrschaft in Indien ließen in Afghanistan ein politisches Vakuum entstehen. Damit war Raum für eine eigenständige Staatsgründung zwischen Iran, dem indischen Subkontinent und dem Kaleidoskop staatlicher Gebilde in Zentralasien entstanden. Noch im Jahr 1747 wählte die herkömmliche Versammlung paschtunischer Stämme, loya jirga (dschirga), bei Kandahar Ahmad Khan (geb. 1722) zum ersten »König der Afghanen«. Er entstammte dem Zweig der Sado innerhalb der Stammeskonföderation der Abdali. Unter Nadir Schah hatte er dessen Leibgarde befehligt und sich als Feldherr einen Namen gemacht. Seinen Beinamen, durr-e daran (»Perle der Ländereien«), den er während dieser jirga erhalten haben soll, soll er eigenmächtig in den Titel durr-e durran (»Perle unter Perlen«) umgewandelt haben. Damit habe er seine bescheidene Stellung als primus inter pares zum Ausdruck bringen wollen. Aus dieser Selbstbezeichnung sollte sich künftig der Name der ganzen Stammesföderation der Abdali ableiten: Durrani. Die loya jirga von 1747 gilt in der nationalafghanischen Geschichtsschreibung als der Beginn des afghanischen Staates. Andere Quellen freilich wissen nichts von einer loya jirga, sondern beschreiben die Machtübernahme Ahmad Khans als Ergebnis kühner Machtpolitik.
Ahmad Schah Durranis Herrschaft ist durch eine endlose Folge von Kämpfen und Kriegen gekennzeichnet. Als er 1772 starb, erstreckte sich »afghanisches« Territorium nahezu auf das gesamte Gebiet zwischen dem Amu-Darya und dem Indischen Ozean sowie zwischen Delhi und Nischapur. Er hatte keine verbindliche Regelung seiner Nachfolge getroffen, so dass unter seinen Söhnen ein Kampf um die Nachfolge entbrannte. Auch hinterließ er kein gefestigtes, zentral regiertes Staatswesen; sein »Reich« entsprach einem lockeren Herrschaftsverbund paschtunischer und nicht-paschtunischer Stämme, die er nur indirekt beherrschte. Timur Schah (1748–1793), einer seiner Söhne und sein Nachfolger, konnte das Reich nur notdürftig zusammenhalten. Er verlegte die Hauptstadt nach Kabul. An der Wende zum 19. Jahrhundert bestiegen gleich mehrere Herrscher wiederholt den Thron. Das Durrani-Reich zerfiel in einzelne Machtzentren wie Herat, Kandahar und Peschawar, die Kabul herausforderten.
1823 war die Herrschaft der Sadozai erloschen. An ihrer Stelle etablierte sich eine andere Linie der Durrani-Föderation: die Mohammedzai. Dost Mohammed (geb. 1793), der 1826 Kabul und die angrenzenden Gebiete eroberte, wurde ihr erster Herrscher. Es gelang ihm, die staatliche Gewalt wieder zu stabilisieren; 1834 erhielt er in Kabul den Titel Emir. Dann zogen dunkle Wolken in Gestalt des sich verschärfenden britisch-russischen Gegensatzes über dem Land auf. Davon wird weiter unten zu sprechen sein. Nach dem Scheitern der ersten Invasion der Briten (1839–1842,  S. 71) übernahm Dost Mohammed 1843 abermals die Herrschaft. In zahlreichen Feldzügen unterwarf er sich Teile »Afghanistans«, die zum Teil seit dem Ende der Sadozai ein politisches Eigenleben geführt hatten. Bei seinem Tode im Jahre 1863 hatte er das Land wiedervereinigt. Erst nach einem Jahrhundert, das über weite Strecken durch äußere Einmischung und innere Machtkämpfe gekennzeichnet sein sollte, wurde der Herrschaft der Durrani 1973 ein Ende bereitet.
S. 71) übernahm Dost Mohammed 1843 abermals die Herrschaft. In zahlreichen Feldzügen unterwarf er sich Teile »Afghanistans«, die zum Teil seit dem Ende der Sadozai ein politisches Eigenleben geführt hatten. Bei seinem Tode im Jahre 1863 hatte er das Land wiedervereinigt. Erst nach einem Jahrhundert, das über weite Strecken durch äußere Einmischung und innere Machtkämpfe gekennzeichnet sein sollte, wurde der Herrschaft der Durrani 1973 ein Ende bereitet.
1.4 Russlands Eintritt in den Vorderen Orient
Der nordwestliche Rand des Nahen Ostens wird durch den Gebirgszug des Kaukasus markiert. Durch die Geschichte hindurch ist er Schauplatz machtpolitischen Ringens unter den großen Mächten im Vorderen Orient gewesen. Um die Zeitenwende kämpften Römer und Perser dort um die Vorherrschaft. Im 7. Jahrhundert brachten arabische Heere den Islam in einen Raum, in dem sich früh unterschiedliche Ausformungen des Christentums ausgebreitet hatten. Seit dem 11. Jahrhundert begannen seldschukische Türken in die Region einzudringen. Neben Georgiern und Armeniern wurden sie eine – bis in die Gegenwart präsente – dritte die Geschichte des südlichen Kaukasus bestimmende Ethnie. Seit dem 16. Jahrhundert rivalisierten das Osmanische und das Safawidische Reich um die Kontrolle der gebirgigen Region, die zugleich eine Brücke zwischen dem Vorderen Orient und Zentralasien darstellt. Neben dem georgischen Königreich war die politische Landschaft durch zahlreiche meist von muslimischen Kleinfürsten beherrschte »Khanate« gekennzeichnet.
Ende des 18. Jahrhunderts betrat mit Russland eine neue Großmacht die machtpolitische Bühne. Der Friede von Küςük Kaynarca (1774), der den fünften osmanisch-russischen Krieg beendete, hatte die Voraussetzung für die Annektierung der Krim und die Ausweitung der russischen Herrschaft über die nördliche Küste des Schwarzen Meeres unter Katharina II. (reg. 1762–1796) geschaffen. Damit aber war zugleich das Tor zum Kaukasus geöffnet worden. Zwar sollte dieser Raum – namentlich der südliche Kaukasus mit den heutigen Staaten Georgien, Armenien und Aserbaidschan – als solcher mit Blick auf das politische Geschehen im Nahen Osten kaum eine signifikante Rolle spielen, aber mit dem Vordringen Russlands dort wurde er ein Schauplatz, auf dem und über den die zaristische Macht ihren Anspruch anmeldete, ein Mitspieler im Nahen und Mittleren Osten zu sein. Früher als andere europäische Mächte, insbesondere England, Frankreich oder Habsburg, hat Russland, ausgehend von seinen Eroberungen im südlichen Kaukasus, territoriale Ansprüche auf Gebiete des Osmanischen Reichs und Persiens erhoben und durchgesetzt. Und auch unter dem Aspekt der geistig-kulturellen Entwicklung sollte der schrittweise vollzogenen Vereinnahmung der kaukasischen Region durch Russland eine Bedeutung für den angrenzenden Vorderen Orient zukommen: Von den Muslimen im Zarenreich – in Zentralasien und im Kaukasus, namentlich an der Wolga und im multiethnischen und multikulturellen Tiflis (Tbilisi) und Baku – sind Impulse der Modernisierung auf die nahöstliche Nachbarschaft im Osmanischen Reich und in Persien übergesprungen.
Mit der Gründung der Sowjetunion zu Beginn der 1920er Jahre war Moskau mit den Entwicklungen und Problemen im Inneren des sozialistischen Riesenreichs weitgehend absorbiert und seit 1941 auf den Krieg gegen Nazideutschland ausgerichtet. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aber begann die Kremlführung, wieder expansionistisch zu denken: Mit Blick auf den Nahen Osten war das gegenüber der Türkei, Iran und in den achtziger Jahren gegenüber Afghanistan der Fall. Die Politik des russischen Präsidenten Vladimir Putin (Beginn seiner ersten Präsidentschaft: 2000) in der Krise um Syrien nach 2011 kann man als Reflex der langen Tradition Russlands als Nahostmacht verstehen. Die Tatsache schließlich, dass die ideologischen Wurzeln nicht weniger Aktivisten der zionistischen Bewegung in linksrevolutionären Vereinigungen im Zarenreich des ausgehenden 19. bzw. frühen 20. Jahrhunderts lagen (dazu gehörten auch Teile Polens und Litauen), hat in Moskau zunächst Erwartungen genährt, den jungen Staat Israel in sowjetische Interessen im Nahen Osten einbinden zu können.
Im Rückblick muss wenigstens beiläufig an die Herrschaft der mongolischen Goldenen Horde seit 1237 erinnert werden, deren Territorium mit der Hauptstadt Sarai an der unteren Wolga große Teile der südrussischen Steppe umfasste, deren Bevölkerung, namentlich der türkisch-tatarische Teil, sich zur islamischen Religion bekannte. Das Khanat, dem auch das Großfürstentum Moskau tributpflichtig war, hatte fast zweieinhalb Jahrhunderte Bestand. Im Verlauf des 15. Jahrhunderts spalteten sich die Khanate Kazan (1438), Krim (1441) und Astrachan (1485) von der Goldenen Horde ab. Diese selbst fand erst 1502 ihr definitives Ende. Die Eroberung von Kazan an der mittleren Wolga 1552 durch Ivan IV. (»der Schreckliche«, rus. grozny, 1530–1584) besiegelte die Unterwerfung des Khanats der Tataren unter die Herrschaft des Moskauer Reichs.
Читать дальше
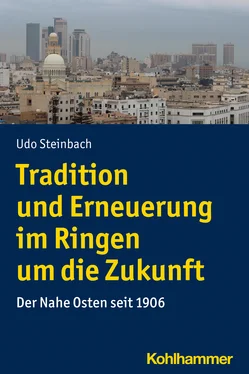
 S. 71) übernahm Dost Mohammed 1843 abermals die Herrschaft. In zahlreichen Feldzügen unterwarf er sich Teile »Afghanistans«, die zum Teil seit dem Ende der Sadozai ein politisches Eigenleben geführt hatten. Bei seinem Tode im Jahre 1863 hatte er das Land wiedervereinigt. Erst nach einem Jahrhundert, das über weite Strecken durch äußere Einmischung und innere Machtkämpfe gekennzeichnet sein sollte, wurde der Herrschaft der Durrani 1973 ein Ende bereitet.
S. 71) übernahm Dost Mohammed 1843 abermals die Herrschaft. In zahlreichen Feldzügen unterwarf er sich Teile »Afghanistans«, die zum Teil seit dem Ende der Sadozai ein politisches Eigenleben geführt hatten. Bei seinem Tode im Jahre 1863 hatte er das Land wiedervereinigt. Erst nach einem Jahrhundert, das über weite Strecken durch äußere Einmischung und innere Machtkämpfe gekennzeichnet sein sollte, wurde der Herrschaft der Durrani 1973 ein Ende bereitet.










