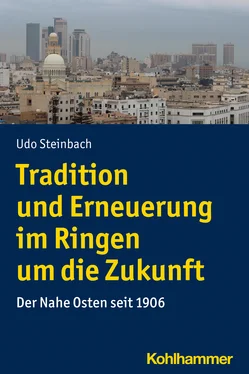Der rote Faden der Darstellung ist die Frage nach den geschichtlichen Zusammenhängen und Abläufen, die in die komplexe Konfliktlage der Gegenwart mündeten. In immer dichterem Rhythmus und mit wachsender Zerstörungskraft treiben die Ereignisse seit den zeitgleichen Revolutionen in Teheran und Kabul (1978/79) den Vorderen Orient in den show down, der von der Ausrufung des »Islamischen Kalifats« (2014) markiert wird. Externe Interventionen in Afghanistan, im Irak, in Jemen, Syrien und Libyen verschärfen interne Konfliktkonstellationen.
Diese neueren Entwicklungen aber sind als Fortsetzung und Ergebnisse revolutionärer Umbrüche zu verstehen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihren Anfang nahmen. Das gilt für die Verfassungsrevolution in Iran (1906), das Vorspiel zu der Revolution, die siebzig Jahre später in der Errichtung einer »Islamischen Republik« mündete. Es gilt aber auch für die Revolution der »Jungtürken«, in der es ebenfalls um die (Wieder-)Einführung einer Verfassung ging. Sie konnte aber den Niedergang des Osmanischen Reichs nicht aufhalten, dessen Ende dann das Tor zu einer weitreichenden Neuordnung des Vorderen Orients öffnete. Diese freilich entsprach nur zum Teil den Vorstellungen und Wünschen der Völker, weshalb sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs neue Eliten gegen sie auflehnten und nach Lösungen suchten, die im Einklang mit dem Willen und dem Selbstverständnis der Völker stehen würden.
1 Das 18. Jahrhundert – Vorabend der Neuzeit
Für den Nahen und Mittleren Osten bedeutet das 18. Jahrhundert einen Zeitraum des Übergangs. In ihm werden die Weichen für seinen Eintritt in die Neuzeit gestellt. Die beiden Mächte, die über Jahrhunderte die Geschichte geprägt haben, haben längst an Vitalität verloren. Das Safawidenreich erlischt 1722. Auf seinem Boden schaffen lokale »Condottieri« Staatswesen, die ihre Gründer kaum überleben. Erst gegen Ende des Jahrhunderts entsteht mit der Dynastie der Qadscharen ein dauerhafter und relativ stabiler iranischer Staat. Das Osmanische Reich ist mit der gescheiterten zweiten Belagerung von Wien (1683) in eine Epoche fortschreitender äußerer und innerer Schwäche eingetreten. Es verliert zunehmend an machtpolitischem Gewicht. Mit der »orientalischen Frage« verbindet sich der Ausgang des Ringens der europäischen Mächte um die Aufteilung des Erbes des Reichs. Unter den Vorzeichen dieses Ringens ist der Gang der Geschichte seit dem Ende des Jahrhunderts verlaufen.
Neben der politischen Macht ist zugleich die wissenschaftlich-technologische und wirtschaftliche Überlegenheit unabweisbar, welche die Grundlage der europäischen Expansion werden sollte. Damit ist für die islamisch geprägten Völker die Frage aufgeworfen, was die Gründe für die Unterlegenheit sind. Neben der Herausforderung zu politischer Selbstbehauptung stellt sich die Herausforderung der geistigen Modernisierung. Für die Menschen im Raum zwischen Marokko und dem Hindukusch beginnt die Suche nach einer Identität, in der die Tradition, und d. h. wesentlich die islamische Religion, und europäische geprägte Normen und Institutionen koexistieren. Diese Frage nach der Identität sollte über zwei Jahrhunderte unterschiedlich beantwortet werden und ist selbst in der Gegenwart noch die Wurzel für nicht nur geistig-kulturelle, sondern auch für politische Konflikte.
Mit der Schwäche der politischen Ordnungen im Vorderen Orient und Nordafrika gehen der machtpolitische und wirtschaftliche Aufstieg europäischer Mächte in der Region und deren immer nachhaltigere Einflussnahme auf die Mächtekonstellation im Nahen Osten einher. Am Ende des Jahrhunderts lässt die napoleonische Expansion nach Ägypten (1798) die politische, militärische und wirtschaftliche Überlegenheit der europäischen Mächte über das Osmanische Reich erkennen. Zugleich beginnen sich Frankreich, England und Russland immer stärker in die Innen- und Außenpolitik Persiens einzumischen. Mit dem Friedensschluss von Küςük Kaynarca 1774 und der Festigung seiner Machtstellung im südlichen Kaukasus ist auch Russland zu einer Nahostmacht geworden.
1.1 Der lange Niedergang der Osmanen
Im September 1683 musste der osmanische Feldherr Kara Mustafa Pascha die Belagerung Wiens abbrechen. Noch einmal hatte sich Konstantinopel angeschickt, seine Machtposition auf dem Balkan zu konsolidieren und auszuweiten. Am 13. Juli begann die Belagerung von Wien. In der Schlacht am Kahlenberg am 11. September versetzte eine Allianz europäischer Armeen den osmanischen Belagerern eine vernichtende Niederlage. Das war der Beginn einer Kette von Rückschlägen; und gegen Ende des 18. Jahrhunderts war unübersehbar, dass die osmanischen Heere ihre Überlegenheit und das Osmanische Reich seinen Schrecken verloren hatten.
Die gescheiterte Belagerung brachte einige grundlegende Tatbestände auf den Punkt, die die Stärke des Reichs strukturell unterminiert hatten. Mit dem Tod Sultan Süleymans »des Prächtigen« (1520–1566) hatte es den Zenit seiner politischen Machtentfaltung, wirtschaftlichen Stärke und kulturellen Schöpferkraft erreicht. Ein innerer Niedergang setzte ein, auch wenn dieser freilich im 17. Jahrhundert wiederholt von politischer Erholung unterbrochen war. Mit den Entdeckungen der Seewege zu den östlichen Teilen der Erde durch europäische Seefahrer seit dem Ende des 15. Jahrhunderts hatten sich die Handelsströme zu verändern begonnen. Die klassischen Handelsrouten zwischen Europa und dem Mittelmeer im Westen und Asien im Osten verloren an Bedeutung. Die Schwächung der ökonomischen Grundlage hatte die Schwächung der Zentralgewalt und mithin die Stärkung zentrifugaler Kräfte im Reich zur Folge. Die Verstrickung der Prinzen und Sultane in die Intrigen des Hofes und des Harems bedeutete einen Verlust an Führungsstärke, der nur epochenweise durch kraftvolle Persönlichkeiten unter den Großwesiren aufgewogen werden konnte. Zunehmend gerieten die Sultane auch unter den Einfluss der Janitscharen, einer Truppe, die zeitweise zur Soldateska degenerierte, die kaum noch von der politischen oder militärischen Führung kontrolliert werden konnte.
Der Niedergang des Osmanischen Reichs im Verlauf des 18. Jahrhunderts war ebenso wenig ein linearer Prozess wie die Gestaltung seiner Beziehungen zu Europa. Gelegentliche militärische Siege und innere Reformen schienen den Bestand des Reichs zeitweilig zu konsolidieren. Auch werden die Beziehungen zu den europäischen Mächten keineswegs durch politische und militärische Konflikte hinreichend beschrieben. Denn in Europa eröffnete das Schwinden der »türkischen« Bedrohung neue Perspektiven auf die osmanische und islamische Kultur. Wenige Jahre nach der gescheiterten Belagerung von Wien eroberten die Erzählungen von 1001 Nacht Europa im Sturm; 1704 erschien in Frankreich die erste Übersetzung in eine europäische Sprache. Denker und Dichter des 18. Jahrhunderts brachten ihre Kritik an den politischen und gesellschaftlichen Zuständen in Europa im Gegenbild »orientalischer« Zustände zum Ausdruck. In der berühmten Ringparabel in Lessings Drama »Nathan der Weise« schließlich werden Judentum, Christentum und Islam als gleichwertig beschrieben. Und in seinem »West-Östlichen Diwan« flüchtet sich der Dichter Goethe in den »reinen Osten, Patriarchenluft zu kosten«.
Auf der osmanischen Seite öffneten sich Hofkultur und Architektur europäischen Einflüssen. Die »Tulpenzeit« (lale devri) unter Ahmed III. (1703–1730) war gekennzeichnet durch einen kultiviert-verschwenderischen Lebensstil. Man vertrieb sich die Tage mit Schach und Muschelspiel, ergötzte sich an Poesie und Musik. Zu den Glanzleistungen höfischer Selbstdarstellung zählte die Gartenbaukunst. Neue farbenprächtige Tulpenarten wurden gezüchtet. Wie auch im zeitgenössischen Europa wurden für Tulpenzwiebeln teilweise kleine Vermögen ausgegeben. Auch in die Architektur drangen europäische Stilelemente ein. Nach dem Muster von Versailles wurden märchenhafte Paläste und Gärten angelegt. Moscheen wurden durch europäisch-barocke Stilelemente geschmückt. 1727 wurde durch den ungarischen Renegaten Ibrahim Müteferrika offiziell der Buchdruck eingeführt. Die zahlreichen in der Folgezeit gedruckten Werke trugen nicht unwesentlich zu einem neuerlichen kulturellen Aufblühen des politisch niedergehenden Reichs bei. Aber diese lichten Momente im Prozess des Niedergangs konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kreativität und Originalität der osmanisch-islamischen Kultur der Vergangenheit angehörten.
Читать дальше