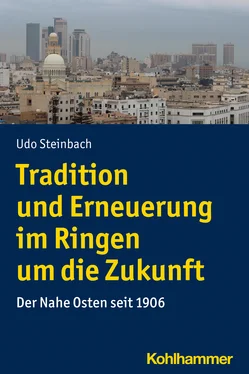Den Vorderen Orient betreffend verliefen die Entwicklungen weniger eruptiv und dramatisch; sie zeigten aber auch dort schwere, bis in die Gegenwart nachwirkende Folgen. In indirekter oder direkter Herrschaft spannten europäische Mächte, geleitet von imperialistischen und kolonialistischen Zielen, einen Herrschaftsschirm über der Region zwischen Nordafrika und dem indischen Subkontinent auf. Unter ihm bestand zwar relative Stabilität. Aber die Auseinandersetzung mit dem europäischen Imperialismus band die politischen Energien der Eliten und verhinderte somit – von Ausnahmen abgesehen – politische und gesellschaftliche Erneuerung und wirtschaftliche Entwicklung, welche eigenständige und stabile neue Ordnungen hätten begründen können. Als der Wandel nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs an Dynamik gewann, war er von gewalthaften Brüchen und Konflikten im Inneren der jungen Staaten wie im regionalen Zusammenhang gekennzeichnet. Die Auseinandersetzung mit dem Staat Israel, der 1948 ins Leben trat, sollte über Jahrzehnte für das politische Handeln insbesondere der arabischen Staatsführungen wesentlich bestimmend werden. Zugleich sahen sich die neuen Eliten, die mit der Erringung der Unabhängigkeit die Voraussetzung für eine umfassende Modernisierung ihrer politischen Institutionen und gesellschaftlichen Ordnungen zu schaffen suchten, erneut in eine globale Machtkonstellation verstrickt, die einer Entfaltung der politischen und wirtschaftlichen Potentiale und Eigenheiten entgegenstand, welche den Interessen und Ordnungsvorstellungen der neuen Regimes in Übereinstimmung mit dem Willen ihrer Völker entsprochen hätte. Die Reformdynamik kam an ihr Ende und machte einer lähmenden und stagnierenden Machtausübung Platz: Die Regimes begannen, sich auf klientelistische Netzwerke zu stützen; Herrschaft war auf den Erhalt ihrer Macht und auf die Verteilung der mit ihr verbundenen Profite ausgerichtet. Die Mitbestimmung der Bürger wurde zur Gefährdung des Machterhalts. Deren Wohlfahrt lag außerhalb des Ziels und Zwecks von Herrschaft.
Hinter der Tatsache von Stagnation und Fremdbestimmung begannen sich Kräfte zu formieren, die ihre Gesellschaften auf eine neue Grundlage zu stellen suchten. Sie schöpften ihren Anspruch auf Authentizität aus der islamischen Religion und der ihr innewohnenden Veränderungsdynamik. Im schiitisch geprägten Iran wurde Anfang 1979 das überkommene System der Monarchie gestürzt. Zeitgleiche Bestrebungen im Raum des sunnitisch geprägten Nordafrika und Nahen Ostens führten zu keinen nachhaltigen, stabilen Ergebnissen. In wachsendem Maße breitete sich diffuse Gewalt aus. Sie fand in den Terrorattentaten von New York und Washington am 11. September 2001 einen ersten Höhepunkt. Der fehlgeleitete Versuch der USA im Frühjahr 2003, durch eine militärische Intervention im Irak die Einrichtung demokratischer Institutionen zu erzwingen und damit die Voraussetzung für politische Stabilität zu schaffen, bedeutete schließlich das Fanal für die flächendeckende Ausbreitung vornehmlich religiös begründeter Gewalt im Nahen Osten und in Nordafrika, ja global und mit Ausläufern nach Europa.
Die Selbstverbrennung eines jungen Mannes im wirtschaftlich armen Herzen Tunesiens am 17. Dezember 2010 setzte weite Teile der arabischen Welt in Flammen. Die sich dramatisch ausbreitende Protestwelle von Millionen von Menschen im gesamten arabischen Raum vollzog sich im Zeichen des Rufs nach Respekt vor der Würde der Bürger seitens der Regierenden. Dieses Ideal war keiner spezifischen Weltanschauung, Ideologie oder Religion geschuldet. Im Mittelpunkt der Forderungen standen die Ausarbeitung von Verfassungen und die Durchführung von Wahlen.
Zahlreiche Widerstände und Fehlentwicklungen haben – von Tunesien abgesehen – die Revolte der Jahre 2011/12 erst einmal in der politischen Sackgasse enden lassen. Sie ist durch politische Restauration, Armut, Unterentwicklung und Bevölkerungsexplosion gekennzeichnet, begleitet von religiösem Fanatismus und politischem Radikalismus. Auswanderung und Flucht sind Symptome der Hoffnungslosigkeit. Auf der Suche nach einer neuen Ordnung hat sich vorerst Gewalt seitens unterschiedlichster Akteure und Ideologien krebsartig im Vorderen Orient ausgebreitet. Mit Blick auf die Dynamik zu Beginn dieser »dritten arabischen Revolte« 3– nach der ersten (in den frühen zwanziger) und der zweiten (in den fünfziger und sechziger Jahren) – ist es statthaft, vorherzusagen, dass damit nicht das letzte Wort der Geschichte gesprochen ist.
Aus der Distanz (und aus der Perspektive europäischer selektiver Erinnerungskultur und Arroganz) betrachtet, erscheint vielen Europäern der Raum seiner islamischen Nachbarschaft als »hoffnungsloser Fall« mit Blick auf politische und gesellschaftliche Erneuerung, wirtschaftliche Entwicklung (jenseits von Öl und Gas) und stabile demokratische Institutionen. Demgegenüber lässt ein vorurteilsfreier, aber zugleich empathischer Blick auf die Geschichte das Engagement, ja den Enthusiasmus und die Ernsthaftigkeit der Anstrengungen hervortreten, mit welchen durch das 20. Jahrhundert hindurch die umfassende Erneuerung der Grundlagen von Staat und Gesellschaft angestrebt worden ist. Die mit diesen Erneuerungsbestrebungen untrennbar verbundene Frage, in welcher Weise Tradition, Religion und durch die Geschichte gewachsene Identitäten bewahrt werden könnten, bedeutete freilich eine zusätzliche Bürde auf diesem Weg. Die Gesellschaften Europas hatten in den geschichtlichen Umbrüchen seit der Französischen Revolution und zumal während des 20. Jahrhunderts im Guten und Bösen letztlich aus dem Fundus der eigenen Geschichte und ihrer geistigen und politischen Errungenschaften schöpfen können. Demgegenüber waren die Nachbarn Europas im Nahen Osten und Nordafrika unabweisbar gezwungen, sich mit Werten, Normen und geistigen Dynamiken auseinanderzusetzen, die in Europa, also außerhalb ihres historischen Orbits, ihren Ursprung hatten. Darüber hinaus waren sie seit dem 19. Jahrhundert zunehmend in politische und wirtschaftliche Abhängigkeit, mit dem Ende des Ersten Weltkriegs gar in Unterlegenheit geraten. Die Entstehung des auf europäische Werte gegründeten Staates Israel schließlich bedeutete eine weitere schwere politische und psychologische Bürde auf dem Weg insbesondere der arabischen Gesellschaften zu einer neuen und selbstbestimmten Definition ihres Platzes in der Welt.
Bereits vor dem Ende des Ersten Weltkriegs hatten in Iran und im Osmanischen Reich revolutionäre Kräfte die Grundlagen der Herrschaft erschüttert. 1906 sah sich der Schah gezwungen, der Einführung einer Verfassung zuzustimmen; zwei Jahre später setzte ein Putsch der »Jungtürken«, die sich auf Teile der Armee stützten, die Wiedereinsetzung der Verfassung von 1876 seitens des Sultans durch. Die kemalistische Revolution nach der 1923 erfolgten Gründung der Türkischen Republik markierte radikale Wegzeichen für die künftige Entwicklung des gesamten Nahen und Mittleren Ostens. Im benachbarten Persien bewunderte Reza Khan das kemalistische Experiment. Zwar machte er das Land 1925 nicht zu einer Republik, sondern erneuerte nach dem Ende der Qadscharen-Dynastie die Monarchie als Reza Schah Pahlawi. Aber die Türkei Atatürks war ihm Vorbild bei der Umwandlung Irans.
Der arabische Raum trat – nach Ansätzen in der Zwischenkriegszeit – mit der Revolution der Freien Offiziere in Ägypten 1952 in ein revolutionäres Zeitalter ein. Überkommene Regimes fielen oder gerieten unter starken Wandlungsdruck; in zahlreichen Staaten entstanden politische Systeme, die sich an europäischen Ordnungsvorstellungen orientierten. Alle arabischen Staaten, deren Eliten dies anstrebten, traten in die Unabhängigkeit ein – im Falle Algeriens nach einem blutigen Ringen mit der französischen Kolonialmacht.
Die Gründung des Staates Israel 1948 hat den Verlauf der Geschichte des Nahen Ostens nachhaltig beeinflusst. Die Haltung zum jüdischen Staat war Gegenstand innenpolitischer Kontroversen und Konflikte innerhalb der arabischen Staaten und unter ihnen (später auch in Bezug auf Iran und die Türkei). Die Herausforderung, die sich mit der Existenz Israels stellte, hat auch die Stellung der Staaten der Region im internationalen System mitgeprägt.
Читать дальше