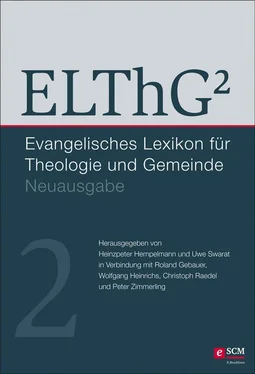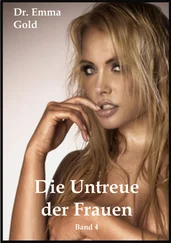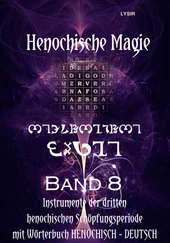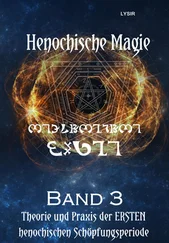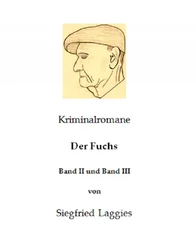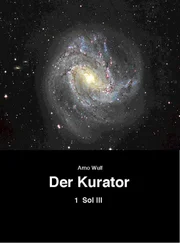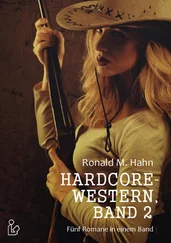Petrus → Abaelard (1079–1142) widerspricht der Lehre Anselms vollständig. Er verneint, dass der Kreuzestod aus Gründen der Sünde notwendig war und als G. gedeutet werden müsse. Argumentiert Anselm rein rational, so Abaelard auch emotional: »Wie grausam aber und ungerecht erscheint es, dass jemand unschuldiges Blut als irgendein Lösegeld verlangt haben sollte oder dass es ihm auf irgendeine Weise gefallen haben sollte, dass ein Unschuldiger getötet würde …« (Sauter, 68).
Bei M. → Luther finden sich Motive Anselms wieder. Das Motiv der → Ehre Gottes spielt bei Luther zwar nicht in demselben Maße eine Rolle wie bei Anselm, auch die strenge Alternative von → Strafe oder G. übernimmt er nicht, allerdings kennt er durchaus das Motiv der G.: »Doch ist diese barmherzige → Vergebung nicht geschehen ohne Verdienst, sondern es ist ein Mittler dazu gekommen, der es für uns und an unserer Statt verdienet hat. Das ist Christus, unser Herr. Denn Gott wollte gleichwohl genug getan haben für die Sünde, und seine Ehre und Recht bezahlt haben. Das konnten wir nicht; aber Christus tat’s, welcher aus grundloser Barmherzigkeit des Vaters dazu gesandt und zu uns kommen ist, solches auszurichten« (vgl. WA 17 I, 316,30-36).
Eng angelehnt an den Gedankengang Anselms sind die Fragen 12–18 des ev.-ref. → Heidelberger Katechismus. Der Gerechtigkeit Gottes muss »genug« geschehen, was der sündige Mensch zwar leisten muss, aber nicht leisten kann. Deswegen kann nur ein Gottmensch die G. leisten, und der Gottmensch ist niemand anderer als Jesus Christus.
Der für die ev. Theologie im 19. Jh. bestimmend gewordene Fr. → Schleiermacher übernahm den Begriff der G., deutete ihn allerdings vollständig neu. Christus als Sündloser leidet die Übel mit, die von der Sünde verursacht werden. Dieses Mitleiden denkt Schleiermacher als stark genug (d.h. als genug tuend), alle Menschen in seine erlösende Tätigkeit einzubeziehen, in die Kräftigkeit seines (Jesu) Gottesbewusstseins.
Die Satisfaktionslehre Anselms ist bis heute umstritten. Anstoß bereitet insbes. die These, Gott müsse für die Sünden der Menschen ein blutiges → Opfer haben, das ihm »genug tut«, weil ihm andere Möglichkeiten nicht zu Gebote gestanden hätten. Braucht Gott Blut, um vergeben zu können? Das Bild eines zornigen, ehrverletzten Gottes, das mit der Satisfaktionslehre gewöhnlich in Verbindung gebracht wird, bereitet vielen Mühe.
Zur Deutung von Anselms Lehre ist aber anzumerken, dass er an der allerersten Stelle, an der er mit Notwendigkeiten im Wesen Gottes argumentiert (»es ziemt sich oder ziemt sich nicht«), gar nicht vom → Zorn Gottes redet, sondern – im Gegenteil – von Gottes uranfänglicher Heilsabsicht, von der er nicht abgebracht werden kann: »… und es sich nicht ziemte, dass, was Gott über den Menschen beschlossen hatte [seine Seligkeit], vollständig zunichte werden sollte und dieses sein Vorhaben nicht zum Erfolg geführt werden konnte, es sei denn, das Menschengeschlecht würde von seinem Schöpfer selbst befreit?« (I,4) Die Verletzung der Ehre Gottes lässt sich in Anselms Denken auch als Missachtung der Heilsabsicht Gottes verstehen. Bedeutsam ist Anselms Konzept von G. auch für die Einschätzung des Gewichtes der Sünde, die nicht »einfach« vergeben werden kann, sondern eine Wirkung hat, die ausgeglichen werden muss.
Quellen: Abaelard: Expositio in epistolam ad Romanos/ Römerbriefkommentar (lat.-dt.), 3 Bde., übers. von R. Peppermüller, FChr 26, 2000; Anselm von Canterbury: Cur Deus homo / Warum Gott Mensch geworden (lat.-dt.), übers. von Fr.S. Schmitt, 51993.
Lit.: H.-M. Rieger: Der Gottesdienst des Gekreuzigten. Zum systematisch-theologischen Problemniveau von Anselms »Cur deus homo«, NZSTh 47/2005, 173-197; G. Sauter (Hg.): Versöhnung als Thema der Theologie, 1997.
Cl. Hägele
In G. wurde das Christentum bereits 327 zur Staatsreligion erhoben. Eine kriegsgefangene Frau aus Kappadozien mit Namen Nino soll den ostgeorgischen König Mirian für den christl. Glauben gewonnen haben. Im 7. Jh. nahm die georgische Kirche die Zwei-Naturen-Lehre von Jesus Christus als wahrem Gott und wahrem Menschen gemäß dem Konzil von → Chalkedon 451 an, fügte sich damit in die Familie der orth. Kirchen ein und erhielt gegen Ende des 8. Jh.s die → Autokephalie, d.h. das Recht, ihr kirchliches Oberhaupt selbst zu bestimmen.
Schon seit 645 kam es immer wieder zu arabischen und seldschukischen Invasionen nach G., von 736 bis 1122 schließlich zur Aufrichtung des muslim. Emirats von Tiflis. Dies stellte den bedeutendsten Stützpunkt islam. Herrschaft im → Kaukasus dar. Von 1122 bis 1220 konnte sich ein georgisches Großreich mit einem stabilen Verwaltungssystem aufbauen, in dem den Muslimen Religionsfreiheit gewährt wurde. Das 11. bis 13. Jh. war für G. eine polit., wirtschaftl., kulturell und kirchl. glänzende Epoche. Nach der Einnahme Konstantinopels (→ Byzanz) durch die Osmanen 1453 zerfiel das georgische Reich in mehrere Vasallenstaaten der Osmanen und Perser. Immer wieder gab es Versuche, die Fremdherrschaft abzuschütteln. In dieser Zeit gingen georgisches Nationalbewusstsein und Christentum eine sehr enge Verbindung ein. Bis in die zweite Hälfte des 18. Jh.s blieb der Kaukasus in Abhängigkeit von Persien und dem osmanischen Reich. Zu Beginn des 19. Jh.s wurde G. nach langen Auseinandersetzungen zw. Russen, Persern und Türken zur russ. Provinz erklärt.
In Folge dieser polit. Veränderungen wurde auch die Georgische Orthodoxe Kirche (GOK) in die russische eingegliedert und Gegenstand eines radikalen Russifizierungsprozesses. Nach der Februarrevolution 1917 in → Russland proklamierte die GOK ihre Autokephalie, nach der Oktoberrevolution im selben Jahr wurde G. auch polit. selbstständig. 1921 wurde es gewaltsam in die → Sowjetunion eingegliedert. Es folgten eine konsequente Sowjetisierung und brutale Religionsverfolgungen. Seit Gorbatschows Politik von Glasnost und Perestroika (1985–1991) konnte sich die GOK konsolidieren; eine rel. Erneuerung setzte ein. Am 9.4.1991 erklärte G. seine polit. Unabhängigkeit, worauf ein jahrelanger Prozess von Demokratisierung, wirtschaftl. Liberalisierung, aber auch von innenpolit. Machtkämpfen folgten. 1995 erhielt G. eine neue Verfassung, in der die volle Glaubens- und Bekenntnisfreiheit erklärt wurde. Mit der unblutigen Rosenrevolution unter der Führung des neugewählten Staatspräsidenten M. Saakaschwili setzte 2003 eine Stabilisierung ein. 2008 war G. mit Russland in einen Krieg um Südossetien verwickelt.
G. verfügt über eine Bevölkerung von 3,7 Mio. Einwohnern, ist ein multi-ethn. Land mit 26 Volksgruppen und 23 Sprachen aus sechs verschiedenen Sprachfamilien. 84 % der Einwohner gehören der GOK an, 4 % sind Armenier, 0,8 % röm.-kath. Dazu kommen sehr kleine Minderheiten von Baptisten, Lutheranern und Pfingstlern. 10 % sind Muslime. Die GOK genießt eine bevorzugte Rechtsstellung. Nach der Unabhängigkeitserklärung 1991 kam es zw. den Konfessionen immer wieder zu Spannungen und Gewalttätigkeiten. 2011 erhielten die nicht-orth. Religionsgemeinschaften mit einem hist. Bezug zum Land rechtl. Absicherungen.
Geistl. Oberhaupt der GOK ist seit 1977 Katholikos-Patriarch Ilia II. mit Sitz in Tiflis. Die GOK ist in 35 Eparchien gegliedert. Die 1988 eröffnete geistl. Akademie in Tiflis und mehrere Priesterseminare widmen sich der theol. Forschung und der Ausbildung des Klerus. Die Hilfsorganisation Lazarus unterhält Suppenküchen, kümmert sich um Straßenkinder und führt Sozialprojekte durch. Von 1962 bis 1997 war die GOK Mitglied des Ökumenischen Rates der Kirchen. Der Austritt erfolgte auf Druck nationalistischer und antiökum. Kräfte innerhalb der Kirche.
Lit.: H. Fähnrich: Geschichte Georgiens, 2010; T. Grdzelidze u.a. (Hg.): Witness Through Troubled Times. A History of the Orthodox Church of Georgia 1811 to the Present, 2006; I. Reißner: Georgien, 1998.
Читать дальше