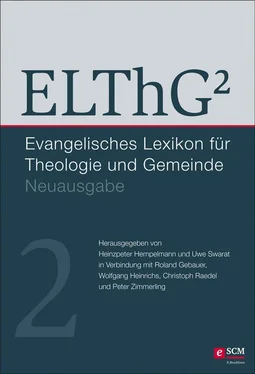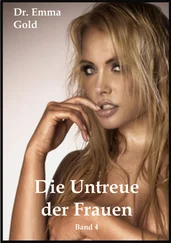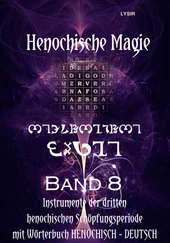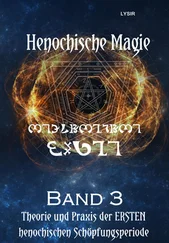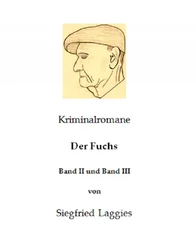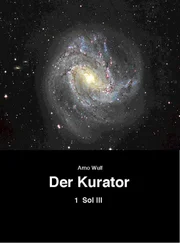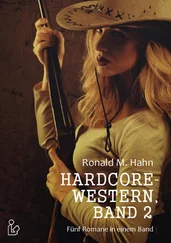Heute gibt es verschiedene institutionelle diakon. Arbeiten im Rahmen des → Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes in Verbindung mit Diakonissen-Mutterhäusern, mit Gemeinschaftsverbänden oder als eigenständige Einrichtungen. Dazu gehören einige Altenpflegeheime und Gästehäuser, Kindergärten, Senioren-Wohnanlagen, Hospize und Rehabilitationseinrichtungen. Zum DGD gehören sieben Kliniken, und auch der EC betreibt in Woltersdorf bei Berlin ein eigenes Fachkrankenhaus für Geriatrie. Dazu kommen die Arbeit des Blauen Kreuzes, der Dienst der → Berliner Stadtmission mit ihren vielfältigen Angeboten für Menschen in sozialen Notlagen, sowie die Rehabilitationsarbeit des → Geistlichen Rüstzentrums Krelingen (Lüneburger Heide). Die diakon. Arbeit der G. ist damit heute vielfältig spezialisiert, professionell organisiert und in das → Diakonische Werk der ev. Kirchen integriert, wobei die urspr. Konzeption der Vorordnung einer evangelist. Zielsetzung im Verhältnis zur sozialen Hilfeleistung im Laufe der Zeit zu einer ganzheitlichen Sichtweise weiterentwickelt wurde.
Lit.: Fr. Lüdke: Diakonische Evangelisation, 2003; Fr. Schaefer: Diakonie und Verkündigung, 2014.
Fr. Lüdke
Gemeinschaftsbewegung (Missionswerke)
Die → Gemeinschaftsbewegung (G.), die sich im 1888 gegründeten → Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverband, kurz: »Gnadauer Verband« (GV), organisatorisch zusammengeschlossen hat, versteht sich als Bewahrer und Vermittler des Erbes von innerkirchl. → Pietismus und → Erweckungsbewegung. Sie verdankt ihre Entstehung auch einem kräftigen Impuls aus der internationalen Evangelisations- und Missionsbewegung. Deshalb gehörten zum GV von Anfang an auch Werke, deren Arbeitsschwerpunkt die Weltmission darstellte.
Die meisten dieser Missionswerke, die teilweise auch als Gemeinschaftsmissionen bezeichnet wurden, haben ihre Wurzeln in der → Heiligungsbewegung und der Evangelisations-, und Heilungsbewegung der zweiten Hälfte des 19. Jh.s und wurden inspiriert von Hudson → Taylor und seinen Missionsprinzipien (Verzicht auf Spendenwerbung und Erwarten der nötigen Mittel unmittelbar von Gott). Deshalb werden diese Missionen auch → Glaubensmissionen genannt. Sie fanden ihre Unterstützerkreise weitgehend in den Gemeinschaften. Allerdings variierte in der 125-jährigen Geschichte des GV die Zahl der Missionswerke, die sich zur G. zählten und auch organisatorisch im GV vertreten waren. Missionswerke, die heute nicht mehr direkt zur G. und zum GV gerechnet werden, sind z.B.: China-Allianz-Mission (heute als Allianz-Mission vorwiegend die Mission des → Bundes Freier evangelischer Gemeinden), Deutsche Orient-Mission, Christoffel-Blindenmission und Sudan-Pionier-Mission (heute EMO – Evangeliumsgemeinschaft Mittlerer Osten); die Deutsche Missionsgemeinschaft (heute: DMG interpersonal e.V.), 1951 in Beatenberg (Schweiz) gegründet, hat ihren Sitz in Sinsheim (Württemberg) und ist heute (Stand 2017) mit 350 Mitarbeitern das größte Missions- und Hilfswerk in Deutschland ,sowie die Deutsche Indianer Pionier Mission (St. Johann-Lonsingen), 1962 von J. Rathlef gegründet (damals Leiter der Zeltmissionsvereinigung Süd), die mit ihren 75 Mitarbeitern missionarische und soziale Projekte unter der indigenen Bevölkerung in Brasilien und in Paraguay durchführt und in Baden-Württemberg, in Mecklenburg-Vorpommern und in der Uckermark Evangelisation und Gemeindegründung betreibt.
Zu den Missionen, die gegenwärtig dem GV angehören, zählen die Neukirchener Mission (begonnen 1882, ein Gründungsmitglied des GVs, die älteste dt. → Glaubensmission, trad. Gemeindegründung in Afrika, Indonesien und heute in neun Ländern), als größtes Missionswerk die Liebenzeller Mission (gegründet 1899 als dt. Zweig der China-Inland-Mission, trad. Arbeit in China, Ozeanien, Japan, heute mit 230 Mitarbeitern in 26 Ländern), die Mission für Süd-Ost-Europa (gegründet 1903, trad. in Osteuropa und Russland, heute 120 Mitarbeiter aus 23 Ländern in Europa und Asien); die Evangelische Karmelmission (gegründet 1911, begann die Arbeit unter Juden und Arabern auf dem Karmelgebirge/Israel; heute Arbeit in vielen muslim. Ländern); die Gnadauer Brasilien-Mission (gegründet 1927 für die geistl. Versorgung dt. Auswanderer in Brasilien, heute 50 Mitarbeiter in Südbrasilien); die Marburger Mission (heute Stiftung Marburger Mission, gegründet 1928, erwachsen aus der 1909 begonnenen Yünnan Mission in China; weitere Arbeit seit 1931 in Brasilien; heute 90 Mitarbeiter in 10 Ländern auf vier Kontinenten). Zu diesen Missionen zählt auch die EC-Indienhilfe, eine sozial-diakon. Arbeit des Deutschen → Jugendverbandes »Entschieden für Christus«. Innerhalb des GV bilden die genannten Missionswerke eine eigene Arbeitsgemeinschaft und stehen im engen Austausch miteinander.
Lit.: B. Brandl: Der Einfluss der internationalen evangelischen Missions- und Evangelisationsbewegung auf die Gründungsphase des Gnadauer Verbandes, in: Fr. Lüdke / N. Schmidt (Hg.): Evangelium und Erfahrung. 125 Jahre Gemeinschaftsbewegung, 2014, 35-64, dort weitere Lit.; A. Franz: Mission ohne Grenzen. Hudson Taylor und die deutschsprachigen Glaubensmissionen, 1993; St. Holthaus: Heil – Heilung – Heiligung. Die Geschichte der deutschen Heiligungs- und Evangelisationsbewegung (1874–1909), 22016; W. Oehler: Geschichte der Deutschen Evangelischen Mission, Bd. II, 1951; J. Richter: Deutsche evangelische Missionsfelder, 1940, 163ff (Die deutschen Gemeinschaftsmissionen).
B. Brandl
Gemeinschaftsschule → Schule und Kirche
Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP)
Das GEP mit Sitz in Frankfurt/Main ist das multimediale Kompetenzzentrum für die → Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), für ihre Gliedkirchen, Werke und Einrichtungen sowie für die ev. → Freikirchen und alle interessierten Unternehmen und Organisationen. Unter seinem Dach finden sich die Bereiche Printpublizistik, Nachrichtenagentur (epd), Medienethik, Medienpädagogik, Hörfunk, Fernsehen, Film und Online. Es unterstützt die Öffentlichkeitsarbeit der EKD und wirkt an medienpolit. Stellungnahmen mit. Das GEP wurde am 5.7.1973 gegründet. Sein erster Direktor, R. Geisendörfer, war die treibende Kraft für die Gründung.
Publizistisches Ziel des GEP ist es, die Präsenz der Kirche in der Öffentlichkeit und die Wahrnehmung ihrer medienpolitischen Aufgabe in einer zentralen publizistischen Einrichtung der evangelischen Kirche zu versammeln, »die übergreifende publizistische Angebote effektiv, innovationsorientiert und kostengünstig anbietet; die publizistischen Kräfte im Protestantismus bündelt, Synergien nutzt und das Zusammenwirken von zentralen und regionalen Aktivitäten koordiniert; das zentrale medienpolitische Mandat der evangelischen Kirche wahrnimmt und Beratung, Planung und Förderung in allen Medienfragen anbietet« (EKD / GEP, https://www.ekd.de/publizistik_1997_mandatmarkt11.html; 25.2.2019).
Als EKD-nahe Institution hat das GEP von Anfang an den Spagat zw. kirchl. Öffentlichkeitsarbeit und kritischer christl. Publizistik bewältigen müssen. Ob es sinnvoll war, die seit der Gründung der landeskirchl. Presseverbände am Ende des 19. Jh.s gerade durch ihre Vielfalt wirksame ev. Publizistik in einem Gemeinschaftswerk zu konzentrieren, bleibt fraglich. Geisendörfers Hoffnung hat sich jedenfalls nicht erfüllt: »Spontanes, aktuelles und sachgemäßes Handeln kann nicht nach dem Kanon einer Verwaltungsbehörde funktionieren« (Schulz, 135). Im Strudel neuer Medientechniken und finanzieller Ungewissheit hat das GEP die kirchl. Privatfunkarbeit zunächst weitgehend der aer (Arbeitsgemeinschaft evangelischer Rundfunk e.V.) überlassen und inzwischen sogar seine publizistische Fortbildungskompetenz teilweise abgegeben.
Читать дальше