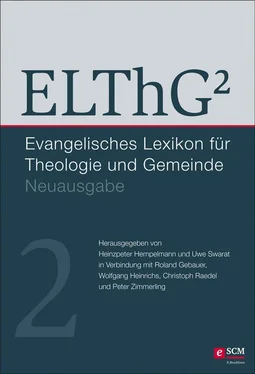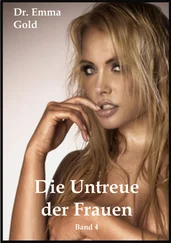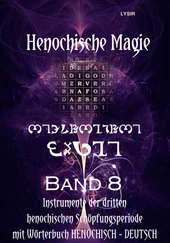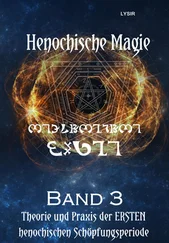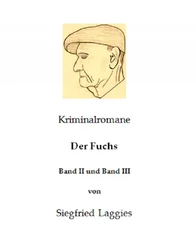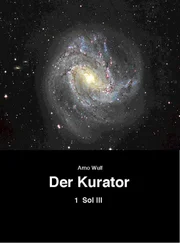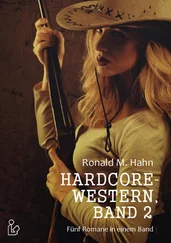ELThG² - Band 2
Здесь есть возможность читать онлайн «ELThG² - Band 2» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:ELThG² - Band 2
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
ELThG² - Band 2: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «ELThG² - Band 2»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
ELThG² - Band 2 — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «ELThG² - Band 2», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Lit.: H. Bedford-Strohm: Gemeinschaft aus kommunikativer Freiheit, 1999; D. Bonhoeffer: Sanctorum Communio (1930), DBW 1, 1986; Communio Sanctorum. Die Kirche als Gemeinschaft der Heiligen, hg. von der Bilateralen Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofskonferenz und der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, 32005; J.D. Zizioulas: Being as Communion, 1985.
K. Lehmkühler
IV. praktisch-theologisch
Das Wort »G.« kann sich auf vieles beziehen – darauf, dass der Mensch durch Gott zur G. und damit auf → Ehe und → Familie hin geschaffen wurde (vgl. Gen 1,27), oder auf die Christengemeinde als »Gemeinschaft der Heiligen« (lat. communio sanctorum ), auf G. im Sinne der Deutschen → Gemeinschaftsbewegung oder auch auf kommunitäre Lebensgemeinschaften (→ Bruder- und Schwesternschaft/-en). Im Folgenden ist nur von Letzterem ausdrücklich die Rede, obwohl vieles auch auf die anderen Formen von G. bezogen werden kann.
Urbild und Vorbild jeder christl. G. ist der dreieinige Gott selbst, so wie er sich den Aposteln Jesu Christi geschichtlich erfahrbar gemacht hat. Gott ist G. in den drei Personen von Vater, Sohn und Hl. Geist (→ Trinität). »Einheit und Vielheit sind gleich ursprünglich und gleich wesentlich« (G. Greshake, in: Neue Stadt 2/2006, 5). Das bedeutet, dass G. immer auch Vielgestaltigkeit, Unterschiedlichkeit, Pluriformität bedeutet, aber nicht Uniformität, Vereinheitlichung oder Vereinnahmung und Einebnung der Unterschiede. Wo Letzteres geschähe, würde G. zu einem Instrument der Manipulation ihrer Mitglieder.
Andererseits haben G.en genauso wie einzelne Menschen eine spezielle Berufung von Gott, einen gemeinsamen Auftrag. Gäbe es das nicht, würde G. nur um ihrer selbst willen existieren und verlöre ihr Zeugnis gegenüber Kirche und Welt. Wer in eine G. eintritt, unterstellt sich diesem Auftrag, er oder sie wählt ihn und tritt ein in die körperschaftliche Berufung der Gruppe. Dabei kann man davon ausgehen, dass zwischen der persönl. Berufung des Einzelnen und der korporativen Berufung der G. eine genügend große Schnittmenge besteht, andernfalls würde man diese bestimmte G. nicht wählen. Es gilt jedenfalls auch hier, was von Paulus für Ehe und Ehelosigkeit gesagt wird (vgl. 1Kor 7,37), dass es keinerlei Zwang oder Druck geben darf, sondern die Zugehörigkeit aus freien Stücken gewählt werden muss.
Daraus ergibt sich eine Balance, die nicht leicht zu wahren ist: Der oder die Einzelne muss prüfen, inwieweit persönl. Bedürfnisse den gemeinsamen Auftrag hindern oder fördern oder zumindest nicht im Wege stehen, inwieweit es also notwendig ist, persönl. Bedürfnisse geltend zu machen, auch um der eigenen gesunden Reifung willen, oder inwieweit sie zurückzustehen haben um des gemeinsamen Auftrags willen. Das ist nie ein für alle Mal festlegbar.
Für die Leiter einer G. ergibt sich daraus die Aufgabe, einerseits den Bedürfnissen der Mitglieder und den Erfordernissen ihres geistl. Wachstums und ihrer Reifung Rechnung zu tragen, andererseits müssen sie dafür sorgen, dass der Auftrag der G. erfüllt wird und die korporative Berufung lebendig bleibt. Sie müssen ihre Mitglieder herausfordern, dürfen sie aber nicht vereinnahmen oder ihren persönl. Zielen und Wünschen unterordnen. Dabei ist auch zu fragen, ob sich die Berufung der G. so in den Mittelpunkt schiebt, dass Jesus Christus darüber in den Hintergrund gerät. In jeder geistl. G. muss er die Mitte bleiben, eine Stellung, die auch nicht der von ihm gegebene Auftrag einnehmen darf. Diese Gefahr ist gegeben, weil jedes Wirken in der Welt auch eine organisatorische, öffentlichkeitswirksame und wirtschaftl. Dynamik entwickelt, die das Denken in Beschlag zu nehmen droht.
Kommunitäten machen vielfach die Beobachtung, dass Menschen an ihre Türen klopfen, die psychisch instabil sind und sich nach einer G. sehnen, die sie trägt. Hier liegt eine große Gefahr, denn eine G. trägt nur dann, wenn sie zuvor von den einzelnen Mitgliedern getragen wird. »G. tragen« heißt aber auch, sich Reifungsprozessen auszusetzen, Korrektur anzunehmen, mit den anstößigen Seiten der anderen umgehen zu lernen und mit den eigenen unguten Seiten vertraut zu werden. Das geschieht im gemeinsamen Leben von selbst, obwohl die Gefahr der Manipulation lauern kann. Konflikte sind unvermeidlich, und in rechter Weise eingegangen und ausgetragen, können sie wesentlich zur Reifung beitragen. Dazu braucht es ein gewisses Maß an innerer Stabilität. Man sollte hier keiner »Urkirchen-Romantik« (Bleistein) erliegen, als ob das »Ein-Herz-und-eine-Seele-Sein« (vgl. Apg 4,32) damals so harmonisch war, wie es klingt; die scharfen Auseinandersetzungen der Briefe des NT zeigen, wie schon damals hart miteinander gerungen wurde. »Gemeinschaft der Heiligen« ( communio sanctorum ) wird unausweichlich als G. der Sünder erfahren, die von Jesus Christus erlöst, berufen und auf einen gemeinsamen Weg gestellt sind.
Lit.: D. Bonhoeffer: Sanctorum Communio, DBW 1, 1986; Das versteht jedes Kind (Interview mit G. Greshake), Neue Stadt 2/2006, 4-6; Br. Fr. Joest: Einheit im dreifaltigen Gott – versöhnte Verschiedenheit unter uns, in: Fr. Aschoff / M. Marmann (Hg.): Zuneigung. Christliche Perspektiven für Europa, 2007, 77-84; K.-H. Michel: Zwei Seiten der Einheit, in: ebd., 27-32; A. Schödl: Einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Geschwister, in: A.-M. aus der Wiesche / Fr. Lilie u.a. (Hg.): Kloster auf evangelisch, 2016, 27-32; A. Seidel: Tritt ein in den Liebesraum Gottes, in: ebd., 12-16.
Br. Fr.Chr. Joest
Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten (STA) → Adventisten / Adventismus
Gemeinschaft europäischer evangelikaler Theologen (GEET/FEET) → Evangelikale Theologie
Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE)
Die GEKE ist eine Gemeinschaft von Kirchen, die fast alle lutherischen, reformierten, unierten und methodistischen Kirchen Europas einschließt. Sie geht auf die 1973 verabschiedete → Leuenberger Konkordie (LK) zurück und hieß deshalb bis 2003 Leuenberger Kirchengemeinschaft.
1. Nach fast 450-jähriger Trennung erklärten Lutheraner und Reformierte – die beiden Hauptflügel der kontinental-europ. Reformation – in der LK, dass die gegenseitigen Lehrverurteilungen (neben dem zentralen Kontroverspunkt des → Abendmahls auch bei der Christologie und der Prädestinationslehre) angesichts neuerer exeget. und theol. Erkenntnisse heute nicht mehr zutreffend seien. Auf der Grundlage eines gemeinsamen Verständnisses des Evangeliums erklärten sie Kanzel- und → Abendmahlsgemeinschaft und verpflichteten sich, zur Verwirklichung der Kirchengemeinschaft weitere theol. Gespräche zu führen und ihr Zeugnis und ihren Dienst gemeinsam auszurichten. Voraussetzung dieses Verständnisses von Kirchengemeinschaft war die aus dem → Augsburger Bekenntnis (Artikel VII) übernommene Überzeugung, dass zur Einheit der Kirche die Übereinstimmung in der rechten Lehre des Evangeliums und in der rechten Verwaltung der → Sakramente ausreicht, sowie die (1994 ausformulierte) Unterscheidung von Grund, Gestalt und Bestimmung der Kirche.
2. Die erklärte Kirchengemeinschaft sollte zunächst keine unmittelbaren organisatorischen Folgen haben und erst recht nicht zu einer Union der beteiligten Kirchen führen. Eine Vereinheitlichung der lebendigen Vielfalt der Verkündigungsweisen, des gottesdienstl. Lebens und der kirchl. Ordnung lehnt die LK ausdrücklich ab. Darum wird das Modell der Kirchengemeinschaft auf Grundlage der LK gern mit dem Motto »Einheit in versöhnter Verschiedenheit« beschrieben. Gleichwohl haben sich später luth. und ref. Kirchen in den Niederlanden (2004) und Frankreich (2006/2013) auf Grundlage der LK vereinigt.
3. Das Haupttätigkeitsfeld der GEKE ist seit ihrer Gründung die Durchführung von Lehrgesprächen (siehe LK 39), deren Ergebnisse als Studien veröffentlicht werden. Sie behandelten neben den klassischen Kontroversthemen zunehmend Probleme, die sich im Hinblick auf Zeugnis und Dienst, Ordnung und Praxis neu ergeben. Hervorzuheben sind neben dem Grundlagentext »Die Kirche Jesu Christi« (s.o.) Studien über Kirche und Israel (2001), Amt und Episkope sowie das Schriftverständnis (beide 2012). Die Notwendigkeit, diese Lehrgespräche zu organisieren, seit 1990 auch zunehmend die Herausforderung, die Gemeinsamkeit in Zeugnis und Dienst im zusammenwachsenden Europa zu ermöglichen, führten zu einer Festigung der institutionellen Strukturen der GEKE, die eine Geschäftsstelle in Wien unterhält, von einem dreizehnköpfigen Rat geleitet wird und alle sechs Jahre eine Vollversammlung abhält. Seit 2001 arbeitet sie in enger Abstimmung mit der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) daran, auch zu gesellschaftl. und polit. Themen die »evangelische Stimme in Europa« zu artikulieren.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «ELThG² - Band 2»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «ELThG² - Band 2» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «ELThG² - Band 2» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.