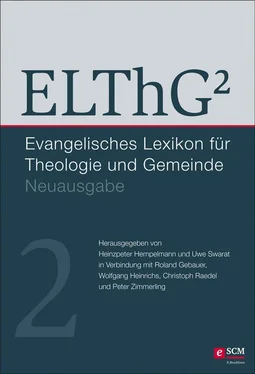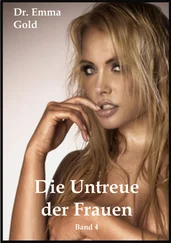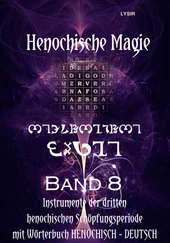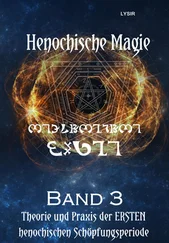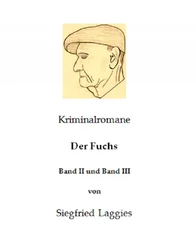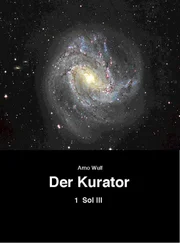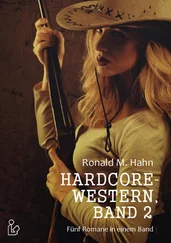Gegenwärtig wird G. – wenn überhaupt – nur noch im freikirchl. Kontext geübt. Subjekt solcher »Gemeindedisziplin« sind hier zunächst die pastoral Verantwortlichen der Gemeinde. Sie sollen zurechtweisen (1Thess 5,12; Hebr 13,17), sind aber auch selbst bei erwiesenem Fehlverhalten zu korrigieren (1Tim 5,19ff). Weiter soll jeder Christ Verantwortung übernehmen, Mitchristen zurechtzuhelfen (1Thess 5,14). Findet er kein Gehör, sollte er weitere seelsorgerliche Menschen hinzuziehen (Mt 18,15f). Stößt das seelsorgerliche Bemühen im kleinen Kreis auf Verschlossenheit, bleibt als letzter Schritt, die Angelegenheit – unter inhaltlicher Wahrung der Persönlichkeitsrechte – der Gemeindeversammlung vorzulegen, die sich konstruktiv um Korrektur bemüht, bei Unbußfertigkeit aber G. üben muss (Mt 18,17). In letzter Konsequenz kann dies den Gemeindeausschluss bedeuten (»binden« nach Mt 18,18), jedoch mit dem Ziel, dass es zur Buße und Wiederaufnahme kommt (»lösen« nach Mt 18,18; vgl. Bill. I, 1926, 792f).
Ein Gemeindeausschluss darf nicht voreilig geschehen, denn er ist eine äußerste Maßnahme, durch die der Ausgeschlossene in den gottfernen Bereich zurückkehrt, aus dem er vor seinem Christwerden kam (vgl. 1Kor 5,5; Kol 1,12f). So sind zunächst Schritte denkbar, die Anlass zum Umdenken geben, wie vorübergehendes Aussetzen von Mitarbeit bzw. Ausschluss vom → Abendmahl. Anlass zur Überheblichkeit gegenüber Irrenden gibt es dabei nicht (Gal 6,1), vielmehr liegt im Wissen um die »teure Gnade« (D. Bonhoeffer, Nachfolge, 1994) ein schmaler Grat zwischen den Abgründen des → Moralismus auf der einen und des → Relativismus auf der anderen Seite. Ziel eines jeden Schrittes der G. ist die Umkehr des Sünders und die Wiederherstellung der Gemeinschaft (vgl. das »auf dass« in Aussagen wie 1Tim 1,20, 2Tim 3,16f, Tit 2,11). Ob es angesichts des Verlusts der Kirchenzucht bereits im 18. Jh. und eines zunehmenden ethischen und weltanschaulichen Pluralismus zu einer Wiedergewinnung innerhalb der Landeskirchen kommen kann, ist fraglich. Die röm.-kath. Kirche hält mit der automatischen → Exkommunikation Geschiedener an Restbeständen der trad. G. fest.
Wie das im NT zu findende Anliegen einer G. unter heutigen Bedingungen eine sinnvolle Gestalt finden kann, gehört zu den noch zu lösenden Aufgaben Prakt. Theologie. So sinnvoll, einleuchtend und realisierbar G. für Freiwilligkeitsgemeinden ist, sosehr ist offen, wie es in den offenen landeskirchl. Gemeinden Gestalt gewinnen kann. Auch die vielfach zu beobachtende Praxis des Gemeindewechsels stellt hier vor noch zu lösende Herausforderungen.
Lit.: R. Bohren: Das Problem der Kirchenzucht, 1952; D. Fleischhammel: Den Bruder und die Schwester gewinnen: Wie geschieht korrektive Gemeinde-Seelsorge?, 2000; Th.C. Oden: Corrective Love. The Power of Communion Discipline, 1995; Chr. Raedel: Gemeindezucht in Freikirchen im Spannungsfeld von Inklusion und Exklusion als Thema der Systematischen Theologie, in: Freikirchenforschung, 23/2014, 105-138; G. Stemmler: Heilende Gemeindekorrektur. Der biblische Weg der Gemeindezucht, 22012.
H. Stadelmann
I. kulturgeschichtlich
Die neuere kulturgeschichtl. Reflexion des Begriffs »Gemeinschaft« setzt da ein, wo G. zum Ziel einer Sehnsucht wird. 1887 veröffentlichte F. Tönnies mit »Gemeinschaft und Gesellschaft« eines der Gründungswerke der dt. → Soziologie . Auch wenn dieses Werk erst Anfang des 20. Jh.s nachhaltig wahrgenommen wurde, ist es mit seiner Fragestellung bezeichnend für einen breiten Diskurs innerhalb des zweiten Kaiserreichs. Als G. bezeichnet Tönnies ursprüngliche Formen menschl. Zusammenseins: die G. des Blutes bzw. der → Familie, des nachbarschaftlichen Nahbereichs und die G. in Form persönl. → Freundschaft. In diesen Kontexten ist G. durch persönl. Beziehungen gekennzeichnet. Im Prozess der sich entwickelnden → Moderne gibt es demgegenüber eine zunehmende Dynamik hin zu einer anderen Ordnung der Sozialbeziehungen, die Tönnies → »Gesellschaft« nennt. Die wirtschaftl. und polit. Entwicklung folgt hier dem modernen Prinzip funktionaler Ausdifferenzierung. Die Individuen sind in einem instrumentellen Sinne verbunden zur Erreichung bestimmter sachlicher Zwecke. V.a. die Entstehung des modernen → Kapitalismus sowie des bürokratischen Staates erzeugt unpersönl. Beziehungsgestalten wie z.B. Aktiengesellschaften, polit. Parteien, → Gewerkschaften etc., in denen es nicht um persönl. Begegnung, sondern um gemeinsame Interessen und Ziele geht. Tönnies’ Unterscheidung zw. G. und Gesellschaft war Teil einer kulturkrit. Strömung seiner Zeit, die den Prozess der Modernisierung als Atomisierung empfand und neue Formen von Vergemeinschaftung erstrebte. V.a. das vielfältige Feld der → Jugendbewegung (Wandervogel, → Pfadfinder) steht für diese Sehnsucht nach G. und die Skepsis gegenüber zunehmender Vergesellschaftung. Die Auflösung vieler trad. Bindungen wurde durch neue G.sformen kompensiert, nicht zuletzt auf rel. Gebiet, z.B. in der → Gemeinschaftsbewegung, wie auch insgesamt im Bestreben, die parochialen Kirchengemeinden für enge Formen persönl. G.serfahrung zu öffnen.
Dieses G.sideal wurde auch polit. folgenreich: Mit dieser Gegensatzbildung konnte die moderne Parteienvielfalt der Weimarer Demokratie nur als Zersplitterung wahrgenommen werden. Gegenüber den modernen Entsolidarisierungsschüben wurde im 20. Jh. »Volksgemeinschaft« ein Schlüsselwort kollektiver Sehnsucht. In der Weimarer Zeit war etwa die polit. Rhetorik P. Hindenburgs ganz auf die symbolische Verkörperung von Volksgemeinschaft im Amt des überparteilichen Reichspräsidenten eingestellt; ganz zu schweigen vom Missbrauch des G.sideals durch den Nationalsozialismus.
Neben vielen Anhängern fand das Konzept der G. schon früh seine Kritiker. H. Plessner diagnostizierte in seinem Buch »Grenzen der Gemeinschaft« (1924) in der Entgegensetzung von G. und Gesellschaft die Gefahr einer Ideologisierung des G.sgedankens, der durch überzogene Einheitserwartungen nur zu einer Radikalisierung und Totalisierung des soz. Lebens führen könnte. Nach dem Zweiten Weltkrieg dominierte lange Zeit die Kritik an G.sidealen, die als Sehnsucht nach vormodernen Sozialformen diskretitiert wurden.
Eine neue Entdeckung erfährt der G.sbegriff gegenwärtig durch den Kommunitarismus. Autoren wie A. McIntyre, Ch. Tayor, M. Sandel oder M. Walzer vertreten keinen utopischen Gegenentwurf zum liberalen → Individualismus. Sie fragen aber kritisch, ob der Erfolg des westlichen Gesellschaftsmodells nicht Voraussetzungen hat, die in vorpolit., kulturellen G.sformen begründet sind. Die abstrakte Ausbildung ethischer und jurist. Normen setzt voraus, dass es schon bestehende G.en mit gelebten rel. oder trad. Werten gibt, in denen menschl. Leben weitergegeben, Werte gestärkt und Zusammenhalt erhalten werden. → Demokratie setzt eine funktionierende Zivilgesellschaft voraus, die über Sozialkapital und gegenseitiges Vertrauen verfügt. Aus dieser Beobachtung folgern einige Kommunitaristen, dass der Schutz bestehender G.sformen (Familie, Religionsgemeinschaften, ethn. Gruppen) gegenüber der zunehmenden Individualisierung nicht vernachlässigt werden darf. Kritiker des Kommunitarismus wie Z. Bauman bezweifeln hingegen, dass die Stärkung gemeinschaftlicher Strukturen den Verzicht auf individuelle Freiheitsrechte einschließen darf. Nicht bereits bestehende Gemeinschaften, sondern die Möglichkeit immer neuer Vergemeinschaftung innerhalb einer freien Gesellschaft sind für die Demokratie lebensnotwendig.
Für viele rel. Gruppierungen der Gegenwart ist das Angebot von erfahrbarer G. ein Schlüsselfaktor ihrer Attraktivität. Zugleich ist offenkundig, dass sie sich weder der modernen Nötigung zur Institutionalisierung noch der Herausforderung postmoderner Individualisierung entziehen können.
Читать дальше