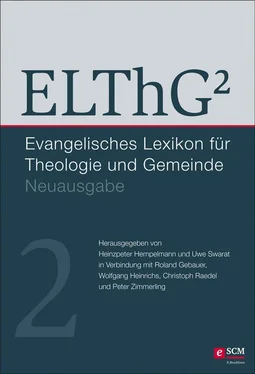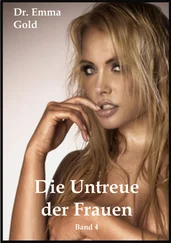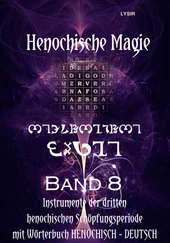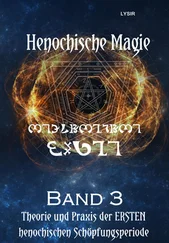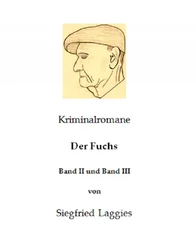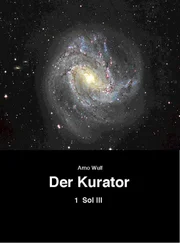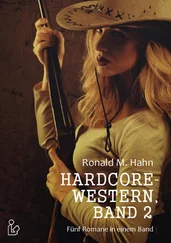ELThG² - Band 2
Здесь есть возможность читать онлайн «ELThG² - Band 2» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:ELThG² - Band 2
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
ELThG² - Band 2: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «ELThG² - Band 2»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
ELThG² - Band 2 — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «ELThG² - Band 2», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Lit.: R. Bohren: Das Problem der Kirchenzucht im Neuen Testament, 1952; I. Goldhahn-Müller: Die Grenze der Gemeinde, 1989; H. Umbach: In Christus getauft – von der Sünde befreit. Die Gemeinde als sündenfreier Raum bei Paulus, 1999.
J. Zimmermann
II. kirchengeschichtlich
Schon in den ersten christl. Gemeinden gab es Gemeindeglieder, die den sich dort festigenden Überzeugungen zuwiderhandelten oder das Bekenntnis infrage stellten. Gefährdete dieses Verhalten das Heil des Einzelnen oder der ganzen Gemeinde, reagierten die Gemeinden mit G. (→ Gemeindezucht, I.). So blieb es zunächst auch in nach-ntl. Zeit. Die G. wurde als Ermahnung, Entzug kirchl. Rechte, Ausschluss vom → Abendmahl und in schweren Fällen als Ausschluss aus der Gemeinde geübt. Eine Wiederaufnahme des umkehrwilligen Sünders war in der nach-ntl. Kirche in der Regel an bestimmte Bußübungen geknüpft. Anfangs wurde die G. von der ganzen Gemeinde geübt; später oblag sie den Amtsträgern und verband sich, nachdem die kirchl. Ordnung staatl. Schutz unterlag, vielfach mit staatl. Strafgewalt (→ Staat und Kirche).
Ein erstes Problem für die G. in der vorkonstantinischen Kirche ergab sich durch die große Zahl an Verfehlungen während der → Christenverfolgungen. Unter Druck hatten viele Christen Abschriften bibl. Bücher ausgeliefert oder röm. Göttern geopfert. Die Frage, ob sie nach dem Ende der Verfolgung wiederaufgenommen werden sollten und wer dies tun könne, löste heftige Diskussionen aus. Im Ergebnis wurden aufrichtig Bußwillige wieder aufgenommen. Die Entscheidung darüber wollten zunächst die sog. »Bekenner« treffen, d.h. diejenigen Gemeindeglieder, die in der Verfolgung standfest geblieben waren. Seit → Cyprian von Karthago (gest. 258) lag die Entscheidung aber beim → Bischof.
Im MA wurde der Bann bzw. die → Exkommunikation (Ausschluss aus der kirchl. Gemeinschaft) zunehmend häufiger verhängt. Unterschieden wurde zw. dem kleinen Bann (Abendmahlsauschluss oder Ausschluss von allen → Sakramenten) bei geringeren Vergehen und dem großen Bann (Ausschluss aus der christl. Gemeinschaft) nach schweren Vergehen. Andere Maßnahmen der G. wie der Ausschluss von kirchl. Ämtern oder die Verweigerung eines kirchl. Begräbnisses kamen hinzu. Der Kontakt mit Exkommunizierten wurde verboten. In dieser Zeit begann auch der missbräuchliche Einsatz der G. etwa, um Schulden und Abgaben einzutreiben.
Die Reformatoren traten dem Missbrauch der G. entgegen, indem sie den Zusammenhang zw. G. und Predigt wiederherstellten. Predigt und G. sollten gemeinsam die Gemeindeglieder zum rechten Glauben führen und ihnen den Weg ins Himmelreich öffnen. M. → Luther lehnte den großen Bann wegen seiner Verbindung mit weltl. Strafen ab. Er setzte sich für G. als innergemeindliche seelsorgerliche Maßnahme ein, die bis hin zum Abendmahlsauschluss reichen konnte. In den luth. Gebieten wurde die G. jedoch nicht einheitlich geregelt. Vielfach wanderte Pflicht und Recht dazu von den Gemeinden zu den landeskirchl. Konsistorien, und die G. entwickelte sich vielerorts wieder zu einem obrigkeitlichen Strafmittel.
In den → Reformierten Kirchen spielte die G. von Anfang an eine größere Rolle als in den luth. Kirchen. Die Reformierten wollten nicht nur die Lehre, sondern auch das Leben der Kirchenmitglieder reformieren. Man war sich zunächst jedoch uneinig, ob gemeindliche und obrigkeitliche Zucht zusammengefasst (U. → Zwingli) oder streng voneinander getrennt werden sollten (J. → Oekolampad). J. → Calvin legte in seinem »Unterricht von der christlichen Religion« (lat. Institutio Christianae Religionis) die theol. Grundlagen der G. aus seiner Sicht so dar, wie sie in der Genfer Kirchenordnung (1641) festgehalten wurden. Er verstand die G. als rein kirchl. Angelegenheit, die von Kirchenräten durchgeführt werden sollte. Auch einfache Gemeindeglieder waren aufgefordert, Abweichler zu ermahnen und in die Gemeinschaft der Kirche zurückzuleiten. Faktisch allerdings wurde die G. vom Konsistorium, der Gemeindeleitung, ausgeführt – nicht unabhängig von obrigkeitlichen Interessen. Als »Bußzucht« (→ Heidelberger Katechismus) spielte die G. in ref. Gemeinden länger als im → Luthertum eine wichtige Rolle.
Vertreter der radikalen Reformation wie die → Täufer übten meist eine strenge G. zur Reinerhaltung der Gemeinde aus; Abweichler wurden aus der Gemeinde ausgeschlossen. Die G. dieser Gruppierungen blieb frei vom Einfluss der Obrigkeit. → Puritanismus, → Pietismus und → Erweckungsbewegung sahen die G. als förderlich für ein frommes Leben an. → Rationalismus und → Aufklärung führten jedoch dazu, dass die G. im 17. und 18. Jh. insgesamt an Bedeutung verlor. Abweichler sollten nicht mehr durch Strenge, sondern durch Güte zur Umkehr bewegt werden.
Trotz einiger Versuche zur Erneuerung der G. im 19. Jh., unter anderem durch Fr. → Schleiermachers Überlegungen zur Kirchenverfassung, verlor sie mit fortschreitender → Säkularisierung im 19. und 20. Jh. weiter an Bedeutung. Zwar rückten Vertreter der Bekennenden Kirche (D. → Bonhoeffer, G. → Ebeling u.a.) und auch einige ev.-landeskirchl. Gemeinden in der DDR die G. zeitweilig wieder in den Fokus theol. Überlegungen, die akadem. Auseinandersetzung mit dieser Thematik kam allerdings inzw. wieder zum Erliegen.
In Zeiten zunehmender Pluralisierung der Gesellschaft, offener werdender Grenzen zw. Kirchengemeinden, Gemeinschaften und freikirchl. Gemeinden sowie zurücktretender Bedeutung der Bindung an eine Gemeinde scheint das überlieferte Verständnis von G. kaum noch vermittelbar. Viele Landeskirchen in Deutschland stehen den einstigen Formen der G. heute skeptisch gegenüber. Die Evangelische Kirche im → Rheinland strich die Kirchenzucht 1996 ersatzlos aus ihrer Kirchenordnung, da die Kirche nicht das Recht habe, Menschen vom Abendmahl auszuschließen. Infolge dieser Entwicklung entstanden (v.a. in den USA) neue Erweckungsbewegungen und kirchl. Gemeinschaften, in denen die G. weiterhin eine wesentliche Rolle spielt, wie in vielen → Freikirchen auch in Deutschland noch. Auch in den Kirchen Asiens und Afrikas wird G. heute vielerorts sehr ernst genommen. Sie dient der Abgrenzung zu trad. rel. Riten und der Schlichtung von Streitigkeiten innerhalb der Gemeinden.
Lit.: G. Ebeling: Kirchenzucht, 1947; Eingeladen sind alle. Warum die Kirche nicht vom Mahl des Herrn ausschließen darf. Beschluss der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 15.1.2004, ÖR 53/2004, 248-266; H. Schilling (Hg.): Kirchenzucht und Sozialdisziplinierung im frühneuzeitlichen Europa, 1994; A. Schönherr: Kirchenzucht, 1967.
S. Poppe
III. systematisch-theologisch
G., in luth. und ref. Tradition auch Kirchenzucht genannt, hat ihren Grund in der in Jesus Christus erschienenen »rettenden Gnade Gottes« (Tit 2,11-14), welche die Gemeinde und ihre einzelnen Glieder dahingehend »in Zucht« (Tit 2,12, Luther 1984) nimmt, dass sie sich zu Jesus Christus mit Wort und Tat bekennen. Die G. ist eine Gestalt und notwendige Folge des Evangeliums, da es ihr um die Integrität der christl. Gemeinde als Leib Jesu Christi (1Kor 10,16f), um den Gehorsam des Glaubens und um die Chance zur Umkehr für die Betroffenen geht. Als Gestalt des Evangeliums tritt die G. zur Verkündigung des Wortes Gottes und der einsetzungsgemäßen Feier von Abendmahl und Taufe (vgl. CA VII; → Augsburger Bekenntnis) als Zeichen ( notae ), an denen man die Kirche Jesu Christi erkennen kann, hinzu (vgl. Confessio Scotica, 1560). Die G. soll vermeiden, »daß während die Frommen schlafen, die Gottlosen voranschreiten und der Kirche Verderben bereiten« (Zweites Helvetisches Bekenntnis, Art. 18). Daher kann G. zu einem Akt prophetischer Seelsorge werden, zum Wächterdienst »über das Haus Israel« (Hes 3,17ff).
Der G. geht es um die Korrespondenz von »Glaube und Gehorsam« (vgl. These 3 der → Barmer Theologischen Erklärung) und um die Integrität, welche die Gemeinde in die Lage versetzt, nach außen als Alternative zur Gesellschaft in Erscheinung zu treten. G. ist Ermahnung und Abweisung solcher Gemeindeglieder, die trotz seelsorglichen Bemühens in Irrlehre, Irrglaube und einer nicht evangeliums- und schriftgemäßen Lebensführung gegen Gott verharren. Dabei steht die G. im »Dienst der Gnade«, um das »Leben des Sünders zu retten« (A. → Schlatter). Die ntl. Belege zeigen, dass die G. primär die Lebensordnung der Gemeinde und die Lebensführung ihrer einzelnen Glieder zum Gegenstand hat (1Kor 5,5; 1Tim 5,10f; 2Tim 2,21). Die Normen und Werte, die in der von Hl. Geist hervorgebrachten Gemeinschaft gelehrt werden, sollen auch tatsächlich gelebt werden.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «ELThG² - Band 2»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «ELThG² - Band 2» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «ELThG² - Band 2» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.