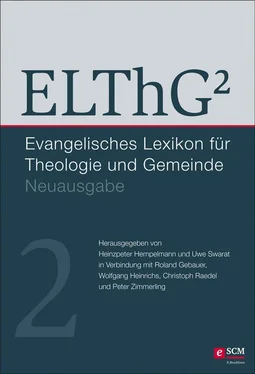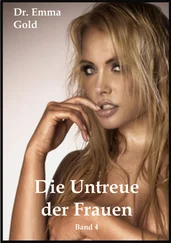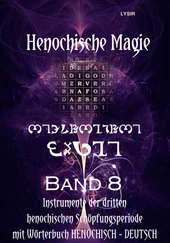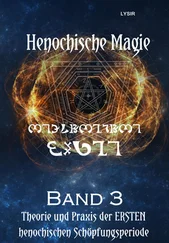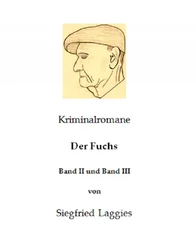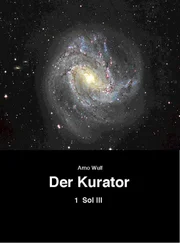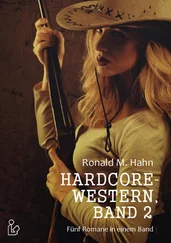Das jüngste Interesse an G. setzt bei der Frage nach der Berufstheorie an. Für die Studierenden der neu eingerichteten Studiengänge der G. an den theol. (Fach-)Hochschulen ist ein reflektiertes Berufsprofil zu formulieren, das die Spezifika dieses Berufs – im Unterschied zum Pfarrberuf und einem sozialdiakon. Profil – deutlich macht. Nach einer ersten Euphorie, in der der Begriff schnell Verbreitung gefunden hat, muss mittlerweile krit. gesagt werden, dass die Berufsbezeichnung Gemeindepädagoge/-in weitgehend nur in den neuen Bundesländern Verbreitung gefunden hat und von den theol. Fachhochschulen nur noch die Internationale Hochschule Liebenzell einen reinen G.-Studiengang anbietet, während G. an anderen Hochschulen in einen Studiengang Religionspädagogik integriert (Berlin, Freiburg, Ludwigsburg, Moritzburg) oder mit dem Schwerpunkt → Soziale Arbeit verknüpft ist (Bochum, Darmstadt, Kassel).
Quellen: P. Bubmann: Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen, in: B. Mutschler / G. Hess (Hg.), Gemeindepädagogik, 2014, 45-61; M. Herbst: Bildsame Mission – Missionarische Bildung?, in: ders. (Hg.): Zeitumstände. Bildung und Mission, 2009; E. Lange: Kirche für die Welt, 1981; K.E. Nipkow: Bildung als Lebensbegleitung und Erneuerung, 1990; P. Zimmerling: Ein Leben für die Kirche. Zinzendorf als Praktischer Theologe, 2010.
Lit.: G. Adam / R. Lachmann (Hg.): Neues Gemeindepädagogisches Kompendium, 2008; P. Bubmann u.a. (Hg.): Gemeindepädagogik, 22019; A. Mauerhofer: Pädagogik auf biblischer Grundlage, 2009; M. Printz: Grundlinien einer bibelorientierten Gemeindepädagogik, 1996.
M. Printz
Unter Gemeindeprinzip (G.) versteht man einen Grundsatz innerhalb des ev. → Kirchenrechts, durch welchen das Verhältnis der Einzelgemeinde zur Gesamtkirche in bestimmter Weise geordnet wird. Gemäß diesem Prinzip baut sich die überörtlich organisierte → Kirche von den Einzelgemeinden her auf, also »von unten nach oben«. Das gegenteilige Modell ist das Kirchenprinzip, das die Gesamtkirche »von oben nach unten« strukturiert, weil es davon ausgeht, dass die Einzelgemeinden Untergliederungen oder Verwaltungsbezirke der Gesamtkirche sind. Das Kirchenprinzip widerspricht jedoch einem recht verstandenen ev. Kirchenverständnis.
Kirche ist nach den Bekenntnissen der Reformation die Schar der »heiligen Gläubigen«, »die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören« (M. Luther, Schmalkaldische Artikel III,12) bzw. jene auserwählte Schar, die der Sohn Gottes durch seinen Geist und sein Wort versammelt, schützt und erhält (Heidelberger Katechismus, 54. Frage). Kirche ist somit eine schlechthin universale und die Zeiten übergreifende geistl. Wirklichkeit, die Gegenstand des Glaubens ist. Sichtbar wird sie dort, wo das → Wort Gottes lauter gepredigt und gehört wird und die → Sakramente nach der Einsetzung Christi verwaltet werden (CA VII). Für ev. Ekklesiologie ist unter der sichtbaren Kirche also zunächst und v.a. die örtliche Gottesdienstgemeinde und nicht eine überörtliche Organisation zu verstehen. Kirchenrechtlich folgt daraus das Gemeindeprinzip.
Die aus der Reformation hervorgegangenen Landes- und Staatskirchen wurden allerdings meistens nicht von den Ortsgemeinden her aufgebaut. Nur dort, wo ev. Gemeinden sich unter obrigkeitlicher Verfolgung organisieren mussten, bekam das Gemeindeprinzip eine Chance und zeigte auch seine Kraft. In den luth. und ref. Landeskirchen Deutschlands begann man aber im Laufe des 19. Jh.s, sich auf die geistl. Würde und Mündigkeit der Gemeinden zu besinnen, und veränderte die Kirchenverfassungen schrittweise in diese Richtung. Heute ist das Gemeindeprinzip allgemein anerkannt, wird aber unterschiedlich angewendet. Die luth. Kirchen betonen gewöhnlich stärker die Rechte der überörtlichen Einrichtungen, die ref. Kirchen stärker die Autorität der Gemeinden.
Es gibt Stimmen, die nicht nur das Kirchenprinzip, sondern auch das G. für ungeeignet halten und an deren Stelle »eine dynamische Verhältnisbestimmung von Gemeinde und Gesamtkirche« setzen wollen (H. Frost, Strukturprobleme evangelischer Kirchenverfassung, 1972, 33). Dabei wird das G. einseitig in die Richtung interpretiert, dass die Gesamtkirche ein bloßer Zweckverband sei, durch den die Einzelgemeinden Aufgaben erledigen, die sie allein nicht bewältigen können. Wenn Einzelgemeinden stark genug sind, könnten sie demnach auf die Gesamtkirche auch verzichten. Ein solcher Independentismus der Einzelgemeinde ist häufig in der Ekklesiologie von → Freikirchen vertreten worden, beruht aber auf einem theol. Missverständnis der Selbstständigkeit der Einzelgemeinde. Die Einzelgemeinde ist zwar ganz und gar Kirche, aber sie ist nicht die ganze Kirche. Die eine Kirche Jesu Christi verwirklicht sich in einer Vielzahl von Einzelgemeinden, die erst miteinander die ganze Kirche abbilden. Jede Einzelgemeinde verkörpert unmittelbar die unsichtbare Wirklichkeit der universalen Kirche Christi, aber nur so lange, wie sie sich als Teil eines Ganzen versteht. Auch die Gesamtkirche ist eine Verkörperung der universalen Kirche. Das Selbstverständnis der Einzelgemeinden als Teilgemeinden verlangt den Aufbau verbindlicher Strukturen einer Gesamtkirche, z.B. → Synoden. Im G. ist also auch das theol. Recht einer Gesamtkirche begründet.
Lit.: M. Rauhaus: Das kirchenrechtliche Gemeindeprinzip und seine Auswirkungen auf die kirchliche Verfassungsgestaltung, 2005; A. Schilberg: Kirchengemeinden und Landeskirche, ZEvKR 55/2010, 92-100; U. Swarat: Der Gemeindebund – mehr als ein Zweckverband? ThGespr 2001, Beiheft 2, 3-32; H. de Wall / St. Muckel: Kirchenrecht, 4., überarb. Aufl. 2014, 286f; A. Weiss: Kirchenrecht der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und ausgewählter evangelischer Freikirchen, 2012, 179f.
U. Swarat
Gemeindetag unter dem Wort
Der Gemeindetag (G.) unter dem Wort war eine seit 1973 in unregelmäßigen Abständen durchgeführte Großveranstaltung, die als »erweckliches Glaubenstreffen« (Aufruf zum ersten G.) zur Christusnachfolge und zum gesellschaftl. und missionar. Engagement ermutigen, die größere christl. Gemeinschaft vor Augen führen und bibl. Antworten auf Zeit- und Lebensfragen aufzeigen sollte. Die G.-Mottos reflektierten den Christusbezug: »Alles gehört euch – ihr gehört Christus« (1978), »Aufsehen zu Jesus« (1989) u.Ä. Als bewusste Alternative zu dem seit den 1960er-Jahren zunehmend polit.-sozialkrit. und pluralistisch ausgerichteten Deutschen Ev. → Kirchentag erreichte der G. in den späten 70er- und 80er-Jahren Besucherzahlen zw. 50 000 und 60 000 und zählte zahlreiche Persönlichkeiten aus dem konservativ-prot., pietist. und freikirchl. Raum zu seinen Mitwirkenden.
Angeregt von P. → Deitenbeck, fand der erste G. mit 24 000 Besuchern am 31.5.1973 in der Dortmunder Westfalenhalle statt, wo 1934 der rheinisch-westfälische Gemeindetag »Unter dem Wort« der entstehenden Bekennenden Kirche und 1966 die Großkundgebung der → Bekenntnisbewegung »Kein anderes Evangelium« stattgefunden hatten, zwei Ereignisse, an die man – neben den Kirchentagen der Nachkriegszeit – anknüpfen wollte. Aus der Bekenntnisbewegung heraus entstanden, entwickelte sich der G. vom Charakter her zu einer Veranstaltung der Ev. → Allianz. Federführend waren u.a. R. Bäumer und R. Scheffbuch, die beide auch für eine Zeit dem Trägerkreis des G. vorstanden.
Neben einigen regionalen G.en hat es elf deutschlandweite G.e gegeben, zwei in Dortmund (1973, 1977 [mehrtägig]), einen in Essen (1984), einen in Siegen (1994) und sieben in Stuttgart (1975, 1978, 1982, 1985, 1989, 1992, 2002), wo man nicht nur mit einem entspannten Verhältnis zur Landeskirche und viel Resonanz im schwäbischen → Pietismus rechnen, sondern auch auf die jährlich an Fronleichnam durchgeführte Ludwig-Hofacker-Konferenz (seit 1996 Christustag) aufbauen und sie zum G. ausweiten konnte. Die Stuttgarter G.e fanden 1975, 1982 und 1989 im Neckarstadion, sonst im Messezentrum Killesberg (mit Teilkonferenzen in verschiedenen Hallen und einer Schlusskundgebung) statt. Dabei präsentierten sich auch freie christl. Werke und christl. Buch- und Musikverlage.
Читать дальше