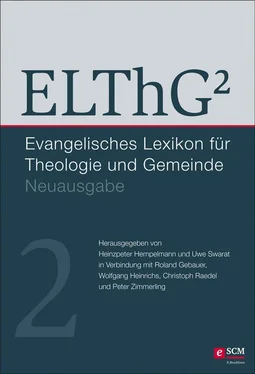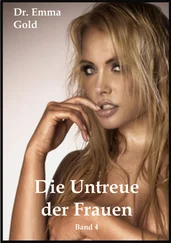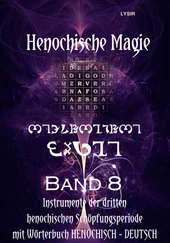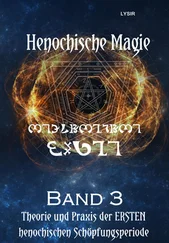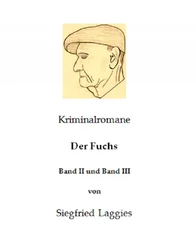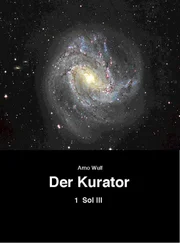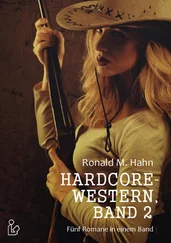In der Gegenwart geht es um die Fragen von Freiwilligkeit und Verbindlichkeit, Spontaneität und Verlässlichkeit um der Planungssicherheit willen. Kann die Verantwortung des Einzelnen für das Ganze verbindlich eingefordert werden? Umgekehrt liegt bei den Empfängern des G.s die Verantwortung für den Einsatz der Mittel. Die Ausgangsfrage im NT nach einem Ausgleich zw. reichen und armen Gemeinden ist heute nach wie vor von Bedeutung – innerhalb von Gemeindeverbänden bzw. kirchl. Zusammenschlüssen ebenso wie über diese hinaus.
Lit.: St. Stiegler: Der biblische Zehnte als Hintergrund freikirchlicher Gemeindefinanzierung, ThGespr 28/2004, 47-62.
J. Zimmermann
Der Sammelbegriff G. bezeichnet unterschiedlichste, periodisch erscheinende Druckwerke einzelner Gemeinden bzw. deren regionaler Zusammenschlüsse. Format und Umfang reichen von handgeschriebenen und vervielfältigten Briefen des Pfarrers an seine Gemeinde bis hin zu mehr als 40-seitigen → Zeitschriften. Die Entstehung des G.s ist wesentlich durch die Neuordnung der ev. → Publizistik nach 1945 bestimmt, wenngleich Vorläufer bereits durch die ev. Briefliteratur und die technischen Entwicklungen der Reformationszeit und während der Industrialisierung entstanden. Die Publikationen über den G. beschäftigen sich zumeist mit prakt. Hinweisen zur Gestaltung, weit weniger mit der Theoriebildung. Durch die Ästhetisierung und Digitalisierung seit der Jahrtausendwende haben die einzelnen G.e in der Gestaltung an publizistischer Qualität stark gewonnen, fordern aber von der Herstellung auch einiges mehr ab. Eine Zweitverwertung findet nicht nur in den Schaukästen, sondern crossmedial auf Homepages bzw. als Download statt.
Als Basismedium ist der G. insgesamt das reichweitenstärkste Medium innerhalb der christl. Gemeinde und wird weder qualitativ noch quantitativ von anderer nichtpersonaler Kommunikation übertroffen (→ Medien / Medienarbeit). Als internes Kommunikationsmittel bezweckt er v.a. Teilhabe an und Information über das Leben der Gemeinde. Demzufolge sind typischerweise die Rubriken »Geistliches Wort«, »Gottesdienst-/Veranstaltungsplan« sowie »Freud – Leid« zu finden. Weitere gemeindespezifische thematische Schwerpunkte ergänzen den Gemeindebrief. Er wird deswegen häufig als Visitenkarte der Gemeinde bezeichnet. Die Einbeziehung eines externen Adressatenkreises durch Aufnahme kirchenfremder Themen, Ausweitung der Zustellung/Verteilung auf gemeindefremde Personen im Einzugsbereich oder Eingliederung des G.s in kommunale Amtsblätter wird noch nicht lange praktiziert.
Redaktionell am häufigsten durch die Pfarrperson, eine weitere Mitarbeiterin und wenige Ehrenamtliche verantwortet, gelingt dem G. die Vermittlung christl. Glaubens und christl. Lebensdeutung in glaubwürdiger, weil offener und dialogisch angelegter Weise. Bei der Leserschaft wirbt er um Vertrauen und Verständnis für die örtliche Gemeinde, informiert über aktuelle gemeindlich und gesellschaftlich relevante Fragestellungen und Problemlagen, legt Rechenschaft über Entscheidungen gemeindeleitender Gremien und über die Verwendung finanzieller Mittel ab.
Lit.: R. Gertz: Medium mit großer Reichweite, 2005; Chr. Klenk / Th. Rinklake: Mitgliedermagazine mit Millionenauflage, ComSoc 47/2014, 229-243.
Fr. Pauli
Gemeindediakon/-in → Diakon/-in
Die Gründung von Gemeinden ist ein im NT viel bezeugtes Phänomen: Das Evangelium wird verkündigt, Menschen kommen zum Glauben, versammeln sich als Gemeinde und ordnen ihr gemeinschaftliches Leben. Die Erzählungen der → Apostelgeschichte berichten, dass von der Urgemeinde Jerusalem ausgehend viele Gemeinden entstanden sind. Auch der Apostel Paulus begegnet uns als Gemeindegründer. In der weiteren Missions- und Kirchengeschichte kommt es zu entsprechenden G.en weltweit, sodass die Gründung von Gemeinden bzw. → Kirchen ausdrücklich zum Ziel missionar. Handelns erklärt wurde. So beschrieb Gisbert → Voetius (1589–1676) Mission als einen Dreischritt, der die → Bekehrung der Heiden ( conversio gentilium ) sowie die Pflanzung der Kirche ( plantatio ecclesiae ) umfasst und die Ehre und die Manifestation der Gnade Gottes ( gloria et manifestatio gratiae divinae ) zum Ziel hat.
Im 20. Jh. war es v.a. die → Gemeindewachstumsbewegung, die die Gründung von Gemeinden als wichtigste Missionsstrategie darstellte. Neue Gemeinden entstehen, indem sich alte teilen und dann weiterwachsen, oder indem Christen für die Gründung einer neuen Gemeinde entsandt werden.
In den 1980er-Jahren kam es zu einer Vielzahl von G.en, die v.a. das Wachstum freikirchl., z.T. vollkommen autonomer Gemeinden begründeten. Seit 1983 besteht u.a. die »Konferenz für Gemeindegründung«, die sich die Gründung »bibeltreuer Gemeinden« zur Aufgabe gemacht hat. Die verschiedenen klass. → Freikirchen wie → Baptisten und der → Bund Freier evangelische Gemeinden betreiben G.en als einen eigenen Arbeitszweig. Der Versuch, diese Entwicklung nach der Wende auch in den neuen Bundesländern fortzuführen, stieß allerdings an Grenzen.
Innerhalb des → Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes kam es in den 1990er-Jahren zu Diskussionen über das eigene Gemeindeverständnis, wobei auch die Gründung von Gemeinden außerhalb der Volkskirche heftig diskutiert wurde. Hier zeigte sich die Spannung zw. einem neuen Sendungsbewusstsein und einer innerkirchl. Verortung. Eine vergleichbare Diskussion ergab sich in der Geistlichen Gemeindeerneuerung (GGE) durch den Kirchenaustritt von W. Kopfermann und die Gründung der → Anskar-Kirche 1988.
Auch in den ev. Landeskirchen wird in zunehmender Weise über die Gründung von neuen Gemeinden nachgedacht. Hier werden die Erfahrungen der anglikan. Kirche (→ Anglikaner) aufgenommen, indem man von Gemeindepflanzung ( church planting ) und mittlerweile von fresh expressions of church (fresh X) spricht. Gerade im Rahmen eines kontextbezogenen oder lebensweltorientierten Ansatzes kommt der Entstehung von neuen Gemeinden im Sinne von Personal- oder Profilgemeinden Bedeutung zu. Hier wurden auch kirchenrechtl. Möglichkeiten geschaffen, dass neben den Parochialgemeinden (→ Parochie) weitere Gemeindemodelle entstehen können. Im Rahmen eines Aufbruchs in die Missionskirche wird es somit nicht nur um Gemeindeerneuerung, sondern auch um neue Formen von Kirche gehen. Ziel ist heute »die Begründung neuer Ausdrucksformen gemeindlichen Lebens« (M. Herbst, Kirche mit Mission, 2013, 79). G.sinitiativen werden aber auch krit. diskutiert. Zum einen wird gefragt, inwieweit ein missionar. Effekt erzielt wird und ob nicht nur eine Umverteilung passiert ( sheep-stealing ; Konvertitenmacherei). Zum anderen stehen die i.d.R. personalgemeindlichen Organisationsformen in Spannung zum ortsgemeindlichen parochialen Prinzip (Hempelmann).
Oftmals jenseits dieser Strukturen und Diskussionen sind es Christen in pfingstlicher oder charismat. Tradition, die Gemeinden gründen und mit Blick auf die Praxis von → Migrantengemeinden eine » reverse mission « im vormals christl. Westen praktizieren. Auch im Rahmen der Diskussion um ein ganzheitliches, sog. missionales Missionsverständnis wird zur Gründung von Gemeinden aufgerufen, die sich postmodern bzw. kulturorientiert geben und sehr unterschiedliche Gemeinschafts- und Kommunikationsstrukturen aufzeigen (→ Missionale Kirche/Theologie).
Mit der Gründung von Gemeinden unterschiedlichster Größe stellt sich die Herausforderung, zw. Fragmentierung und Uniformität einen Weg zu finden, auf dem die Einheit der einen christl. Kirche in der Vielfalt ihrer kontextuellen Ausprägungen zum Tragen kommt. Weder eine kirchl. Monopolisierung noch eine Zerrsplitterung in Kleinstgemeinden stellen sinnvolle Wege dar. Vielmehr geht es um eine Ausrichtung am missionar. Auftrag von Kirche, in den verschiedenen Lebensbezügen und -welten das Evangelium zu bezeugen, Menschen zum Glauben einzuladen und diese unter dem Wort zu sammeln. Angesichts einer Privatisierung des Glaubens geschieht dies unter Berücksichtigung des Öffentlichkeitscharakters des Evangeliums, was nur in ökum. Verbundenheit erfolgen kann.
Читать дальше