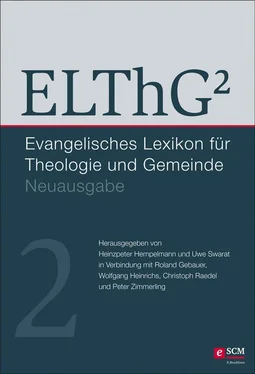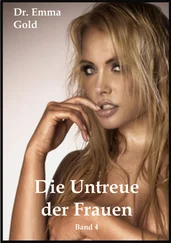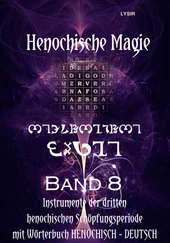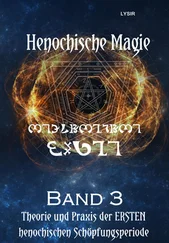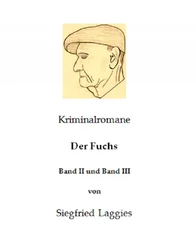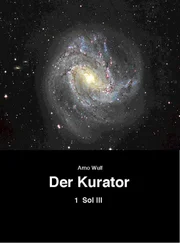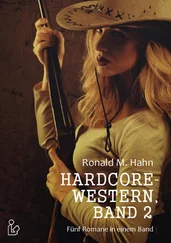J. Zimmermann
Unter einem G. versteht man eine Verbindung von Bauten, Räumen und Einrichtungen einer Kirchengemeinde (Gemeindehaus, Pfarrhaus, Kindergarten, Gruppen- und Verwaltungsräume), in die der Gottesdienstraum mit eingeschlossen ist. Das Gemeindehaus ist vom G. zu unterscheiden; es ist normalerweise ein Haus für die Gruppen und Kreise der Gemeinde, umfasst aber im Gegensatz zum G. keinen Gottesdienstraum. Der Begriff Gemeindehaus ist älter und geht auf E. Sulze zurück.
Als zu Beginn der Kirchengeschichte Privatpersonen ihre Häuser für die Versammlungen der Gläubigen zur Verfügung stellten (→ Hausgemeinden), wurden in diesen Räumen auch gemeindlich-diakon. Funktionen wahrgenommen. Die spätere Basilika indes war einzig für den öffentl. Gottesdienst bestimmt, während andere Funktionen in Baptisterien, Memorien, Mausoleen etc. ausgelagert waren. Doch auch in altkirchl. Zeit gab es an zentralen Orten kirchl. Anlagen von großem Ausmaß, die als funktional ausdifferenzierte Kirchenzentren angesehen werden können (z.B. Hippo Regio in Nordafrika, Salona in Italien).
Auch mittelalterl. Klosteranlagen vermochten die Ausmaße einer kleinen Stadt annehmen (z.B. St. Gallen). Das kirchl. Bauen im MA und nachfolgend bis zum Ende des 19. Jh.s beschränkte sich aber weitgehend auf Kirchengebäude und Pfarrhaus (→ Kirchenbau). Dabei muss bedacht werden, dass der herausgehobene Kirchenraum – die Stadtkirche oder die Kathedrale – auch für nicht-gottesdienstliche Begebenheiten und Ereignisse (Mysterienspiele, Prozessionen, Gerichtsverhandlungen u.v.a.) genutzt wurde.
Gleichwohl diente das Kirchengebäude über Jahrhunderte ausschließlich dem Gottesdienst, obgleich bspw. im ev. Bereich die Sonntagspredigt über die Verkündigung im engeren Sinn hinaus zugleich »Nachrichtendienst« und »Bildungsveranstaltung« war. Mit der Veränderung der Wohn- und Arbeitswelt und dem Bedürfnis nach Kommunikation und Bildung wuchs die Notwendigkeit, auch unter der Woche für spezifische Gruppen und Kreise Angebote zu machen. So entstanden im 19. Jh. die ersten Gemeindehäuser und Vereinshäuser christl. Gemeinden und Gemeinschaften. Die Kirchenbauten um die Wende vom 19. zum 20. Jh. bergen unter ihrem Dach Gemeindesaal und Gruppenräume und oft auch die Wohnräume für Pfarrer, Küster und die Gemeindeschwester. Wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung hatten der Dresdener Pfarrer E. Sulze, der Begründer der »Gemeindebewegung«, und der Architekt O. March mit seiner Idee vom »Gruppenbau«.
Beim Wiederaufbau und Neubau nach dem Zweiten Weltkrieg hielt man am Modell Kirche, Gemeindehaus, Pfarrhaus fest. In den neu entstandenen Satellitenstädten, die die Kirche als Institution vor über das Herkömmliche hinausgehende Aufgaben stellte, entstand das G. als neuer Gebäudetyp. Der Gottesdienstraum wird dabei oft nicht eigens hervorgehoben, sondern ist Teil des aus mehreren Gebäudeteilen bestehenden Ensembles. In den 1970er-Jahren meinte man vereinzelt, auf einen eigenen Gottesdienstraum verzichten und ihn durch einen Mehrzweckraum ersetzen zu können. Diese wurden inzw. mehrheitlich »resakralisiert«.
Seit den 1980er-Jahren stellte sich als Problem, dass der kirchl. Baubestand aufgrund zurückgehender Mitglieder-und Gottesdienstbesucherzahlen viel zu groß wurde. Auch finanziell war eine Erhaltung des Baubestands nicht mehr zu leisten. Anstatt Kirchen vollständig aufzugeben, kam es seitdem häufig zu Umnutzungen von Kirchen zu kulturellen und sozialen Zwecken (Kirche als Museum, Konzertsaal, Kommunikationsstätte etc.). Übergroße Kirchenräume des 19. Jh.s wurden durch Einbauten, über Horizontal- und Vertikalunterteilung zu Gemeindezentren (= G.n) umgewidmet (z.B. Heilig-Kreuz-Kirche, Berlin). Von Vorteil war, dass damit die kirchl. Präsenz unter einem Dach gebündelt wurde; sonstige kirchl. Gebäude wie das Gemeindehaus konnten aufgegeben werden.
Bei Freikirchen, deren erste kirchl. Gebäude reine Kapellen waren, entstanden ab den 1950er-Jahren ebenfalls G.n als multifunktionale Gebäude um den Gottesdienstsaal herum. Seit den 1980er-Jahren werden dazu in der Regel große Foyers gebaut, oft mit Kirchencafés, Büchertischbereichen und Garderoben. Regelmäßig enthalten freikirchl. G.n viele Gruppenräume und z.T. professionelle Küchen.
Eine Sonderform des G.s stellt – von England und den Niederlanden ausgehend – das ökum. G. dar. Sein Ort sind v.a. Satellitenstädte, wobei die ev. und kath. Kirchengemeinden als getrennte oder gemeinsame Bauherren auftreten. Meist haben die ökum. G.n getrennte Gottesdiensträume, während die sozialdiakon. Funktionen vor Ort gemeinsam wahrgenommen werden. Aufgrund ihrer anspruchsvollen Gestaltung wurden einige ökum. Zentren sogar mit Architekturpreisen bedacht (Freiburg-Rieselfeld, München-Riem; vgl. → Kirchenbau, Abb. 19-21).
Lit.: A. Büchse u.a. (Hg.): Kirchen. Nutzung und Umnutzung, 2012; J.G. Davies: The Secular Use of Church Buildings, 1968; M. Görbing / H. Graß / H. Schwebel: Planen, Bauen, Nutzen. Erfahrungen mit Gemeindezentren, 1981; G. Hagmann: Ökumenische Zusammenarbeit unter einem Dach, 2007; H. Schwebel / M. Ludwig (Hg.): Kirchen in der Stadt, 2 Bde., 1994/96; W. Weyres u.a.: Kirchen. Handbuch für den Kirchenbau, 1959.
H. Schwebel (in Überarbeitung des Artikels von G. Memmert in der 1. Aufl.)
I. biblisch
G., häufig auch »Kirchenzucht« genannt, erwächst bibl. gesehen aus dem Umgang Gottes mit seinem Volk: »Zucht« soll nicht zum Verderben, sondern zur Umkehr führen (Jer 10,24; 30,11). Zucht ist also eine »Erziehungsweise« Gottes für sein Volk. Entsprechend »erzieht« die in Christus erschienene heilsame Gnade Gottes (Tit 2,11f) dazu, ein Leben »würdig des Gottes« zu führen, der die Glaubenden »zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit« berufen hat (1Thess 2,12).
Im NT sind es v.a. zwei Motivkreise, die mit der G. verbunden werden:
1. Das Motiv der Heiligkeit und Reinheit der Gemeinde
Auf der einen Seite ist es die Heiligkeit bzw. Reinheit der Gemeinde. Es geht um die Zugehörigkeit zu Gott, die Gemeinde ist Gottes Eigentum und deshalb heilig (Eph 5,25ff; → Heilig / Heiligkeit). Die Erwählung durch Gott führt zur Absonderung. Deshalb können Einstellungen, Verhaltensweisen und Lehren, die dem heiligen Gott und dem Evangelium nicht gemäß sind, nicht zugelassen werden. So wird in 2Kor 6,14-18 die Verheißung, dass Gott unter seinem Volk wohnen wird, zur Aufforderung zur Absonderung von allem Unreinen: »Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen!« Ähnliche Motive sind in Apg 5,1-11 und 1Kor 5,5-11 zu finden.
2. Das Motiv der Seelsorge
Der zweite Motivkreis ist der Aspekt der → Seelsorge. In Mt 18,15-20 wird ein Weg der G. in mehreren Schritten beschrieben. Das Ziel ist es, dem Bruder bzw. der Schwester einen Weg der Umkehr zu eröffnen, der ihn/sie im Glauben und in der Zugehörigkeit zu Christus und zur Gemeinde erhält und stärkt. Das Motiv dabei ist die → Liebe, die den Verlorenen nachgeht (Mt 18,12-14) mit dem Ziel, ihn zu gewinnen. Selbst schärfste Maßnahmen bis hin zum Ausschluss aus der Gemeinde zielen noch auf Umkehr und Rettung (2Thess 3,14f; 1Kor 5,5). Der Betroffene soll nicht als Feind, sondern als Bruder zurechtgewiesen werden (2Thess 3,15).
3. Herausforderungen für die Gegenwart
Der Blick auf die Gemeinde und ihre Berufung (s. 1.) und der seelsorgliche Blick auf den Einzelnen (s. 2.) sind zwei Perspektiven der G., die einander ergänzen, aber auch in Spannung zueinander geraten können. Die Grenze der Seelsorge liegt dort, wo Sünde nivelliert wird; die Grenze auf der anderen Seite dort, wo das Ideal der reinen Gemeinde dazu führt, das jüngste Gericht vorwegzunehmen bzw. wo nicht mehr im Blick ist, dass Christen auf dieser Welt bleibend auf Gottes Vergebung angewiesen sind. Ein sachgemäßer Umgang mit den bibl. Aussagen zur G. besteht nicht in ihrer unmittelbaren und damit unreflektierten Anwendung auf heutige Fälle, sondern in einem Weiterführen der mit ihnen verbundenen Anliegen. Soweit in der Gegenwart G. überhaupt noch im Blick ist, dominiert der Aspekt der Seelsorge. Dabei sind aber die Fragen, was es für das Leben des Einzelnen und der Gemeinde insgesamt bedeutet, Gottes Eigentum zu sein, bzw. nach außen gerichtet die Frage nach dem Lebenszeugnis der Gemeinde keineswegs erledigt.
Читать дальше