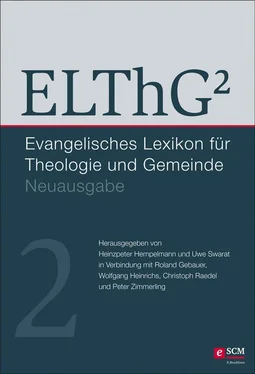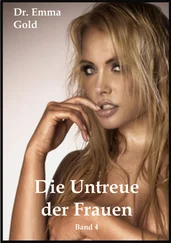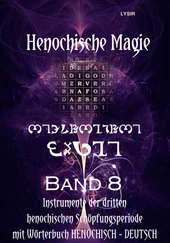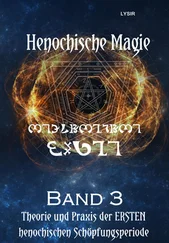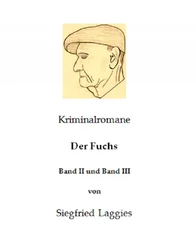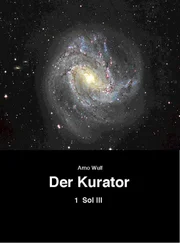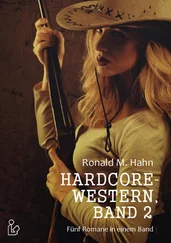4. 1997 erklärten die sieben methodist. Kirchen in Europa (→ Methodisten) auf der Grundlage einer Gemeinsamen Erklärung Kirchengemeinschaft mit den Unterzeichnerkirchen der LK. Dies bestätigte den Anspruch der LK als ökum. Modell, das auch im Dialog mit anderen Konfessionen anwendbar sei (→ Dialoge, ökumenische). Gespräche der GEKE mit den europ. → Baptisten führten aber bislang nur zu einer Kooperationsvereinbarung (2010), weil kein Konsens über die Taufpraxis erzielt werden konnte. Auch in Gesprächen mit der röm.-kath. Kirche und den orth. Kirchen zeigt sich, dass das Modell der LK als Weg zur ökum. Gemeinschaft dort als noch nicht ausreichend betrachtet wird.
Lit.: M. Bünker / M. Friedrich (Hg.): Konkordie reformatorischer Kirchen in Europa (Leuenberger Konkordie), 2013; U. Hahn / W. Hüffmeier (Hg.): Evangelisch in Europa. 30 Jahre Leuenberger Kirchengemeinschaft, 2003; Leuenberger Texte, 1995ff (Buchreihe).
M. Friedrich
1. Begriff und heutige Gestalt
Der Begriff »Gemeinschaften« charakterisiert Vereinigungen von Christen in den vom → Pietismus geprägten Erweckungsgebieten. Der Begriff wird seit den 1880er-Jahren verwendet und meint die Zusammenschlüsse ev. Christen (Theologen und Laien), die sich als Erneuerer der Anliegen der → Reformation, des Barockpietismus und der → Erweckungsbewegung verstehen. Von Anfang an steht die Gemeinschaftsbewegung (G.) über ihre Protagonisten in internationalen Zusammenhängen und nimmt im Besonderen Impulse auf, die aus angelsächsischen Kontexten stammen (kongregationalistisches Gemeindeverständnis, missionar. Ekklesiologie).
Im Unterschied zur evangelikalen Bewegung stellt sich die G. seit ihren Anfängen (1887) als prinzipiell innerkirchl. Reformbewegung dar. Etwa 130 Jahre nach Gründung der Gnadauer Konferenz (1888; → Ev. Gnadauer Gemeinschaftsverband) umfasst die G. in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich und der Schweiz über 300 000 Mitglieder. Sie gliedern sich in 38 regionale Verbände (davon zwei in Österreich, einer in den Niederlanden), sechs Jugendverbände, elf Ausbildungsstätten (von Bibelschule bis Fachhochschule z.B. Pilgermission St. → Chrischona (Basel), Ev. Hochschule Tabor (Marburg), Evangelistenschule → Johanneum (Wuppertal-Barmen), Internationale Hochschule Liebenzell (Bad Liebenzell) sieben Missionsgesellschaften, 16 Diakonissenmutterhäuser, zehn Werke mit bes. Aufgaben (z.B. → Christlicher Sängerbund, Posaunenbund; Weißes, Blaues, Schwarzes Kreuz). Es bestehen enge Kontakte zu → Freikirchen, zur Ev. → Allianz wie zu evangelikalen Organisationen (→ Lausanner Bewegung, → Christlicher Medienverbund KEP], Hilfe für Brüder, Intervarsity Fellowship u.a.).
Das Bild der Gemeinschaften ist vielfältig. Neben Mitarbeit in landeskirchl. Gremien und Synoden gibt es Parallelstrukturen (Gemeinschaftsgemeinden) zu den Landeskirchen. Viele Gemeinschaftsleute beteiligen sich am missionar. → Gemeindeaufbau.
2. Entstehung und Geschichte
Entstanden ist die G. aus dem Zusammengehen unterschiedlicher geistl. Strömungen: Südwestdeutscher Pietismus (J.A. → Bengel; J.Chr. → Blumhardt d.Ä.), norddeutsche → Erweckungsbewegung (J.H. → Wichern, A. → Stoecker) und angelsächsische → Heiligungs- (R.P. → Smith) und Evangelisationsbewegung (D.L. → Moody, E. → Gebhardt) mit freikirchl. Hintergrund (Methodist Fr. von → Schlümbach). Ihre Vertreter verband das gemeinsame Bewusstsein, in der letzten Zeit vor der Wiederkunft Christi zu leben. Nachrichten über Erweckungen aus den Missionsgebieten in aller Welt förderten diese Einschätzung ebenso wie die Beobachtung der sich verschärfenden sozialen Gegensätze im Gefolge der sog. Industriellen Revolution. Die heilsgeschichtl. Deutung solcher und anderer »Zeichen der Zeit« im Rahmen einer lebendigen Endzeiterwartung förderte die Sammlungsbewegung. In ihr ging es darum, mit einer neuen Geistesausrüstung nach Joel 3 (Gaben der Endzeit) die Gläubigen zu sammeln (Gemeinschaftsgedanke) und das Evangelium im eigenen Land sowie in aller Welt auszubreiten (→ Evangelisation, → Glaubensmission).
Anknüpfen konnte die G. an bestehende Gruppen der sog. Stillen im Lande in trad. Erweckungsgebieten und Stammlanden des Pietismus mit Zentren in Württemberg (Altpietisten), am Oberrhein (Pilgermission St. Chrischona), im Siegerland (Reisepredigerverein), im Hessischen Hinterland, in Wuppertal (→ Ev. Gesellschaft für Deutschland), am Niederrhein (→ Gerhard-Tersteegen-Konferenz), in Hamburg (→ Rauhes Haus), Berlin (→ Berliner Stadtmission), Ostpreußen (Kukatianer), Schlesien, Pommern (Reichsbrüderbund) u.a. Weitere Anknüpfungspunkte lagen im Westdeutschen Komitee der Ev. → Allianz (seit 1880), der → Inneren Mission (seit 1848), der von J.Chr. Blumhardt angefangenen Heilungsbewegung (D. → Trudel und S. → Zeller in Männedorf, O. → Stockmayer in Hauptwil, J. → Seitz in Teichwolframsdorf u.a.), in der von England ausgehenden Zunahme heidenmissionar. Arbeit (→ Glaubensmissionen, → Missionsfeste) sowie in den Evangelisationen des dt.-amerik. Methodisten Fr. von → Schlümbach.
Den Anstoß zur Gründung gaben der Prof. für Prakt. Theologie Th. → Christlieb, der Jurist E. Graf von → Pückler, der Diplomat A. Graf von → Bernstorff, der Gutsbesitzer J. von → Oertzen und der erste bedeutende Evangelist in Deutschland E. → Schrenk. Formal ermöglicht wurde der Zusammenschluss durch ein neues Vereinsrecht in Preußen. Ihre organisatorische Sammlung fand die G. zuerst 1888 in der Gnadauer Konferenz, die seitdem alle zwei Jahre und ab 1906 jährlich abgehalten wurde. In der mehrtägigen Konferenz, die der Stärkung der Gemeinschaft wie der Klärung von Lehrfragen diente, wirken Theologen (Hochschullehrer, Pfarrer, Prediger, Evangelisten) und Laien zusammen. Für die verschiedenen Werke und Initiativen, die sich bildeten, wurde 1897 der »Deutsche Verband für Gemeinschaftspflege und Evangelisation«, später kurz »Gnadauer Verband« (GV) genannt (→ Evangelischer Gnadauer Gemeinschaftsverband), als Koordinierungsinstrument für die Arbeit der Landesverbände gegründet. Bis 1905 (zeitgleich zur Waliser Erweckung) machte sich bes. im Osten (Schlesien) unter der geistigen Führung von J. → Paul eine charismat. Heiligungsbewegung bemerkbar, in der verschiedene Vollkommenheitsstufen des Christenlebens bis hin zur Sündlosigkeit gelehrt wurden. Später kamen noch → Geistestaufe, → Glossolalie und Glaubensheilungen (→ Heilung) als Kennzeichen »wahrer« christl. Existenz hinzu. Verstärkt wurde diese rasch wachsende Bewegung innerhalb der G. durch die seit 1907 in Europa Fuß fassende → Pfingstbewegung.
Nach einem mühevollen Klärungsprozess schloss die Mehrheit der Leiter der G. zus. mit Vertretern der Ev. Allianz 1909 in der → Berliner Erklärung die Anhänger der Pfingstbewegung aus, die bes. im Osten des Deutschen Reiches schon eigene Organisationsstrukturen geschaffen hatten. Etwa ein Drittel der Mitglieder der G. ging damit den Weg in die Freikirche (→ Mülheimer Verband freikirchlich evangelischer Gemeinden) und schloss sich später der Weltpfingstbewegung an. Als es nach dem Ersten Weltkrieg um die Alternative → Freikirche oder → Landeskirche ging, entschied sich die Mehrheit des GVs für den Verbleib in der Landeskirche gegen starke freikirchl. Tendenzen. Maßgeblichen Anteil an dieser Entscheidung hatte, wie schon bei der Trennung der G. von der Pfingstbewegung, der langjährige Vorsitzende des GVs, Pastor W. → Michaelis (1866–1953).
Als nach 1933 viele der vornehmlich dt.-national orientierten Mitglieder der G. Anschluss an die »Glaubensbewegung Deutscher Christen« (→ Deutsche Christen) suchten, setzte Michaelis 1934 einen Unvereinbarkeitsbeschluss zw. Mitgliedschaft im GV und bei den Deutschen Christen durch. Einzelne Landesverbände und Organisationen trennten sich daraufhin vom Verband. Wie andere kirchl. Arbeit wurde auch die G. während der Zeit des Nationalsozialismus z.T. stark behindert. Bes. das Verbot der Konferenzen und der Zeitschriften (fast 100 »Gemeinschaftsblätter«) wirkte sich negativ aus.
Читать дальше