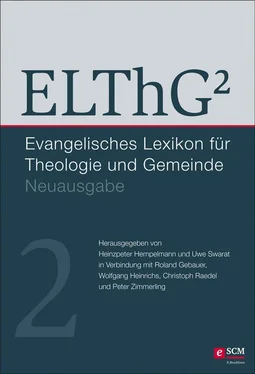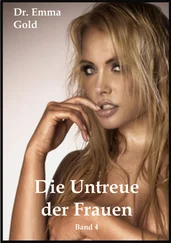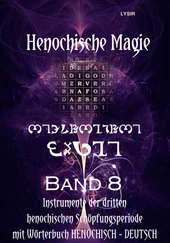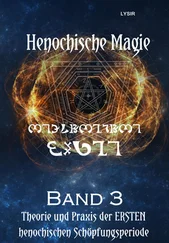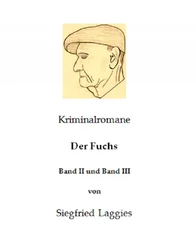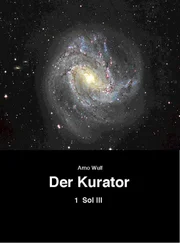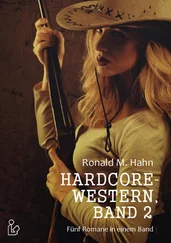Die Evangelische → Allianz in Deutschland ist mit ihren publizistischen Aktivitäten (insbes. Evangelische Nachrichtenagentur idea e.V. und ERF Medien e.V.) vom GEP unabhängig (→ Christlicher Medienverbund KEP e.V.; → Publizistik, christliche).
Lit.: O. Schulz: Freiheit und Anwaltschaft. Der evangelische Publizist Robert Geisendörfer, 2002.
R. Schmidt-Rost
Gemeinwohlprinzip → Sozialprinzipien
1. Die G. löst die noch vom Feminismus unbestrittene Differenz der biologischen Geschlechter radikal auf. Bei Judith Butler verschwindet das biologische Geschlecht (engl. sex ) im sozialen, kulturellen oder subjektiv gefühlten Geschlecht (engl. gender ). Ihre Hauptthesen lauten: Die zur Unterscheidung der Geschlechter angeführten biologischen Fakten sind in ihrer Beschreibung immer schon durch Rollenvorstellungen bestimmt, also nicht neutral; vorsprachliche Fakten gibt es nicht. Normativität kann niemals aus der Natur, immer nur aus der Kultur stammen. Erst das Verständnis der Heterosexualität als Norm führt zu einer binären Geschlechtswahrnehmung, also zur Unterscheidung von → Mann und → Frau. Andere geschlechtliche Möglichkeiten fallen aus. Wenn aber durchschaut wird, dass das Geschlecht die Folge einer unbegründeten Norm ist, verschwindet die Vorstellung vom »anderen« Geschlecht.
Die Behauptung der Zweigeschlechtlichkeit ist laut der G. ein Machtinstrument zur Durchsetzung bipolarer männlich-weiblicher Rollen. Jede Bipolarität transportiert unterschwellig oder offen die Dominanz der einen und die Repression der anderen Seite (→ Diskriminierung). »Mensch« bleibt als einzige nicht-repressive Kategorie übrig. Damit kommen Theater-Metaphern und virtuelle Selbstentwürfe ins Spiel: Hinter der »Maske« (Jane Flax) sei das Ich »nichts als« Selbstfiktion. Soziologie dekonstruiert Biologie.
Die Faktizität des Körpers gilt als leer, als unbeschriebenes Blatt offen für eine Mehrfach-Überschreibung. »Fließende Identität« will auch das identische Subjekt als aufgezwungene Norm aufdecken. Die Umformung von → Sprache, sofern sie die Norm binärer Geschlechtlichkeit tradiert, ist polit. Ziel der Gendertheorie. Grammatik wird aufgebrochen: Der »gender-neutrale« Plural they soll den he/she -Singular ersetzen; person die Wörter man/woman . (Offizieller Beispielsatz: This person carries their bag under their arm .) Die radikale G. steht dem Gedanken einer Gegebenheit des Geschlechts deswegen abweisend gegenüber, weil in ihr ein zu rascher Schritt vom Sein zum Sollen vermutet wird, ein »biologistischer Fehlschluss«.
Von der G. angezielt werden Geschlechtsindifferenz (Transsexualität), Geschlechtswechsel, weiblich-männliche Rollenidentität, Bi- und Homosexualität (statt sog. »Zwangsheterosexualität«: Monique Wittig), polymorphe Sexualität (→ Sexualethik), Körper als androgyne, virtuelle Selbstinszenierung (operative/künstlerische Umwandlung), polit. und sprachliche Aufhebung der Kategorie Geschlecht, fließende Identität.
2. Die Kritik an der G. bemängelt das Auflösen der Natur in Kultur, das Verschwinden des Leibes im neutralen Körper und den Verlust personaler Subjektivität und ihrer polit. Relevanz (Seyla Ben Habib). Die Hauptthesen der Kritik lauten: Lebensweltlich ist die Mehrwertigkeit von Geschlecht und offenem Rollenspiel identitätszerstörend und selbstwidersprüchlich; die polit. Frauenbewegung und der → Feminismus insgesamt verlieren durch Dekonstruktion des Frauseins ihr Subjekt. Wenn es keine von Männern unterscheidbaren Frauen gibt, ist jede Frauenförderung gegenstandslos. Leiblichkeit ist schon durch Zeugung und Geburt unhintergehbar. Bipolarität ist grundsätzlich nicht auszuschalten, weder sprachlich-symbolisch noch lebensweltlich noch biologisch; auch homosexuelle Beziehungen gestalten sich in Analogie zur Heterosexualität, indem der eine Partner eindringt, der andere aufnimmt. Butler verstärkt sogar den Sex-Gender-Dualismus, wenn sie den Körper als un-wirkliches, passives Objekt, nicht mehr als Subjekt des Diskurses verstehen will. Sie unterstellt, dass durch die Sprache Gender-Wirklichkeit weitgehend unabhängig von der biologischen Realität, also konstruktiv hergestellt wird (»Linguizismus«).
Den Körper in dieser Weise mit neuem Text zu überschreiben stellt ein dominantes Verhalten dar: Der Körper verliert die eigene »Sprachlichkeit«, z.B. seine unterschiedliche Generativität von Zeugen und Empfangen wie Gebären oder seine unterschiedliche leibhafte Erotik von Eindringen und Aufnehmen. Die Leibsymbolik wird nicht fruchtbar, die phänomenale Selbstaussage zum Schweigen gebracht. So gesehen liefert Butler eine erneute Variante der extremen Bewusstseinsphilosophie mit ihrer Körper-Geist-Spaltung.
Statt des »biologistischen« herrscht in der G. ein »normativistischer Fehlschluss«: Normen werden – je nach Situation oder Individuum – willkürlich aufgehoben, ohne einen sachlichen Bezug vorauszusetzen oder zu berücksichtigen.
3. Die »Gender-Studien« analysieren die kulturgeschichtlichen Transformationen von Frausein in Ethnologie, Soziologie, Philosophie, Theologie, Literatur u.a. Im Hintergrund der Forschung steht dabei i.d.R. nicht die Bezweiflung des biologisch sinnvollen Frauseins, sondern das Interesse an der sich verändernden kulturellen Bedeutung der Frau.
Lit.: S. Benhabib: Der Streit um Differenz. Feminismus und Postmoderne in der Gegenwart, 1995; J. Butler: Das Unbehagen der Geschlechter, 192018 (Orig.: Gender Trouble, 1990); H.-B. Gerl-Falkovitz: Frau – Männin – Menschin. Zwischen Feminismus und Gender, 2016; R. Kroll (Hg.): Metzler Lexikon Gender Studies / Geschlechterforschung. Ansätze, Personen, Grundbegriffe, 2002; T. Kubelik: Genug gegendert! Eine Kritik der feministischen Sprache, 2013; Chr. Raedel: Gender. Von Gender Mainstreaming zur Akzeptanz sexueller Vielfalt, 2017; S. Stoller / V. Vasterling / L. Fisher (Hg.): Feministische Phänomenologie und Hermeneutik, 2005.
H.-B. Gerl-Falkovitz
Genesis → Pentateuch
Genetik → Gentechnologie
Genfer Katechismus → Bekenntnisschrift/-en, II.
Die G.K. sind ein System von multilateralen völkerrechtl. Verträgen, das dem Schutz von Opfern bewaffneter Konflikte dient.
Die erste Konvention zum Schutz der verwundeten Soldaten wurde am 22.8.1864 im Genfer Stadthaus begründet. Der Anstoß zu dieser Übereinkunft ging vom Genfer Kaufmann H. → Dunant und seiner Empörung über die unzureichende, obwohl damals schon mögliche medizinische Versorgung der Verwundeten in der Schlacht von Solferino 1859 aus. Der Vertrag wurde mehrfach an neuere Entwicklungen angepasst bzw. auf neue Bereiche ausgedehnt, insbes. durch die beiden Konventionen von 1929 (Schutz auch für Kriegsgefangene) und die vier Konventionen von 1949 (I. Verwundete und Kranke im Landkrieg, II. Seekrieg, III. Kriegsgefangene, IV. Zivilbevölkerung) sowie die Zusatzprotokolle von 1977 und 2003.
Die G.K. verwirklichen das Grundprinzip der Beschränkung kriegerischer Gewalt: Der → Krieg ist eine Auseinandersetzung, in der Staaten mit militär. Mitteln gegen die militär. Anstrengungen des Gegners kämpfen. Darum sind nur Streitkräfte (Kombattanten) zu feindlichen Handlungen berechtigt und dürfen Feindseligkeiten nur gegen militär. Anstrengungen (Streitkräfte und sog. militär. Ziele) gerichtet werden. Daraus folgt nicht nur der Schutz der Zivilbevölkerung vor Angriffen, sondern auch der Schutz des Wehrlosen, der dem Gegner nicht mehr schaden kann. Letzteres bedeutete zunächst Schutz der Verwundeten und Kranken (Konvention von 1864). Sie dürfen nicht angegriffen, sondern müssen entsprechend der medizinischen Notwendigkeit versorgt werden. Personen und Einrichtungen, die dies tun, sind geschützt und müssen Gelegenheit haben, ihre humanitäre Funktion auszuüben. Dem dient ein Schutzzeichen, das diese Einrichtungen führen dürfen, seit 1864 das rote Kreuz, später auch der rote Halbmond. Wichtig ist auch der Schutz durch ständige Institutionen, nämlich auf der internationalen Ebene das Internationale Komitee vom → Roten Kreuz, auf der staatlichen die nationalen Rotkreuz- bzw. Rothalbmond-Gesellschaften. Dieser Schutz galt zunächst nur für verwundete und kranke Militärs, seit den Zusatzprotokollen von 1977 gilt er auch für Zivilisten.
Читать дальше