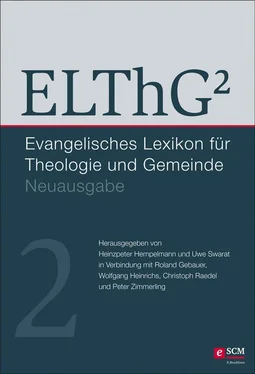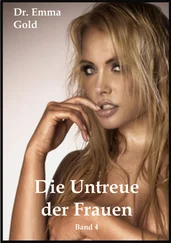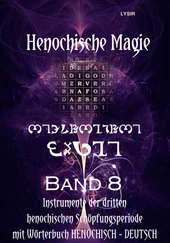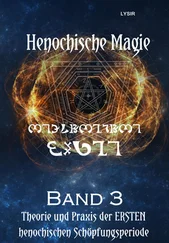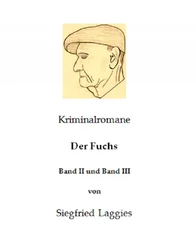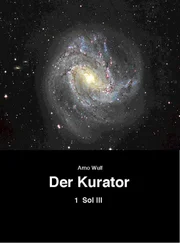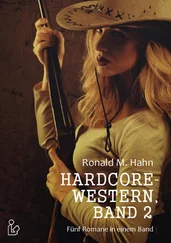Bis in die 1840er-Jahre bestanden die drei freien ev. Gemeinden des Réveil unabhängig voneinander. Im Jahr 1849 wurde die »Église évangélique libre de Genève« (Freie ev. Gemeinde von Genf) gegründet; ihr gehörten neben den führenden Männern der drei freien Gemeinden auch Laien und Pfarrer der Kantonalkirche an.
Lit.: U. Gäbler: Der Weg zum Réveil in Genf, Zwing. 16/1983, 142-167; ders.: Evangelikalismus und Réveil, in: ders. (Hg.): Geschichte des Pietismus, Bd. 3, 2000, 29-84 (bes. 39-56); Chr. Stuber: »Eine fröhliche Zeit der Erweckung für viele«. Quellenstudien zur Erweckungsbewegung in Bern 1818–1831, 2000, 52-56.
Chr. Stuber
G.en sind ein allgemeines kulturelles Phänomen. Darunter sind i.d.R. »›Gruppenwirtschaften‹ [zu] verstehen, die zumeist auf solidarischer Selbsthilfe sozial schwacher oder gefährdeter Personen beruhen. Für die Gruppenwirtschaften […] trifft entweder zu, dass sie für die Haushalte oder die Betriebe ihrer Mitglieder in Anknüpfung an deren wirtschaftl. Bedürfnisse oder Interessen, aber auch unter Beachtung außerökonomischer Anliegen mehr oder weniger viele Aufgaben (Funktionen) übernehmen, welche die Mitglieder nicht je für sich wahrnehmen wollen oder können« (Engelhardt, 563).
Genossenschaftliche Phänomene im weiteren Sinne können anhand ihrer Verortung innerhalb eines Koordinatensystems beschrieben werden. Die Eckpunkte sind dabei a) ökon. Orientierung, b) geistl. Gemeinschaft, c) wirtschaftl. Verflechtung und d) binnenzentrierte tendenzielle Abgeschlossenheit. Nach geläufigem Verständnis bewegen sich G.en zwischen a) und c). Zwischen b) und d) finden sich eher geistl. Kommunitäten, die allerdings auch über gruppenwirtschaftl. Elemente verfügen müssen, um nicht als rein geistl. Gemeinschaften bezeichnet zu werden. Der jeweilige Schwerpunkt charakterisiert also die Art der Genossenschaft. G.en arbeiten nach den Grundsätzen der Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung. Neben der wirtschaftl. Förderung ihrer Mitglieder in z.B. Konsum-, Bank-, oder Energie-G.en ist auch die soziale Förderung etwa in Senioren-G.en von Bedeutung.
Die Verbindung von → Gemeinschaft (lat. communio ) und Zusammenarbeit ( cooperatio ) ist auch ein Wesensmerkmal des Christentums, von der Jüngergruppe um Jesus über die Urgemeinde, die Mönchsorden und die vielfältigen Bruderschaften des MA sowie zahlreiche Aufbrüche in der Neuzeit. Luther kritisierte mit den Bruderschaften genossenschaftliche Elemente in ihrem Charakter als Gruppenphänomen heftig und stellte ihnen eine allg. Christusbruderschaft aller Gläubigen gegenüber (Ein Sermon von dem hochwürdigen Sakrament des Heiligen wahren Leichnams Christi und von den Bruderschaften, 1519). Damit wurde indirekt in der Reformationszeit auch das parochiale Element gegenüber anderen Vergemeinschaftungsformen gestärkt und somit der G.sgedanke faktisch geschwächt.
Begründer der neuzeitlichen G.en in Deutschland sind H. Schulze-Delitzsch und Fr.W. → Raiffeisen. Die G.sidee ist in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO aufgenommen worden.
Lit.: W.-W. Engelhardt: Art. Genossenschaften, ESL, 2001, 562-566, H. Faust: Geschichte der Genossenschaftsbewegung, 1965; M. Klein: Genossenschaften, 2016; H. Siepmann: Brüder und Genossen. Ansätze zu einem genossenschaftlichen Gemeindeaufbau, 1987.
M. Klein
1. Methode und Anwendungsbereich
Das Erbgut von Lebewesen (Genom) besteht aus Chromosomen und diese wiederum aus Genen (beim Menschen ca. 22 000). Ihr chemischer Aufbau ist überall gleich. Die Lebensprozesse werden also von Genen gesteuert. Dennoch sind die Gene keine »Allverursacher«, sondern vielmehr »geführte Führer«. Sie unterliegen Einflüssen aus dem Körper und über ihn aus der Umwelt (Epigenetik). Das Genom des Menschen und vieler anderer Lebewesen ist inzw. entschlüsselt. Gene, die Krankheiten verursachen, können identifiziert und lokalisiert werden. Die Diagnoseverfahren wurden durch die neue Datentechnologie möglich und sind so billig, dass Menschen sich leicht eine Diagnostik ihres Erbguts erstellen lassen können. Zur sachgerechten Deutung der Befunde ist allerdings ein hohes Maß an medizinischen Kenntnissen nötig.
Bei der Gentechnologie ist zu unterscheiden zw. Eingriffen in Körperzellen und in Keimzellen. Zu Ersteren gehören die Versuche, krankhafte genetische Anlagen durch gesunde zu ersetzen und so Krankheiten zu heilen. Eingriffe in Keimzellen haben individuen- und auch generationenübergreifende Auswirkungen. Gene von Lebewesen, die sich mit natürlichen Züchtungsmethoden nicht kreuzen lassen, können auf der Basis der chemischen Gleichheit der Erbsubstanz aller Lebewesen kombiniert werden, sodass transgene Lebewesen mit ganz neuen Eigenschaften erzeugt werden können. Damit wird das natürliche »Zufallsgeschehen« der Entstehung neuen Lebens in planendes Handeln überführt und Leben mit erwünschten Eigenschaften technisch herstellbar. Dabei kann auch synthetisch hergestellte Erbsubstanz eingebaut werden (synthetische Biologie). Natürlicherweise bestehen gegen Verschmelzungsprozesse des Erbguts verschiedener Arten starke biologische Barrieren, die auch dazu führen, dass gentechnisch eingeschleuste Gene, v.a. die einer anderen Art, meist nach wenigen Generationen wieder ausgesondert werden. Natürliche genetische Veränderungsprozesse verlaufen langsam und in Anpassung an die Veränderungen in der Umwelt. Durch die G. kann diese Entwicklung extrem beschleunigt werden. So können ganz neue transgene Mikroorganismen, Pflanzen und Tiere gezüchtet werden, die z.B. besser an die sich wandelnden Umweltverhältnisse angepasst und krankheitsresistent sind, schneller wachsen und höhere Erträge bringen. Dem stehen gesundheitliche, ökol. und ökon. Risiken gegenüber. So können z.B. Pflanzen vom Hersteller genetisch so »konstruiert« werden, dass sie nur mit bestimmten chemisch hergestellten Stoffen gedüngt werden können. Zugleich muss deren Saatgut oft jährlich erneuert werden. Die langfristigen ökol. und auch ökon. Folgen solcher Eingriffe sind schwer absehbar.
2. Theologische Aspekte
Die G. ist der derzeitige Höhepunkt einer mechanistischen Betrachtung des Lebens, die mit R. → Descartes begonnen hat. Zugleich steigert sie die Herrschaft des Menschen über die belebte Natur. Der Mensch schafft neuartige Lebewesen nach seinen Plänen, betrachtet die belebte Natur primär als »Stoff« für sein veränderndes Handeln und setzt sich selbst als Herr und Besitzer der von ihm gemachten »zweiten Schöpfung« ein, macht z.B. auf Methoden der Herstellung solcher Lebewesen Patentrechte wie auf technische Gebilde geltend. Weil Gott nicht mehr als Schöpfer des Lebens geglaubt wird, wird das Leben auch nicht mehr in dem ihm von Gott verliehenen Eigenwert und Daseinsrecht geachtet, es wird vielmehr primär nach seinem »Gebrauchswert« für von Menschen gesetzte Zwecke behandelt. Der Mensch verkennt dabei leicht, dass er die Komplexität der Natur letztlich nicht durchschauen und die Folgen derartiger Eingriffe in die Natur nicht berechnen kann. Wenn der Mensch sich als Schöpfer versteht, kann die Ehrfurcht vor Gottes → Schöpfung schnell schwinden. Das vom Menschen »Machbare« wird zum Maßstab seines Umgangs mit der Natur, ohne dass die Ziele des Machens geklärt und seine langfristigen Folgen absehbar sind. Dennoch können Eingriffe ins Erbgut nicht mit der Begründung abgelehnt werden, dass dieses in sich selbst unantastbar und »heilig« ist. Die Natur ist nicht mit Gottes guter Schöpfung identisch, in ihr liegen Schöpfung und das die Schöpfung bedrohende und das Leben zerstörende »Chaos« ineinander verwoben vor. Auftrag des Menschen ist es, das Leben vor Zerstörung zu bewahren, es zu heilen und Leiden zu lindern. Dazu darf der Mensch sich auch der Möglichkeiten der G. bedienen. Große Bedenken bestehen hingegen, wenn der Mensch sich nicht darauf beschränkt, mit diesen Techniken das Leben vor Zerstörung zu bewahren und zu heilen, sondern wenn er das Ziel verfolgt, das Leben von seinen genetischen Grundlagen her zu bessern, ohne zu wissen, was die Folgen solcher Bestrebungen für die Menschheit sein können. In dieser Hinsicht ist nicht so sehr die Gentherapie an Körperzellen als vielmehr der verändernde Eingriff in die Keimzellen ethisch problematisch.
Читать дальше