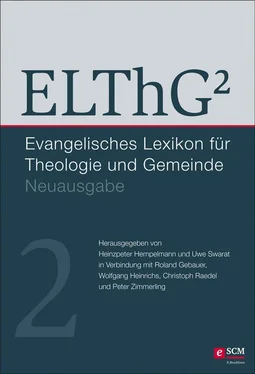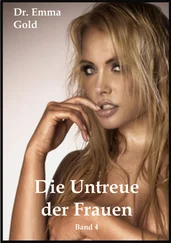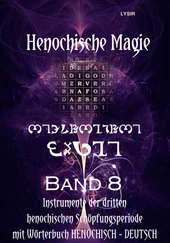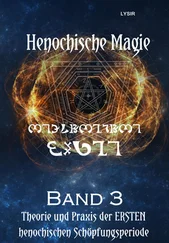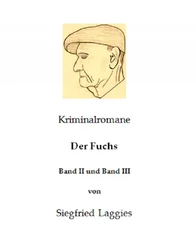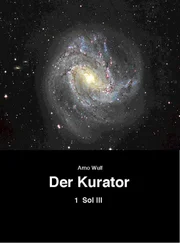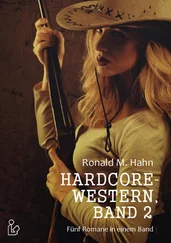Lit. : Chr. Gestrich: Christentum und Stellvertretung. Religionsphilosophische Untersuchungen zum Heilsverständnis und zur Grundlegung der Theologie, 2001; H. Hempelmann / M. Herbst: Vom gekreuzigten Gott reden. Wie wir Passion, Sühne und Opfer heute verständlich machen können, 2011; Kl.E. Müller: Schamanismus. Heiler, Geister, Rituale, 42010.
H. Hempelmann
II. juristisch
Juristisch wird der Begriff der G. nicht einheitlich verstanden, sondern erscheint facettenreich und abhängig von seinem jeweiligen rechtl. Kontext. Als Kern des jurist. Begriffsverständnisses im Zivilrecht, z.T. aber auch im Strafrecht, bezeichnet G. das subjektiv-individuelle Resultat des psycholog. Prozesses eines Geschädigten, der durch das Verhalten eines anderen Menschen in seinem Rechtsgefühl verletzt wurde. Wird das Rechtsgefühl, angestoßen durch eine Leistung oder Duldung des Schädigers, wiederhergestellt, tritt G. ein. Dieses Verständnis von G. liegt einem Großteil der jurist. Dogmatik insbes. zu zivilrechtl. Schmerzensgeldansprüchen bei immateriellen und dadurch unvergleichbaren Schäden zugrunde. Der Leistung von Schmerzensgeld an den Geschädigten wird eine G.-Funktion zugesprochen, wie zugleich die Höhe des Schmerzensgeldes anhand dieser Funktion bemessen wird.
Daneben bildet die so verstandene G. einen wichtigen Begriff in der Diskussion um die Zwecke staatl. Strafens. Es war und ist Gegenstand kontroverser wiss. Debatte, ob der staatl. Strafanspruch auch dem Zweck der G. dient bzw. dienen darf und ob insbes. die Strafhöhe sich daran orientieren darf, inwieweit mit der → Strafe G. zu erreichen ist.
In dieser Diskussion tritt noch ein zweiter Bedeutungsgehalt der G. hinzu: Danach zielt der Zweck staatl. Strafens nicht subjektiv-individuell auf den Eintritt von G. bei dem Geschädigten, sondern auf eine objektiv-gesellschaftl. verstandene G., d.h. die Wiederherstellung des durch die Straftat gestörten Rechtsfriedens der Gesamtgesellschaft durch eine Leistung des Täters oder seine Duldung der staatl. Zufügung eines Übels. V.a. im strafrechtl., aber auch im zivilrechtl. Kontext steht das Bedürfnis nach G. damit einerseits in Relation zum Verschulden bzw. zur Schuld des Schädigers oder Täters und andererseits zu seiner Bereitschaft, durch die Erduldung eines Übels oder durch eigene Leistung Einbußen in der persönl. Rechtsstellung hinzunehmen, die das Bedürfnis nach G. befriedigen.
Lit.: Cl. Schubert: Die Wiedergutmachung immaterieller Schäden im Privatrecht, 2013, 180ff; J. Weber: Zum Genugtuungsinteresse des Verletzten als Strafzweck, 1997.
R. Zimmermann
III. biblisch
»Genugtuung« oder »Genugtun« sind keine bibl. Begriffe. Versteht man unter G. das stellvertretende Lebensopfer Jesu am Kreuz, dann kann auch von der Sache erst im NT die Rede sein (→ Kreuzestheologie). Die atl. → Opfer sind nur Vorzeichen auf das Lebensopfer Jesu, die stets wiederholt werden mussten. Gleichwohl konnten sie die am Kreuz Christi ein für alle Mal erworbene → Vergebung für die Gläubigen des Alten Bundes vorwegnehmen bzw. austeilen (Hebr 10,1-18; vgl. 9,15; Röm 3,25f).
Ntl. wird der G.sgedanke durch die Alleinmittlerschaft Jesu zw. Mensch und Gott bzw. durch sein alleiniges Erlösersein ausgedrückt oder vorausgesetzt (z.B. Mt 1,21; 1Tim 2,5). Im Blick auf die → Erlösung ist immer nur von einem Subjekt bzw. von nur einem Mittler die Rede: dem Sohn Gottes. Der Mensch ist das zu erlösende Objekt und kommt nicht als mit-sühnendes Subjekt infrage. Der Gekreuzigte sagt: »Es ist vollbracht« (Joh 19,30). Da die Gläubigen nicht durch ihre Werke gerechtfertigt worden sind, sondern nur durch das Werk Christi, muss dieses genügen (vgl. Röm 3,21-31; 4,5). Christus, der als der neue Adam dem alten Adam im Heilswerk gegenübersteht (Röm 5,12-21; 1Kor 15,47-49), hat die Gläubigen vom Fluch des Gesetzes erlöst (Gal 3,13) und sie durch sein Blut teuer erkauft (1Kor 6,20; Eph 1,7; 1Petr 1,18f; 2,24). Es hieße, das Evangelium auf den Kopf zu stellen, wenn man von einer Ergänzungsbedürftigkeit oder Steigerungsfähigkeit des Wertes von Loskauf oder Opfer Christi durch den Menschen ausginge oder dies gar einforderte. Insofern haben Menschen Gott keine G. zu leisten.
Lit.: F. Delitzsch: Über den festen Schriftgrund der Kirchenlehre von der stellvertretenden Genugthuung, in: Kommentar zum Hebräerbrief (1857), 1989, 708-746; H. Steindl: Genugtuung. Biblisches Versöhnungsdenken – eine Quelle für Anselms Satisfaktionstheorie?, 1989.
St. Felber
IV. systematisch-theologisch
Das Geschehen von G. wird syst.-theol. vorwiegend in der Lehre von Jesu Person und Werk bedacht (dort ist der Begriff »Satisfaktionslehre« üblich), aber auch in der Lehre von der → Buße. Immer geht es um die Frage nach Art und Möglichkeit einer Leistung, die »genug tut«. Was aber tut sie? Wer tut sie? Wem gegenüber?
In der vorreformator. Bußtheologie ist die Buße ein dreiteiliges Geschehen und besteht aus Reue (lat. contritio cordis ), mündlicher Beichte ( confessio oris ) und Genugtuung ( satisfactio operis ), also tätige G. in Gebet, Fasten und Almosengeben. Dieses urspr. Verständnis von G. darf nicht als Handlung missverstanden werden, mit der der Büßende sich Gottes Zuwendung verdient. Ursprünglich war sie vielmehr Bekundung tätiger Umkehr, später dann genugtuende Leistung an die durch die Sünde ihres Gliedes verletzte Kirche (!). Die Beziehung der G. auf Gott kam erst dadurch zustande, dass die zur G. auferlegten Kirchenstrafen durch andere Leistungen (etwa Geldzahlungen) abgelöst werden konnten und in ihrer genugtuenden Wirkung schließlich auch auf die von Gott verhängten Fegfeuerstrafen (→ Fegfeuer) bezogen wurden. In der reformator. Theologie verliert die Buße jede genugtuende Funktion. Buße ist Rückkehr zur → Taufe und zeigt sich in persönl., im Alltag gelebten Christsein.
Die Satisfaktionslehre deutet den Kreuzestod Jesu Christi als von Gott verlangte, notwendige und einzig mögliche G. angesichts der durch die → Sünde des Menschen geschehene Entehrung Gottes (→ Kreuzestheologie). → Anselm (1033–1109), seit 1093 Erzbischof von Canterbury, hat die Satisfaktionslehre erstmals umfassend ausgearbeitet und theologiegeschichtl. wirksam gemacht. Er antwortet in seiner Schrift »Cur Deus homo?« (»Warum wurde Gott Mensch?«) auf die Frage, warum der Gottessohn in letzter Konsequenz seiner Menschwerdung den Kreuzestod erdulden musste, wenn Gott der Welt das Heil doch auch durch eine andere Person (etwa durch einen Engel) oder durch seinen bloßen Willensentschluss hätte zuteilwerden lassen können. Entscheidend sind u.a. die Kapitel 11–15; 19 und 20 des ersten Buches: Wer Gottes Willen nicht erfüllt, sündigt. Wer sündigt, entehrt Gott. Dieses Defizit, die Entehrung Gottes, muss ausgeglichen werden. Ein einfacher Nachlass der Schuld ist keine Gott geziemende Möglichkeit; sie ließe die Dinge »ungeordnet«. Im Laufe von Anselms Argumentation steht bald nur noch eine Alternative zur Debatte: Um der kosmischen Ordnung willen ist entweder Bestrafung (lat. poena ) des Menschen erforderlich oder G. gegenüber Gott. Bestrafung entzöge dem Menschen das → Heil. Sie stellt keine Möglichkeit dar, weil sie der urspr. Heilsabsicht Gottes zuwiderliefe, was sich für Gott ebenfalls nicht ziemt. Es muss also G., eine wirkliche Wiederherstellung des urspr. Zustandes geleistet werden, weil nur sie das Heil des Menschen zu wirken imstande ist. Der Mensch ist nicht imstande, diese G. selbst zu leisten. Er kann ja nichts ausgleichend Gutes tun, was er nicht ohnehin zu tun verpflichtet wäre. Die Schwere auch der kleinsten Sünde macht es selbst dem besten Menschen unmöglich, G. zu leisten, die ja weit über das ohnehin Geschuldete hinausgehen müsste. Das kann nur der sündlose Gott-Mensch Christus. Denn zum einen muss der Mensch diese Genugtuung leisten, zum anderen kann sie nur Gott selbst leisten.
Читать дальше