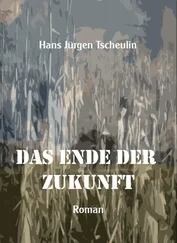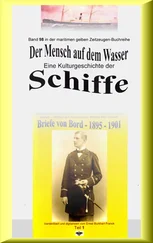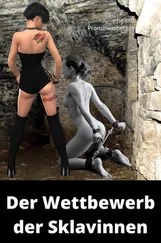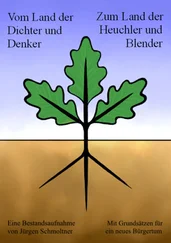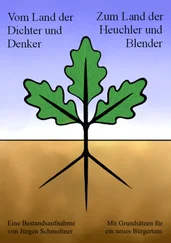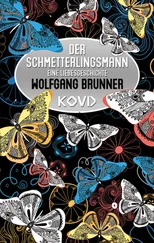Das vorliegende Buch unterscheidet sich von üblichen Antragsbüchern dadurch, dass es ausdrücklich kein Sammelsurium von Muster-Berichten nach ICD-Diagnosen und keine Sammlung von Textbausteinen ist. Das Buch enthält ausführliche Informationen zum funktionalen Bedingungsmodell: Worauf kommt es bei der Mikroanalyse an? Wie kann eine Makroanalyse mit überzeugenden Hypothesen zu prädisponierenden, auslösenden und aufrechterhaltenden Bedingungen erstellt werden? Es wird gezeigt, wie die zentralen Therapieziele aus der Verhaltensanalyse abgeleitet werden und wie ein individualisierter Behandlungsplan erstellt werden kann, der den Anforderungen der Psychotherapie-Richtlinie genügt. Der neue Leitfaden PTV 3 zum Erstellen des Berichts wird ausführlich kommentiert. Dabei werden typische Fehlerquellen aufgezeigt. Konkrete und praktische Empfehlungen zum Schreiben von Antragsberichten runden das Buch ab.
Das vorliegende Handbuch soll dabei helfen, Freude am Verfassen von Antragsberichten zu bekommen. Der Leser wird ermutigt, seinen eigenen Stil zu finden und Antragsberichte individualisiert und lebendig zu schreiben. Durch Fokussierung auf das Wesentliche entsteht in überschaubarer Zeit ein konziser, klarer und plastischer Bericht. Die nötige Stringenz wird erreicht durch eine explizite Hypothesenbildung, die Fokussierung auf die relevanten Faktoren in der Verhaltensanalyse, durch die Beschränkung auf die wesentlichen Kernziele, durch die Auswahl der zentralen zielführenden Veränderungsstrategien und ein individualisiertes und maßgeschneidertes Behandlungskonzept. So entsteht ein roter Faden – sowohl für den Bericht als auch für den therapeutischen Prozess. Dann ist der Antragsbericht keine lästige Pflichtübung, kein notwendiges Übel und keine Verschwendung von Arbeits- und Lebenszeit, sondern eine willkommene Gelegenheit zu professioneller Reflexion, die den Blick auf das Wesentliche schärft. Eine solche Fokussierung hat viele Vorteile: Ein stringenter Bericht ist kurzweilig und überzeugend. Nur ein individualisierter Bericht mit ätiologischen Hypothesen und klarem Fokus dient der Qualitätssicherung, wovon Patient und Therapeut gleichermaßen profitieren. Das Schreiben eines schlüssigen und fokussierten Berichts ist eine kreative und intellektuell befriedigende Leistung, die Vergnügen bereiten kann. Ein guter Bericht ist individualisiert und zeigt ein stimmiges Therapiekonzept auf, das auf der Grundlage einer überzeugenden Verhaltensanalyse entwickelt wurde. Das Schreiben eines stringenten Berichts ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die professionelle Erfahrung und fundiertes Fachwissen erfordert. Ein guter Bericht lebt von der Intuition des Therapeuten. Schließlich ist Psychotherapie – wie auch ärztliches Handeln – eine Kunst. Moderne Verhaltenstherapie ist kein lebloses technizistisches Feuerwerk von Interventionen und kein rigides Abarbeiten von Manualen.
Es werden sowohl Einzel- als auch Gruppen- und Kombinationstherapie dargestellt. Das Buch bezieht sich ausschließlich auf die Behandlung von Erwachsenen.
Wichtige Aspekte werden ganz bewusst gelegentlich wiederholt, weil es aus didaktischen Gründen sinnvoll erscheint, Wichtiges lieber einmal zu viel als zu wenig zu sagen.
In der Neuauflage wurde insbesondere das Kapitel zu den störungsspezifischen Bedingungsmodellen und schematischen Behandlungsplänen erheblich erweitert. Der Abschnitt zur Makroanalyse ist ausführlicher und übersichtlicher als in der ersten Auflage. Weggefallen ist ein eigenes Kapitel zur biographischen Analyse. Die wesentlichen Inhalte daraus wurden nun im Rahmen der Makroanalyse dargestellt. Außerdem wurden häufige Kritikpunkte der Gutachter ergänzt.
Um einen ungestörten Text- und Lesefluss zu gewährleisten, wird in diesem Buch durchgehend das generische Maskulinum verwendet, das selbstverständlich für sämtliche Geschlechter steht (männlich, weiblich, divers).
Mein besonderer Dank gilt dem Verlag W. Kohlhammer. Mit Herrn Dr. Ruprecht Poensgen ist die Zusammenarbeit über Jahre hinweg stets inspirierend, ermutigend und angenehm. Danken möchte ich auch Herrn Florian Rotberg für das sorgfältige Lektorat.
| München, im |
|
| Oktober 2021 |
Jürgen Brunner |
1 Kritik des Gutachterverfahrens
1.1 Nachteile des Gutachterverfahrens
Das Verfassen von Berichten an den Gutachter empfinden die meisten Therapeuten als lästige Pflicht und als unangenehm. Einige sehen darin eine Zumutung und eine Schikane und fordern die Abschaffung der Begutachtung. Das ist teilweise nachvollziehbar. Ein guter und schlüssiger Bericht braucht Zeit, weil er individualisiert, fachlich fundiert und plausibel sein muss.
Das pauschale Honorar von 65,75 € für einen Bericht für eine Langzeittherapie und von 32,93 € für eine Kurzzeittherapie ist gemessen an dem oftmals erheblichen Zeitaufwand unverhältnismäßig niedrig. Dieses geringe Honorar ist für einen verantwortungsvollen akademischen Beruf mit staatlicher Approbation unangemessen. Dringend zu fordern ist eine signifikante Anhebung des Honorars für einen Antragsbericht.
Einige Therapeuten geben Geld für Computerprogramme aus, wodurch die Berichterstattung angeblich erleichtert werden soll. Nach meiner Einschätzung braucht es eine solche Antragssoftware nicht. Für mich wäre das keine sinnvolle Option und keine Arbeitserleichterung, sondern eher eine Verkomplizierung. Einige Therapeuten delegieren die Arbeit oder wesentliche Teile davon sogar an dubiose Dienstleister, die bei der Erstellung von Antragsberichten gegen Bezahlung behilflich sind. Ein derartiges »Outsourcing« ist unehrenhaft und zudem rechtlich problematisch (Bühring 2004). Auf dem neuen Umschlag PTV 8 erklärt der Therapeut mit seiner Unterschrift, den Bericht an den Gutachter vollständig persönlich verfasst zu haben. Ein Ghostwriter ist also – um es vorsichtig zu formulieren – in einem rechtlichen Graubereich angesiedelt. In meinen Augen handelt es sich um den Offenbarungseid des Therapeuten, wenn er Zuflucht bei derartigen »Dienstleistern« sucht, die einen zweifelhaften Ruf haben. Würden Sie Vertrauen haben zu einem Therapeuten, der dadurch eingesteht, dass er nicht willens oder in der Lage ist, den Antragsbericht selbst zu schreiben? Würden Sie Ihre Tochter, Ihren Sohn oder ihren Partner guten Gewissens zu einem solchen Kollegen schicken? Für manche Therapeuten ist das Berichteschreiben so negativ konnotiert, dass sie prokrastinieren und sogar massiv vermeiden, indem sie fast ausschließlich Akut- oder Kurzzeittherapien durchführen und auf eine Umwandlung in eine Langzeittherapie trotz entsprechender Indikation verzichten. Solche Tendenzen sind aus ethischer Sicht sehr problematisch. Auch hier die Frage: Würden Sie einen nahen Angehörigen zu einem Therapeuten schicken, der dafür bekannt ist, dass die Therapie nach maximal 24 Sitzungen beendet wird, auch wenn noch weiterer Therapiebedarf besteht, nur weil der Therapeut den Aufwand scheut oder aus Angst vor Ablehnung oder Stundenkürzung vermeidet, einen Bericht an den Gutachter zu schreiben?
Neben der mangelnden finanziellen Lukrativität gibt es noch andere Gründe, warum nicht wenige Therapeuten Antragsberichte widerwillig schreiben. Die Einschaltung eines Gutachters wird als externe Einmischung, Kontrolle, Eingriff in die Autonomie des Therapeuten und in die Intimität der therapeutischen Beziehung sowie als Bevormundung erlebt. Dass das Berichteschreiben an den Gutachter für viele Therapeuten aversiv ist, liegt daran, dass Kritikerwartung, Angst vor negativer Bewertung und sogar Versagensängste und Insuffizienzgefühle vorhanden sind oder entstehen können. Gerade bei Nichtbefürwortungen oder Stundenkürzungen können Scham und Kränkung beim Therapeuten auftreten. Eine Nichtbefürwortung oder eine Teilbefürwortung kann vom Therapeuten als persönliche Kritik erlebt werden und Enttäuschung sowie Ärger auslösen (Rudolf 2011, S. 116 f.). Bei anderen löst eine kritische Stellungnahme des Gutachters Wut und kämpferische Impulse aus. Durch Teil- und Nichtbefürwortung kann die narzisstische Homöostase des Therapeuten ins Wanken geraten. Zweifel an der eigenen therapeutischen Kompetenz können getriggert werden. Die Entscheidung des Gutachters stellt zweifellos einen äußeren Einfluss auf den Therapieprozess dar, beispielsweise eine Nichtbefürwortung der Kostenübernahme. Aber auch eine Teilbefürwortung, ein kritischer Kommentar oder die Empfehlung des Gutachters, die Behandlung möglichst innerhalb des jetzt bewilligten Kontingents abzuschließen, verändert den Therapieverlauf und kann Auswirkungen auf die therapeutische Beziehung haben.
Читать дальше