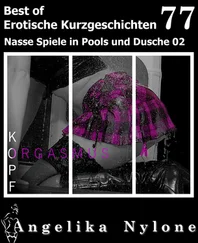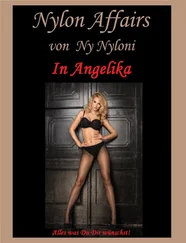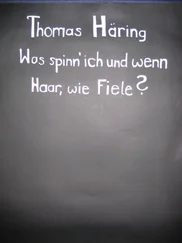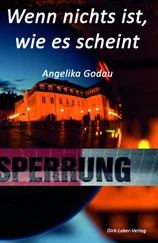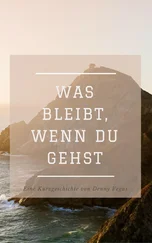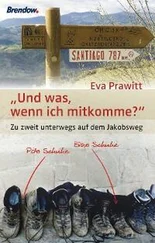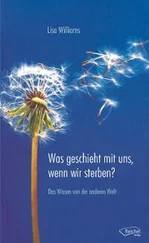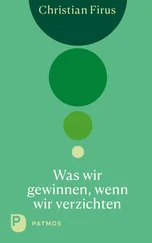Die tiefe, unbewusste Überzeugung, so zu sein – unzulänglich, nicht liebenswert, insuffizient und von schlechtem Charakter – bestimmt häufig das Handeln und Auftreten unserer Patienten. Die Arbeit daran erfordert einen langen, von Geduld und Empathie getragenen Prozess. Was ist, wenn eine Situation eintrifft, vor der der Patient sich fürchtet, die aber unumgänglich ist? Dabei kann es sich sowohl um einen Besuch bei fremden Menschen als auch um ein Vorstellungsgespräch handeln. Ich schlage dann eine aktive Situationsvorbereitung vor. Diese Übung habe ich in ähnlicher Weise schon in einem anderen Buch ausführlich beschrieben (Rohwetter, 2020, S.66f.). Dies ist eine Übung, zu der viel pragmatisches Denken und eine Portion Fantasie gehören. Wichtig dabei ist es, dass die Patientin nicht in irgendein Drama, also in Ängste oder furchtbare Erinnerungen geht. Da ist die strukturierende Seite der Therapeutin gefragt.
Zuerst wird die zu erwartende Situation abgeklärt. Was erwartet die Patientin, was befürchtet sie, wie kann sie sich auf die einzelnen Aspekte vorbreiten? Welche Hilfsmittel kommen in Frage? Gibt es Unterstützer und Verbündete? Kann eventuell der Unterstützer hilfreich sein, der in der Übung Den Dämonen Nahrung geben (  Kap. 4.7) erworben wurde?
Kap. 4.7) erworben wurde?
Die weitere Arbeit beinhaltet konkrete Dinge wie Körperhaltung (dazu siehe die Übung Mit beiden Beinen fest auf der Erde stehen in  Kap. 5.1) und das Wählen der Kleidung. Liegt das Problem in der Angst, nichts sagen zu können, können dafür Lösungen gefunden werden. Manchmal ist es gar nicht nötig, viel zu sagen. Was kann man fragen, um andere zum Reden zu bringen? Sollte es sich um ein Vorstellungsgespräch handeln, muss die Patientin natürlich etwas sagen. Aber auch hier ist es erlaubt, erst einmal zu fragen. Dazu hat sie sich natürlich ausführlich vorbereitet, in dem sie sich genau über den Arbeitgeber informiert hat. Zur Unterstützung können ihre möglichen Fragen auf einem Blatt Paper stehen. Wird sie selbst dann gefragt, verschafft sie sich vielleicht Zeit mit Sätzen wie: »Ich weiß nicht ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe, meinten Sie …«
Kap. 5.1) und das Wählen der Kleidung. Liegt das Problem in der Angst, nichts sagen zu können, können dafür Lösungen gefunden werden. Manchmal ist es gar nicht nötig, viel zu sagen. Was kann man fragen, um andere zum Reden zu bringen? Sollte es sich um ein Vorstellungsgespräch handeln, muss die Patientin natürlich etwas sagen. Aber auch hier ist es erlaubt, erst einmal zu fragen. Dazu hat sie sich natürlich ausführlich vorbereitet, in dem sie sich genau über den Arbeitgeber informiert hat. Zur Unterstützung können ihre möglichen Fragen auf einem Blatt Paper stehen. Wird sie selbst dann gefragt, verschafft sie sich vielleicht Zeit mit Sätzen wie: »Ich weiß nicht ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe, meinten Sie …«
Diese Übung kann öfter wiederholt und auch außerhalb der Therapie mit Freundinnen geübt werden. Eine solche Situation zu meistern, ist sehr befriedigend. Diese Erfahrung bestätigt den Aphorismus: »Wie wird man mutig? Indem man so tut, als sei man mutig« (angeblich ein chinesisches Sprichwort).
3.4 Das ist aber egoistisch!
Für Menschen mit einem so einem rigiden Über-Ich wie die junge Mutter, die ich oben beschrieben habe, ist es schwierig, das Konzept von Selbstfürsorge und Selbstbemutterung zu verstehen. Wenn ich (in voller Überzeugung) sage: »Es ist doch in erster Linie wichtig, dass es mir gut geht«, reagieren sie manchmal empört, manchmal aber auch hoffnungsvoll fragend: »Ist das nicht egoistisch?« Natürlich antworte ich mit einem Ja. Überzeugender wirkt folgende Übung:
Übung: Selbstfürsorge und schlimmes Zahnweh
Ich bitte die Patientin, mir ihren letzten wirklich schrecklichen Schmerz zu schildern. Meist kommt dann an eine Erinnerung an körperliche Schmerzen, schlimmes Zahnweh, eine kindliche Mittelohrentzündung oder eine Appendizitis. Ich lasse mir den Schmerz genau beschreiben. Dann bitte ich die Patientin, folgende Frage zu beantworten: Wie üben Sie mit diesen Schmerzen Ihren Beruf aus? Wie groß ist Ihre Bereitschaft, sich den Kummer einer Freundin anzuhören? Wie stark ist Ihr Liebesgefühl Ihrem Partner gegenüber, wenn Sie Schmerzen haben? Das ist vielleicht eine ziemlich drastische Methode – und sie ist nicht für alle Patienten geeignet. Manchmal allerdings bewirken diese Fragen Wunder. So antwortete eine sehr altruistische Patientin auf die letzte Frage spontan: »Wenn es mir gut geht, liebe ich meinen Mann viel mehr!«
Anmerkungen:
1. Diese Technik verfehlt ihre Wirkung, wenn wir es mit dem Abwehrmechanismus der altruistischen Abtretung zu tun haben. Hier bezieht die Patientin ihren emotionalen Gewinn gerade aus dem Verzicht. Dieser geht (jedenfalls zuerst) verloren, wenn sie sich verstärkt um sich selbst kümmert.
2. Meiner Erfahrung nach hat diese Abwehrform auch einen heilenden Aspekt. So tut es vielen Müttern gut, sich intensiv um ihre Babys zu kümmern. Ihr Kind steht auch stellvertretend für das bedürftige Kind, dass sie selbst einmal waren. Ein Problem kann entstehen, wenn das (reale) Kind selbständiger wird. Allerdings ist das für die meisten Mütter eine Erleichterung, und sie freuen sich darüber, sich mehr um sich selbst kümmern zu dürfen.
»Sobald du anfängst, in Zielen zu denken, wirst du eine handelnde Person, nicht Opfer, sondern Gestalter.« Schoenaker, 2016, S. 79
Jenseits aller Forderungen von Über-Ich und Ich-Ideal gibt es noch etwas anderes, nämlich das Ich, dass ich gern sein möchte. Der Prozess dahin wird von Jung Individuation genannt. Er beschreibt den schwierigen Weg der Entwicklung unserer Person, der erst mit dem Tod endet. Nicht umsonst gibt Herrmann Hesse (1877–1962) seinem Demian als Motto den Satz mit: »Ich wollte ja nichts als das zu leben versuchen, was von selber aus mir herauswollte. Warum war das so schwer?« (1977, S.7).
Dass ich als Therapeutin so viele Menschen auf ihrem schwierigen Weg begleiten durfte, so viele Schritte gesehen habe, macht mich sehr dankbar. Besonders groß waren diese Freude und Dankbarkeit immer dann, wenn Patienten nach einigen Jahren wiederkommen und ich sehe, dass sie ihren Weg weitergegangen sind.
Ich beginne die Suche nach dem Wunsch-Ich mit folgender Übung:
Übung: Wer möchte ich sein?
Anleitung: »Stellen Sie sich einen Tag in der Zukunft vor, zum Beispiel den 25. Mai 2028. Sie wachen nach ausreichendem Schlaf auf, fühlen sich ganz wohl, gesund und zufrieden. Sie wissen, dass Ihr Leben in Ordnung ist, dass Sie viel Leid und Probleme hinter sich gelassen haben. Dann fragen Sie sich: Ich habe mich verändert in den letzten Jahren, wie bin ich eigentlich heute? Beschreiben Sie sich als wunderbaren, unperfekten Menschen, der sie sind.«
Die dann folgenden Aussagen klingen vielleicht ähnlich wie die Tischrede auf einen wunderbaren Menschen aus dem Kapitel 8 Seele auf Papier. Bei dieser Übung ist es allerdings wichtig, dass Rednerin und die Person, über die gesprochen wird, identisch sind. Achten Sie darauf, dass die Patientin die Übung ernst nimmt. Sie könnte zum Beispiel Opfer eines verinnerlichten Gesetzes wie »Eigenlob stinkt« werden. Es gilt auch zu prüfen, welche Aspekte des Wunsch-Ichs aus dem alten Ich-Ideal kommen. Diese Anteile können natürlich passen, sie dürfen aufgenommen werden, wenn sie wirklich authentisch sind. Sie beide, Patientin und Therapeutin, werden ein Gefühl dafür haben, ob die Aussagen echt sind. Klingen sie überzeugend? Falls ja, ist das wunderbar. Dann kommt die Patientin in den vollen Genuss: »Die »Wunsch-Ich-Übung« führt zum Aufbau von Glücksaktivitäten, vermittelt Wohlbefindensziele und Genusstraining, stärkt das positive Selbstbild und die Selbstwirksamkeitserwartung« (Rohwetter, 2019, S. 93).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Читать дальше
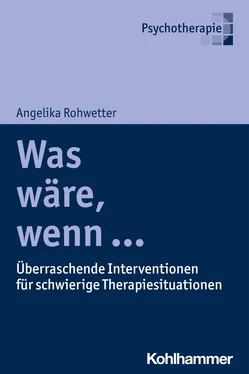
 Kap. 4.7) erworben wurde?
Kap. 4.7) erworben wurde?