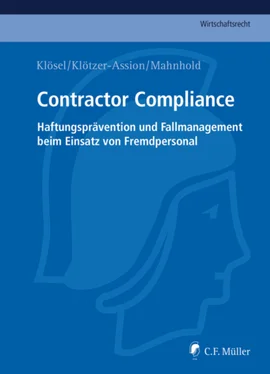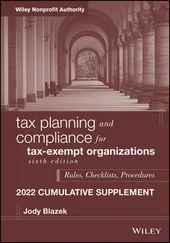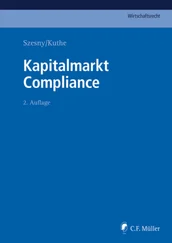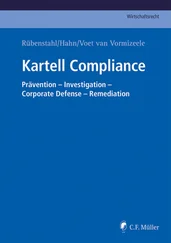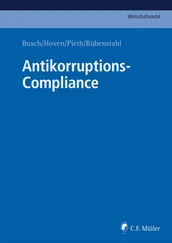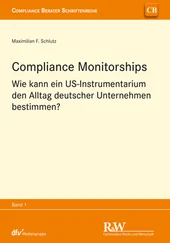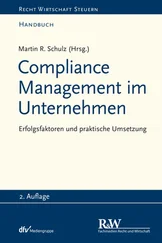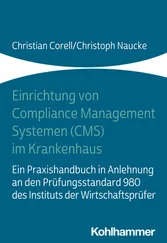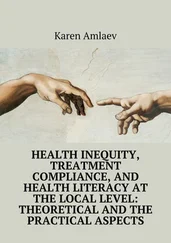[1]
BFH/NV 2011, 585 Rn. 22; BMF-Schreiben v. 21.9.2005, BStBl I 2005, 936.
[2]
Vgl. BMF-Schreiben v. 31.5.2007, BStBl I 2007, 503. Dort in Rn. 3 auch zum Ausnahmefall, dass Vergütungen für nichtselbstständige Tätigkeiten ertragsteuerlich aufgrund bestehender Sondervorschriften (ausnahmsweise) zu Gewinneinkünften umqualifiziert werden, etwa, weil der bei der Komplementär-GmbH angestellte Geschäftsführer, der gleichzeitig Kommanditist der GmbH & Co. KG ist, Geschäftsführungsleistungen gegenüber der GmbH erbringt. Dann werden diese aus der Beteiligung an der KG erzielten Einkünfte gem. § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG zu gewerblichen Einkünften umqualifiziert; umsatzsteuerlich wird die Frage der Selbstständigkeit dagegen weiterhin in Anwendung der allgemeinen Grundsätze bestimmt.
[3]
Zu Einzelheiten vgl. Ellers Die gesetzliche Verpflichtung privater Arbeitgeber zum Lohnsteuereinbehalt.
[4]
Vgl. BFH / NV 2005, 1204.
[5]
BFH BStBl II 1995, 390.
[6]
BGH NJW 2001, 2056 ff.
[7]
Vgl. dazu: Macher NZA 1995, 822.
[8]
So BFH BStBl 2012, 262 unter Ziff. II.2.c.
[9]
BFH BStBl II, 2000, 41 zur Lohnsteuer; BFH / NV 2004, 379 zur Umsatzsteuer.
[10]
Vgl. Blümich /Geserich § 19 Rn. 50.
2. Teil Der Arbeitgeberbegriff in der deutschen Rechtsordnung› 3. Kapitel Definition des steuerrechtlichen Arbeitgeberbegriffs› II. Einzelheiten zum steuerrechtlichen Arbeitgeberbegriff
II. Einzelheiten zum steuerrechtlichen Arbeitgeberbegriff
1. Lohnsteuerlicher Arbeitgeberbegriff nach § 1 Abs. 2 LStDV
a) Arbeitgeber und Pflicht zum Lohnsteuereinbehalt
14
Bei Einkünften aus unselbstständiger Arbeit wird die Einkommensteuer durch Abzug vom Arbeitslohn als Lohnsteuer erhoben. Für den Einbehalt bei jeder Lohnzahlung hat der inländische Arbeitgeber Sorge zu tragen, § 38 Abs. 1, Abs. 3 S. 1 EStG. Im Ausland ansässige Arbeitgeber, die im Inland keine Betriebsstätte i.S.d. § 10 AO oder keinen sog. ständigen Vertreter i.S.d. § 13 AO haben, sind grundsätzlich nicht betroffen[1].
15
Wer lohnsteuerrechtlich i.S.d. § 38 Abs. 3 EStG Arbeitgeber ist, ist im EStG nicht definiert. Nach der Rechtsprechung des BFH gilt grundsätzlich der zivilrechtliche Arbeitgeberbegriff, der abgeleitet wird aus einem Umkehrschluss der in der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung enthaltenen Begriffe „ Arbeitnehmer “ und „ Dienstverhältnis “, §§ 1, 2 LStDV.[2] Arbeitgeber ist danach derjenige, dem der Arbeitnehmer die Arbeitsleistung schuldet, unter dessen Leitung er tätig wird oder dessen Weisungen er zu befolgen hat oder anders gesprochen derjenige, zu dem eine bestimmte Person, um deren Lohnsteuer es geht, in einem Arbeitnehmerverhältnis steht, und damit regelmäßig der Vertragspartner des Arbeitnehmers aus dem Dienstvertrag (vgl. zum arbeitsrechtlichen Begriff den 2. Teil 1. Kap. Rn. 6 ff.).[3]
16
Dies wird regelmäßig der Abnehmer der geschuldeten (Dienst-)Leistungsein.
17
In Sonderfällen – etwa bei Leiharbeitsverhältnissen– lässt sich aber nicht stets eindeutig klären, wer Arbeitgeber ist, da der Leiharbeitnehmer seine Arbeitsleistung sowohl dem Entleiher wie auch dem Verleiher schulden kann.[4] Bei Arbeitnehmerüberlassung oder anderen Formen des drittbezogenen Arbeitseinsatzes (Dreiecksverhältnis), bei denen der Arbeitnehmer nicht mehr unter der Weisung seines Vertragspartners steht, ist lohnsteuerlich dann derjenige Arbeitgeber, der dem Arbeitnehmer den Lohn im eigenen Namen und für eigene Rechnung (unmittelbar) auszahlt.[5] Handelt es sich dabei um den Entleiher, geht die Rechtsprechung davon aus, dass ein Arbeitgeberwechsel im lohnsteuerrechtlichen Sinne stattgefunden hat.[6] Der zivilrechtliche Arbeitgeberbegriff ist demnach für die Frage, wer die Einbehaltungspflichten des § 38 Abs. 3 EStG zu erfüllen hat, nicht ausschließlich entscheidend.[7]
18
Ein Dienstverhältnis i.S.d. § 1 LStDV liegt vor, wenn der Angestellte dem Arbeitgeber – nur beispielhaft aufgeführt sind die öffentliche Körperschaft, der Unternehmer bzw. der Haushaltsvorstand – seine Arbeitskraft schuldet, was der Fall ist, wenn der oder die Betreffende in der Betätigung des geschäftlichen Willens unter der Leitung des Arbeitgebers steht oder in seinem geschäftlichen Organismus dessen Weisungen zu folgen verpflichtet ist. Arbeitnehmer ist demgegenüber nicht – und damit selbstständig tätig –, wer Lieferungen und sonstige Leistungen innerhalb der von ihm selbstständig ausgeübten gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit im Inland gegen Entgelt ausführt, § 1 Abs. 3 LStDV.
19
Die nichtselbstständige Arbeit – und damit auch die Abgrenzung zur selbstständigen bzw. gewerblichen Tätigkeit – wird damit durch die Begriffe Dienstverhältnis, Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Arbeitslohngeprägt. Dabei stehen die Begriffe „ Arbeitnehmer “ und „ Arbeitgeber “ mit dem Begriff des „Dienstverhältnisses“ in untrennbarem Zusammenhang und können aus ihm abgeleitet werden.[8]
b) Bestimmung des Dienstverhältnisses durch Gesamtschau sämtlicher Indizien
20
Ein Dienstverhältnis i.S.d. § 1 Abs. 2 LStDV ist gegeben, wenn der Angestellte oder Beschäftigte dem Arbeitgeber seine Arbeitskraft schuldet, er also in der Betätigung seines geschäftlichen Willens unter Leitung des Arbeitgebers steht oder im geschäftlichen Organismus des Arbeitgebers dessen Weisungen zu folgen verpflichtet ist.
21
Aus der bereits dargelegten Eigenständigkeit des steuerrechtlichen Dienstverhältnissesfolgt, dass es auf die zivilrechtlich geprägte Bezeichnung der Vereinbarung als Dienst- oder Werkvertrag nicht ankommt. Maßgeblich ist allein, ob sich aus der Abrede entnehmen lässt, dass ein Beschäftigter Dienste in abhängiger Stellung erbringen soll und tatsächlich auch erbringt.[9] Steuerrechtlich sind die Begriffe Dienstverhältnis bzw. Arbeitsverhältnis deshalb gleichbedeutend.
22
Ein steuerliches Dienstverhältnis kann durch schriftlichen Vertrag, aber auch durch mündlich getroffene Vereinbarung oder bloß schlüssiges (konkludentes) Verhalten begründet werden. Anders als zivilrechtlich ist eine Rückwirkung mit steuerlicher Wirkung unzulässig.[10] Deshalb kommt der schriftlichen Fixierung der Vereinbarung mit den Vertragsparteien entscheidende Bedeutung zu, um von Beginn an auf sicherer Grundlage auch in steuerlicher Hinsicht eine zutreffende Einordnung des jeweiligen Vertragsverhältnisses vornehmen zu können und die Mitarbeiter zur genauen Einhaltung der schriftlichen Abrede anzuhalten. Dies beugt dem Risiko vor, dass Vereinbarungen nicht nach ihrem Vertragsinhalt „ gelebt “ und viele Jahre später bei Außenprüfungen der Finanzbehörden abweichende Feststellungen getroffen werden, die zu erheblichen Steuernachzahlungen führen können.
23
Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang, dass es für die Besteuerung nicht auf die zivilrechtliche Wirksamkeit des Dienstverhältnisses ankommt, solange die Beteiligten das wirtschaftliche Ergebnis eintreten und bestehen lassen; unerheblich ist also etwa, ob das Dienstverhältnis gegen ein gesetzliches Verbot oder die guten Sitten verstößt, was zivilrechtlich zur Unwirksamkeit führt, §§ 40, 41 AO.[11] Deshalb ist es für die steuerliche Behandlung (natürlich) nicht relevant, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer bspw. vereinbart haben, Arbeitslohn „ schwarz “ auszuzahlen.[12]
Читать дальше