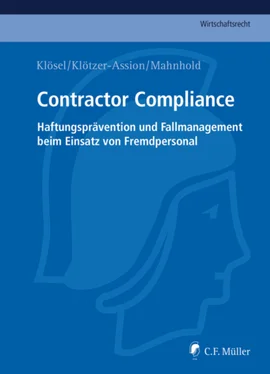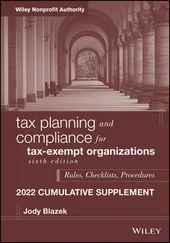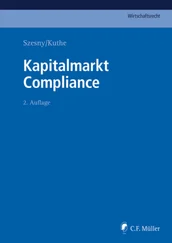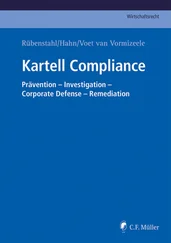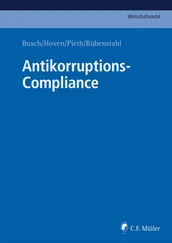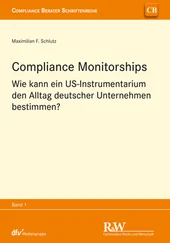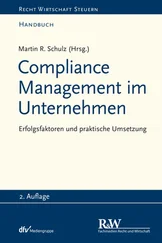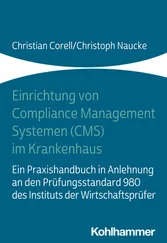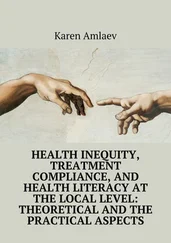8
Ein gutes Beispiel für einen derart verstärkten Fokus auf wirtschaftliche Parameter findet ich in der neueren Rechtsprechung des LSG Bayernzur sozialversicherungsrechtlichen Statusabgrenzung:
9
„In Würdigung der dokumentierten Tätigkeit des Beigeladenen zu 1) eine abhängige Beschäftigung sprechen folgende gewichtige Tatsachen: (i) Der Kläger hat dem Beigeladenen zu 1) für die insgesamt vier durchgeführten Fahrten das wesentliche Arbeitsmittel gestellt, nämlich den auf das Unternehmen des Klägers zugelassenen und für dieses versicherten Lkw, (ii) Der Kläger hat die für den Betrieb dieses wesentlichen Arbeitsmittels notwendigen Betriebsstoffe wie Kraftstoff, Schmiermittel allein getragen, (iii) der Kläger hat die Kosten von Unterhalt und Wartung des Lkw allein übernommen, (iv) der Beigeladene zu 1) ist in allen vier Fällen Routen gefahren, die der Kläger ihm nach Kundenaufträge des Klägers vorgegeben hatte, (v) die Tätigkeit des Beigeladenen zu 1), also die Ausführung der Fahrten, hat sich von der Tätigkeit der angestellten Fahrer des Klägers nicht wesentlich unterschieden und (vi) der Beigeladene zu 1) ist nach Außen ebenso wenig als Selbstständiger aufgetreten, wie die Fahrer des Klägers.
Zwar hat der Kläger ursprünglich geltend gemacht, dass die Lkw-Nutzungskosten in die Vergütung für die Fahrten mit einkalkuliert gewesen sei. Hierfür lassen sich jedoch keinerlei Anhaltspunkte finden, es ist nicht nachvollziehbar, ob oder in welchem Umfange Anschaffungs- und Betriebsausgaben des Klägers auf den Beigeladenen zu 1) im Verhältnis zu den ihm zuzuschreibenden Laufleistungen in irgendeiner rechnerischen Form einbezogen worden wären. Darüber hinaus hat der Beigeladene zu 1) im Ermittlungsverfahren glaubhaft angegeben, dass sich seine Vergütung an dem Lohn orientiert hatte, die die angestellten Fahrer des Klägers für entsprechende Fernfahrten erhalten hätten.
Demgegenüber sind im Falle der Tätigkeit des Beigeladenen zu 1) zwar auch Elemente zu erkennen, die für eine Selbstständigkeit der Fahrertätigkeit sprechen, wie der Kläger in der Berufung zu Recht geltend macht. Dies sind – das nicht vollständige in Anspruchnehmen der Arbeitskraft des Klägers, – das nur fallweise Tätigwerden, – die – wenn auch in geringem Maße – andere Vergütung als die der angestellten Fahrer, – die Haftung für unrechtmäßiges Verhalten sowie – das Fehlen der Entgeltfortzahlung im Urlaubs- und im Krankheitsfalle und – die Anmeldung eines eigenen Transportgewerbe angemeldet und die Zulassung als Transportunternehmer.“[8]
10
Dieses Beispiel zeigt, dass die im Rahmen einer arbeitsrechtlichen Statusabgrenzung entscheidenden Kriterien vorliegender Weisungen nach Inhalt, Zeit und Ort sowie einer betrieblichen Eingliederung jedenfalls in dem hier geschilderten Fall – wenn überhaupt – nur eine unwesentliche Rolle für die Begründung des sozialrechtlichen Beschäftigtenstatus gespielt haben; entscheidende Bedeutung kam dagegen wirtschaftlichen Parameternzu, wie etwa der Stellung der wesentlichen Arbeitsmittel, den Kosten für die Instandhaltung sowie Nutzung dieser Arbeitsmittel, Haftungsfragen etc.
11
Dennoch können diese Unterschiede nicht überbewertet werden. Im Ergebnis kommt es auch im Sozialversicherungsrecht auf eine Gesamtabwägung der bekannten Abgrenzungskriterien an. Um bei dem Bespiel der Betriebsmittel zu bleiben: Zwar geht die Rechtsprechung des BSG davon aus, dass die Benutzung des eigenen Kraftfahrzeugs und die damit einhergehende Lastentragung für eine selbstständige Tätigkeit sprechen kann; unterliegt die Ausübung der Tätigkeit dennoch der Kontrolle des Auftraggebers, dessen Fahrdienstleiter das Fahrzeug gelegentlich begleiten und ist der Dienstverpflichtete gehalten, während der Tätigkeit für den Auftraggeber dessen Firmenschild anzubringen und macht der Auftraggeber zudem noch Vorschriften über die Beladung, tritt demgegenüber das Eigentum an Betriebsmitteln regelmäßig zurück.[9] Dagegen können selbst Piloten, die selbstredend in aller Regel nicht Eigentümer des wesentlichen Arbeitsmittels Flugzeug sind, selbstständig tätig sein, wenn diese Tätigkeit ohne die Aufnahme in fremdbestimmte Dienstpläne etc. im Wesentlichen weisungsfrei und ohne eine betriebliche Eingliederung erfolgt.[10]
[1]
BSG NZA 2014, 650; BSG SGb 2013, 337; BSG SGb 2014, 213; BSG NZA-RR 2013, 252; BSG SGb 2012, 331; BSG ZfS 2006, 84; BSG NZA 2012, 440; BSG SGb 2009, 283; BSG SGb 2008, 401; BSG ZfS 2005, 215; BSG NZA-RR 2000, 434; LSG Bayern 29.4.2014 – L 5 R 11/13; LSG Sachsen 4.3.2014 – L 1 KR 9/11; LSG Berlin NZA 1995, 139.
[2]
BSG SGb 2009, 283.
[3]
Eine alphabetische Zusammenfassung der maßgeblichen Abgrenzungskriterien einschließlich der jeweils relevanten Rechtsprechung liefert Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann/ Berchthold § 7 SGB IV Rn. 23 m.w.N.
[4]
Vgl. BeckOK/ Rittweger § 7 SGB IV Rn. 4, „Ein sozialrechtliches Beschäftigungsverhältnis wird praktisch in mehr als 95 % der Fälle identisch sein mit dem arbeitsrechtlichen Arbeitsverhältnis und dem steuerrechtlichen Dienstverhältnis.“
[5]
Vgl. Brand NZS 1997, 552, 555 m.w.N.
[6]
BSG NZA 2014, 650; BSG SGb 2013, 337; BSG 20.3.2013 – B 12 R 13/10 R; BSG NZA-RR 2013, 252; BSG SGb 2012, 331; BSG ZfS 2006, 84; BSG NZA 2012, 440; BSG SGb 2009, 283; BSG SGb 2008, 401; BSG ZfS 2005, 215; BSG NZA-RR 2000, 434; LSG Bayern 29.4.2014 – L 5 R 11/13; LSG Sachsen 4.3.2014 – L 1 KR 9/11; LSG Berlin NZA 1995, 139; vgl. auch BSG Die Beiträge 1985, 568 m.w.N.
[7]
Vgl. insbesondere BSG SGb 2009, 283; BSG ZfS 2005, 215; LSG Bayern NZS 2012, 908; LSG Nordrhein-Westfalen 1.6.2012 – L 8 R 150/12 B ER.
[8]
LSG Bayern NZS 2012, 908.
[9]
BSG NZA 2004, 200; BSG NZS 2006, 318.
[10]
BSG SGb 2008, 401.
2. Teil Der Arbeitgeberbegriff in der deutschen Rechtsordnung› 2. Kapitel Definition des sozialversicherungsrechtlichen Arbeitgeberbegriffs› III. Fazit
12
Insgesamt ist im Rahmen der sozialversicherungsrechtlichen Statusbestimmung auf die gleichen Kriterien zurückzugreifen, die unter dem Gesichtspunkt des arbeitsrechtlichen Arbeitgeberbegriffsbereits umfassend beleuchtet wurden. In beiden Rechtsgebieten ist eine tätigkeitsbezogene Perspektive, die entscheidend auf die Merkmale vorliegender Weisungen und einer betrieblichen Eingliederung abstellt, maßgeblich. Aufgrund der wirtschaftlichen und sozialen Schutzfunktion des Sozialversicherungsrechts können darüber hinaus aber auch wirtschaftlichen Parametern wie etwa dem Tragen eines unternehmerischen Risikos, der Nutzung eigener Betriebsmittel oder sonstiger Modalitäten wie vereinbarten Vertragsstrafen eine gewichtigere Rolle zukommen als im Arbeitsrecht. Dennoch bleibt eine tätigkeitsbezogene Perspektive auch hier im Ergebnis entscheidend. Deshalb ist auf die ausführlichen Anmerkungen zum arbeitsrechtlichen Arbeitgeberbegriff zu verweisen, die im Grundsatz auch auf den sozialversicherungsrechtlichen Arbeitgeberbegriff übertragen werden können (vgl. 2. Teil 1. Kap.).
2. Teil Der Arbeitgeberbegriff in der deutschen Rechtsordnung› 3. Kapitel Definition des steuerrechtlichen Arbeitgeberbegriffs
3. Kapitel Definition des steuerrechtlichen Arbeitgeberbegriffs
Inhaltsverzeichnis
I. Einführung
Читать дальше