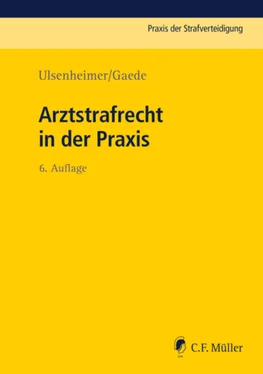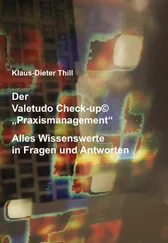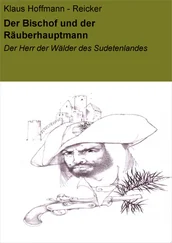Klaus Ulsenheimer - Arztstrafrecht in der Praxis
Здесь есть возможность читать онлайн «Klaus Ulsenheimer - Arztstrafrecht in der Praxis» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Arztstrafrecht in der Praxis
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Arztstrafrecht in der Praxis: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Arztstrafrecht in der Praxis»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Arztstrafrecht in der Praxis — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Arztstrafrecht in der Praxis», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
b) Auffangfunktion des Aufklärungsfehlers
320
Gerade wenn man die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrenmit in die Betrachtung einbezieht und die amtsrichterliche Spruchpraxisin Gestalt rechtskräftiger Strafbefehle durchforstet, tritt der Aufklärungsfehler weitaus häufiger in Erscheinung, und zwar meist als Annex oder nachgeschobener zusätzlicher Vorwurf. Insofern kann man auch in Strafverfahren immer wieder die Feststellung machen, die derjenigen in Arzthaftungsprozessen vor den Zivilgerichten gleicht: Das Schwergewicht der Anzeige oder der von Amts wegen aufgenommenen Ermittlungen liegt zunächst auf einem ärztlichen Behandlungsfehler, dessen Nachweis jedoch im konkreten Fall schwierig ist oder – meist nach Einholung eines Gutachtens – scheitert. In einer Vielzahl von Fällen weichen Anzeigeerstatter und Staatsanwalt dann auf den Vorwurf unzureichender oder fehlender Aufklärung aus,[8] der somit auch hier eine Auffangfunktion übernimmt.[9] Insofern vermag ich weder Ulrich zuzustimmen, wenn er unter Hinweis auf den im Strafprozess geltenden Grundsatz in dubio pro reo meint, „die Chance einer Strafanzeige“ erhöhe sich „nicht deshalb, wenn allein oder zusätzlich“ ein Aufklärungsmangel gerügt wird,[10] noch überzeugt die These von Lilie/Orben [11], die Bedeutung des Aufklärungsfehlers sei im Strafverfahren durch die Beweiskraft der Aufklärungsformulare „limitiert“. Richtig ist zwar, dass die Beweislast für die Risikoaufklärung im Strafverfahren nicht – wie im Zivilprozess – beim beschuldigten/angeklagten Arzt liegt, die „marktgängigen“ Merkblätter zur Dokumentation der Aufklärung bei richtigem Gebrauch beweiskräftig sind und es im Strafprozess auch keinen Anscheinsbeweis gibt. Dies ändert jedoch nichts daran, dass der Verstoß gegen die ärztliche Aufklärungspflicht angesichts der bestehenden Unklarheit über ihren Umfang, der – verfehlten – Übernahme der zum Teil überstrengen Grundsätze der zivilrechtlichen Judikaturdurch die Strafgerichte (gegen diese Rn. 337 ff.),[12] der vielfach ungenügenden Aufklärungsdokumentation und – deshalb vor allem – infolge der Stellung des Verletzten als „Kronzeuge“der Staatsanwaltschaft viel leichterbeweisbar ist.[13]
c) Einige Beispiele
321-
335
| 1. | Die Patientin erhob Strafanzeige, gestützt auf die Behauptung, der Arzt habe sowohl beim operativen Eingriff selbst – einer Hautabschleifung mit Peeling – als auch im Rahmen der postoperativen Nachsorge Behandlungsfehler begangen. Nachdem mehrere Gutachter dies verneint hatten, schob die Patientin den Vorwurf nach, der Angeklagte habe sie nicht auf die Möglichkeit einer erhabenen Narbenbildung mit entstellendem Charakter hingewiesen. Der angeklagte Arzt bestritt dies nachdrücklich und betonte, er habe der Patientin den technischen Vorgang der sog. Chemabrasio erläutert, auf die speziellen Gefahren und Komplikationsmöglichkeiten durch den Vergleich „mit einer großflächigen Schürfwunde“ hingewiesen und außerdem auch davon gesprochen, „dass bei einer Schürfwunde flächenhafte, polsterartige Narben zurückbleiben könnten“. Zumal der Beschuldigte jedoch im Strafprozess – anders als die Zeugin – nicht der Wahrheitspflicht unterliegt, folgte das Landgericht – wie zuvor schon das Amtsgericht – ihrer Aussage und verurteilte den Chirurgen wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen[14]. |
| 2. | Im Anschluss an eine Leistenbruchoperation kam es zu einer Hodenatrophie, weshalb der Patient dem Arzt einen „Kunstfehler“ vorwarf. Da sich jedoch nicht einwandfrei klären ließ, ob die so genannte Bassini-Naht zu eng gelegt war, prüfte die Staatsanwaltschaft die Aufklärungsfrage und stellte fest, der Patient sei über die Möglichkeit des Eintritts dieser typischen Komplikation nicht unterrichtet worden, was der beschuldigte Arzt energisch bestritt. Da der Stationsarzt die Aufklärung vorgenommen hatte, stand ein „unverdächtiger“ Zeuge für den Gegenbeweis zur Verfügung, doch hinderte dies die Staatsanwaltschaft nicht, gegen das freisprechende Urteil des Landgerichts – erfolglos – Revision einzulegen.[15] |
| 3. | Die Anzeigeerstatterin erhob gegen „ihre“ Frauenärztin den Vorwurf, die Empfehlung und Einlage eines IUP (Intrauterinpessars) sei kontraindiziert gewesen und habe einer Eileiterentzündung Vorschub geleistet. Der von der Staatsanwaltschaft beauftragte Sachverständige hielt das Vorgehen der Ärztin zwar für bedenklich, verneinte aber einen Verstoß gegen die ärztlichen Sorgfaltspflichten. Obwohl die Anzeigeerstatterin ausdrücklich in einem Anwaltsschriftsatz vortragen ließ, ihr komme es nur auf die Feststellung eines Behandlungsfehlers an, untersuchte die Staatsanwaltschaft auf Grund gewisser Äußerungen des Sachverständigen die Frage, ob die Beschuldigte die damals 17-jährige Patientin ordnungsgemäß aufgeklärt hatte. Während die Ärztin dies bejahte und das Aufklärungsgespräch eingehend schilderte, behauptete die Anzeigeerstatterin als Zeugin in – wie die Staatsanwaltschaft meinte – „unzweifelhafter und völlig glaubhafter Weise“ (!) das Gegenteil. Das Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde erst gegen Zahlung einer Geldbuße von 5.000 DM gem. § 153a StPO eingestellt.[16] |
| 4. | Bei einer 85-jährigen Patientin stellten sich plötzlich Durchblutungsstörungen am rechten Bein ein, die eine sofortige Amputation zur Lebensrettung notwendig machten. Die Angehörigen – Kinder und Enkelkinder – fühlten sich übergangen und erstatteten Strafanzeige, weil man nicht rechtzeitig einen Pfleger (heute: Betreuer) bestellt und die Einwilligung zu der Operation eingeholt habe. Die Staatsanwaltschaft teilte diese Auffassung und beantragte den Erlass eines Strafbefehls von 60 Tagessätzen, gegen den der Arzt Einspruch einlegte. Den Einwand der Verteidigung, abgesehen vom Vorliegen der Voraussetzungen der mutmaßlichen Einwilligung und des rechtfertigenden Notstandes nach § 34 StGB wäre der Pfleger zur Erteilung der Zustimmung zu der vital indizierten ärztlichen Maßnahme verpflichtet gewesen und daher die fehlende Aufklärung für den Gesundheitsschaden nicht kausal , wies die Staatsanwaltschaft als unzutreffend zurück. Ihre fast groteske Begründung lautete: Da als Pfleger der Enkel der Patientin bestellt worden wäre und dieser ausweislich der Ermittlungsakten sein Einverständnis mit der vorgenommenen ärztlichen Maßnahme nicht erklärt hätte, sei die Kausalität des Aufklärungsmangels evident und der Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung begründet. Demgegenüber entschied das Amtsgericht Schongau zu Recht auf Freispruch. |
| 5. | Bei einer laparoskopisch durchgeführten Blinddarmoperation eines neun Jahre alten Jungen verletzte der chirurgische Chefarzt die Beckenschlagader. Trotz zweier Versuche gelang es ihm nicht, die verletzte Arteria illiaca erfolgreich zu übernähen, so dass er den Patienten in das nächstgelegene Krankenhaus mit einem gefäßchirurgischen Spezialisten verlegte. Infolge der über mehrere Stunden anhaltenden Mangeldurchblutung des rechten Beines starben die Muskeln und Nerven am rechten Unterschenkel des Kindes größtenteils ab, so dass die Unterschenkelmuskulatur später operativ entfernt werden musste. Das rechte Bein blieb deshalb auf Dauer geschädigt. Daraufhin erstattete die Mutter des Kindes Strafanzeige. Die Staatsanwaltschaft nahm sich des Falles mit ungeheurem Engagement an und warf in der Anklageschrift dem Mediziner vor, er habe die laparoskopische Methode noch nicht genügend beherrscht und deshalb die schwere Verletzung schuldhaft verursacht. Dies ließ sich in der Hauptverhandlung jedoch nicht mit der notwendigen Sicherheit nachweisen, so dass die Entscheidung ganz von der Beurteilung des weiteren Anklagevorwurfs abhing, es fehle die wirksame Einwilligung der Mutter, da sie nicht ordnungsgemäß aufgeklärt worden sei. Insoweit hatte der Operateur zwar die Stationsärztin gebeten, die Mutter über die laparoskopische Methode zu informieren, doch musste Erstere in der Hauptverhandlung vor Gericht einräumen, selbst über keine nennenswerten Kenntnisse in dieser neuartigen Technik zu verfügen und deshalb nicht in der Lage gewesen zu sein, über deren methodenspezifische Besonderheiten und Risiken sachgerecht aufzuklären. Ob die erforderliche Einwilligung vorlag, hatte der Angeklagte vor Beginn der Operation nicht mehr durch Einsichtnahme in das Aufklärungsformular oder Rückfrage geprüft. Darin sah das Gericht einen fahrlässigen Verstoß gegen die Regeln der ärztlichen Kunst und verurteilte ihn zu 60 Tagessätzen[17]. |
| 6. | Bei HWS-Dissektomien setzte der Angeklagte in der zweiten Hälfte des Jahres 1990 nach Entfernung der abgenutzten Halsbandscheibe als Abstandhalter einen aufbereiteten Rinderknochen („Surgibone“-Dübel) zwischen den angrenzenden Wirbelkörpern ein, obwohl zu jener Zeit in der Bundesrepublik üblicherweise Abstandhalter aus Eigenknochen oder aus Kunststoff verwendet wurden. Beide Verfahren haben unterschiedliche Vor- und Nachteile mit verschiedenen Komplikationsrisiken. Bei dem „Surgibone“-Dübel handelte es sich um ein nach dem deutschen Arzneimittelgesetz zulassungspflichtiges, vom Bundesgesundheitsamt zur Tatzeit aber nicht zugelassenes Arzneimittel, ein Umstand, über den der Arzt die Patientin nicht unterrichtet hatte. Die Methode war jedoch außerhalb Deutschlands, insbesondere in Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Skandinavien weit verbreitet. Ein Verstoß gegen den medizinischen Standard konnte dem Angeklagten daher nicht nachgewiesen werden. Das Landgericht verurteilte ihn jedoch wegen (vorsätzlicher (!)) Körperverletzung zu einer Gesamtgeldstrafe von 100 Tagessätzen, da es in sechs Fällen im Anschluss an die von ihm durchgeführten Operationen zu Spankomplikationen, erneuten Beschwerden und teilweise zu Zweiteingriffen gekommen war, d.h. zur Verwirklichung von Risiken, über die die Patienten nicht aufgeklärt worden waren. „Von einer umfassenden Aufklärung über die unterschiedlichen Materialien der gebräuchlichen Interponate sowie ihre spezifischen Vor- und Nachteile war auf Anweisung des Angeklagten jeweils abgesehen worden, um die Patienten nicht zu verunsichern“. Der BGH hob das Urteil auf,[18] da der Angeklagte von der Vorstellung ausgegangen war, er müsse die Patienten über die Möglichkeit der Verwendung anderer Interponate nicht unterrichten, also irrig einen rechtfertigenden Sachverhalt angenommen hatte, der die Strafbarkeit wegen vorsätzlicher Tat ausschließt. Darüber hinaus gab der BGH für die neue Hauptverhandlung dem Tatgericht auf, die Frage der hypothetischen Einwilligung und den Aspekt des Schutzzwecks der Norm näher zu prüfen. |
| 7. | In einem weiteren Strafverfahren – ausgelöst durch eine Strafanzeige der Patientin – stand im Mittelpunkt der Vorwurf, durch den bei der Geburt erfolgten Dammschnitt habe sie sich eine Schließmuskelverletzung zugezogen. Wörtlich heißt es: „Die Vornahme des Dammschnitts dergestalt, dass der Schließmuskel verletzt wird, stellt einen Behandlungsfehler dar. Zumindest hätte man der Gebärenden darüber Aufklärung geben müssen, dass bei einem Dammschnitt eine Schließmuskelverletzung als Komplikation möglich ist“, was der Patientin „die Möglichkeit gegeben hätte zu entscheiden, ob sie dieses Risiko eingehen oder von vornherein die Geburt im Wege des Kaiserschnitts durchführen lassen will“. Nach Ansicht des Sachverständigen stellt der Dammschnitt jedoch „keine aufklärungspflichtige geburtshilfliche Maßnahme dar. Es handelt sich um eine insbesondere im Rahmen einer operativen Entbindung erforderliche Zusatzmaßnahme“. Das Ermittlungsverfahren wurde daraufhin eingestellt.[19] |
| 8. | Bei einem Schwangerschaftsabbruch kollabierte die Patientin nach Verabreichung eines Lokalanästhetikums und verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen zwei Tage später. Umfangreiche fachanästhesiologische und rechtsmedizinische Untersuchungen ergaben, dass das für die örtliche Betäubung der Patientin verwandte Lokalanästhetikum nicht kontraindiziert gewesen und die bei der Paracervikalblockade erfolgte Verletzung eines kleineren Gefäßes „nicht mit letzter Sicherheit“ vermeidbar gewesen sei. Diese Gefäßverletzung war jedoch offenbar ursächlich für den weiteren Verlauf, da der Wirkstoff Bupivacain dadurch in die Blutbahn der Patientin gelangt war und einen nicht vorhersehbaren und nicht vermeidbaren Herz-Kreislauf-Stillstand ausgelöst hatte. Da auch die sofort durchgeführten Reanimationsmaßnahmen lege artis erfolgten, war nach Auffassung des Staatsanwaltes „lediglich noch die Frage zu prüfen, ob der Eingriff infolge einer unvollständigen Risikoaufklärung mangels wirksamer Einwilligung rechtswidrig war“. Insoweit heißt es in der Einstellungsverfügung, die Patientin sei „nur über das möglicherweise in einen Herz-Kreislauf-Stillstand mündende Risiko eines allergischen Schocks“, nicht aber „über das Risiko einer intravasalen Injektion“ aufgeklärt worden, doch scheitere „eine Strafbarkeit des Beschuldigten wegen Körperverletzung an der fehlenden Kausalität des Aufklärungsmangels für die Einwilligung der Patientin“. Da diese „trotz des ihr bekannten geringeren Risikos der Vollnarkose auf jeden Fall der Anwendung der Lokalanästhesie den Vorzug gegeben hätte, hätte sie auch das damit verbundene gesteigerte Risiko eines Herz-Kreislauf-Stillstands infolge eines allergischen Schocks in Kauf genommen“.[20] |
| 9. | Um die Problematik der ordnungsgemäßen ärztlichen Aufklärung und anschließenden Einwilligung der Patientin ging es wiederholt auch in Fällen, in denen im Zusammenhang mit einem Schwangerschaftsabbruch oder einem Kaiserschnitt die Patientin sterilisiert worden war.[21] Während der Arzt im konkreten Fall angegeben hatte, die Patientin am Tag der Entbindung ausführlich auch über die Sterilisation anhand eines Merkblattes aufgeklärt zu haben, das anschließend mit der Ergänzung „Tubensterilisation“ von ihr unterzeichnet worden sei, bestritt diese das Aufklärungsgespräch und die Unterzeichnung des Merkblattes. Die fatale Beweissituation, in die der Arzt bei solchen Sachverhaltskonstellationen geraten kann, zeigt die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft wegen schwerer Körperverletzung gem. §§ 223, 226 Abs. 1, Abs. 2 StGB, weil man der Patientin (Zeugin) Glauben schenkte und deshalb eine Urkundenfälschung des Angeschuldigten annahm.[22] |
| 10. | In einem anderen Fall hatte die Patientin nach Aufklärung über die Sterilisation eine Einwilligungserklärung sowohl für die Kaiserschnittsoperation als auch für die Sterilisation unterschrieben, machte aber später geltend, sie habe wegen unzureichender Deutschkenntnisse kaum etwas verstanden. Diese Behauptung ließ sich jedoch nicht nachweisen, so dass der Arzt vom LG München II rechtskräftig freigesprochen wurde.[23] |
| 11. | Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen fahrlässiger Tötung und vorsätzlicher Körperverletzung erhob die Tochter der verstorbenen Patientin den Vorwurf, der herbeigerufene Notarzt habe trotz ihrer Hinweise auf die Unverträglichkeit bzw. Überempfindlichkeit ihrer Mutter bezüglich des Schmerzmittels Analgin dieses zur Schmerzbekämpfung gespritzt. Demgegenüber behauptete der Arzt, er habe die Patientin vor der Injektion über das beabsichtigte Präparat Analgin und dessen Zweck aufgeklärt. In diesem Gespräch habe die Patientin keine Einwendungen wegen einer Analgin-Unverträglichkeit geäußert. Das Ermittlungsverfahren[24] wurde aus tatsächlichen Gründen (Zeugenaussage des Rettungssanitäters) eingestellt. |
| 12. | In einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung wurde dem beschuldigten Chefarzt sowohl ein Behandlungs- als auch ein Aufklärungsfehler vorgeworfen. Er habe zum einen die Koloskopie in völlig unüblicher Weise vorgenommen und dadurch den aufgeblähten Dickdarm perforiert. Zum anderen sei der Patient auf das Perforationsrisiko nicht hingewiesen worden. Beide Vorwürfe stammten von den Oberärzten der Klinik, erwiesen sich jedoch als unbegründet.[25] |
| 13. | Bei der Einleitung der Intubationsnarkose aspirierte das 2-jährige Kind, dessen gebrochener Unterarm reponiert werden musste, in erheblichem Umfang, so dass es künstlich beatmet wurde und mehrere Tage auf der Intensivstation lag. Die Eltern waren über „den ganzen Geschehensablauf empört“ und erstatteten „gegen die behandelnden Ärzte“ Strafanzeige wegen fehlerhafter Narkoseführung und mangelnder Aufklärung über das lebensgefährliche Risiko. Auf die erhöhte Aspirationsgefahr des nicht nüchternen Kindes und die eventuelle Notwendigkeit einer Beatmungshandlung waren die Eltern jedoch im Rahmen eines ausführlichen Aufklärungsgesprächs hingewiesen worden.[26] |
| 14. | Die Patientin wünschte eine Brustvergrößerung und behauptete als Zeugin in der Hauptverhandlung, in dem präoperativ geführten Aufklärungsgespräch habe sie auf Grund negativer Medienberichte die Implantation eines Silikonpräparates ausdrücklich abgelehnt. Der angeklagte Arzt, der eine Doppellumenprothese mit einem Silikonkern eingesetzt hatte, bestritt dies nachdrücklich. Das Gericht folgte jedoch in vollem Umfang den Angaben der Zeugin, so dass – nach einer Anklage wegen vorsätzlicher (!) Körperverletzung – eine Verurteilung (allerdings wegen Fahrlässigkeit) nicht zu vermeiden war, zumal der gerichtliche Sachverständige auch noch die Lage des Implantats als nicht sachgerecht bezeichnete und damit einen Behandlungsfehler bejahte.[27] |
| 15. | Gestützt auf die Zeugenaussage der Patientin erließ das Amtsgericht einen Strafbefehl gegen den bei der Operation verantwortlichen Anästhesisten, da sie im Aufklärungsgespräch ausdrücklich auf einen Lymphstau im rechten Arm aufmerksam gemacht habe und deshalb an diesem keine Blutentnahme oder sonstige ärztliche Maßnahme vorgenommen werden sollte. Der Anästhesist legte jedoch bei Einleitung der Narkose am rechten Arm einen venösen Zugang für die weiterführende postoperative Infusionstherapie. Die gegenteilige Sachdarstellung des Anästhesisten nützte nichts: Weil er sich über die erklärten Bitten der Patientin hinweggesetzt habe, sei er wegen fahrlässiger Körperverletzung zu bestrafen, wobei strafschärfend gewertet wurde, dass das Handeln des Arztes „an der Grenze zwischen grober Fahrlässigkeit und Vorsatz“ liege.[28] |
Die Fallbeispiele machen deutlich, dass der Arzt gegenüber dem Vorwurf fehlender, unvollständiger oder verspäteter Aufklärung im Strafprozess oft in einer aussichtslosen Verteidigungsposition ist, da der Patient auf Grund seiner Zeugenstellung und der daraus resultierenden Wahrheitspflicht fast immer das „Glaubwürdigkeitsduell“ mit dem Arzt gewinnt, der als Beschuldigterbzw. Angeklagterohne Sanktion die Unwahrheit sagen darf. Seine Beweisnot ist daher – trotz des Grundsatzes in dubio pro reo im Strafverfahren – in der Praxis kaum anders als im Zivilprozess. Deshalb ist der Arzt auf dem Feld der Aufklärung leicht „verwundbar“.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Arztstrafrecht in der Praxis»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Arztstrafrecht in der Praxis» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Arztstrafrecht in der Praxis» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.