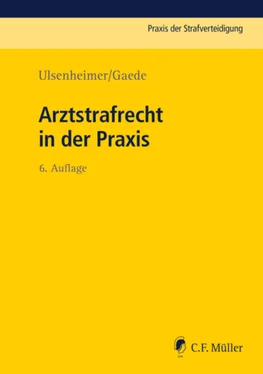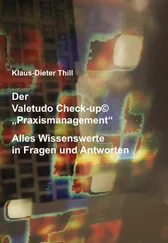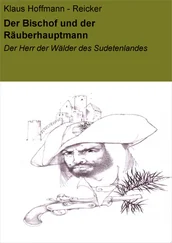I. Die Problemstellung
II.Die grundlegenden Entscheidungen (Sachverhalt)
1. BGHSt 32, 367 ff. („Fall Dr. Wittig“)
2. OLG München JA 1987, 579 ff. („Fall Prof. Hackethal“)
3. LG Ravensburg NStZ 1987, 229 ff
4. BGHSt 40, 275 ff. („Kemptener Fall“)
5. BGHSt 42, 301 ff. = BGH NStZ 1997, 182
6. BGHSt 46, 279 ff. = BGH JZ 2002, 150 ff
7. BGH Beschl. v. 17.3.2003 – XII ZB 2/03
8. BGHZ 163, 195 = BGH NJW 2005, 2385 ff.
9. BGH Urt. v. 25.6.2010 – II StR 454/09 (Fall Putz)
10. BGH NJW 2011, 161 = NStZ 2011, 274 = ZfL 2011, 20
11. BGH Beschl. v. 17.9.2014 – XII ZB 202/13
12. BGH Urt. v. 6.7.2016 – XII ZB 61/16
13. BGH Beschl. v. 8.2.2017 – XII ZB 604/15
14. BGH Beschl. v. 14.11.2018 – XII ZB 107/18
15. BGH Urt. v. 2.4.2019 – VI ZR 13/18
III.Weitere Fallbeispiele
1. BVerwG Urt. v. 2.3.2017 – III C 19.15
2. BVerwG Urt. v. 28.5.2019 – III C 6.17
IV. Leitsätze (Entscheidungskriterien) und Differenzierungen
V. „Direkte“ und „indirekte“ Sterbehilfe
1. Direkte Sterbehilfe
2. Indirekte Sterbehilfe
VI.Sterbehilfe durch Behandlungsabbruch
1. Sterbehilfe „im eigentlichen“ und „im weiteren“ Sinne
2. Maßgeblichkeit des aktuellen Patientenwillens
3. Maßgeblichkeit des antizipativen Willens
4. Maßgeblichkeit des Behandlungswunsches/mutmaßlichen Willens
a) Strenge Prüfungsvoraussetzungen
b) Rückgriff auf allgemeine Wertvorstellungen
c) Erforschung des individuellen mutmaßlichen Willens
d) Betreuerbestellung und Einschaltung des Betreuungsgerichts
e) Entscheidung pro vita in Zweifelsfällen
f) Keine „einsamen“ Entscheidungen
5. Pflicht zur Rettung des bewusstlosen Patienten unter Inkaufnahme irreparabler schwerer Schäden? – Ein Fallbeispiel aus der Praxis
VII. Zum ärztlich assistierten Suizid
1.Grundlegende Entscheidungen vor 2019
a) OLG München 1987
aa) Unterlassene Hilfeleistung
bb) Berufspflichtverletzung
b) VG Berlin Urt. v. 30.7.2012 – 9 K 63.09 = ZfL 2012, 80 ff.
c) LG Gießen 2012
d) StA LG München I 2010
e) LG Deggendorf 2013
2. Das „Hamburger“ und das „Berliner“ Urteil des BGH 2019
a) Der Hamburger Fall
aa)Kein Tötungsdelikt durch aktives Tun
(1) Straflose Beihilfe
(2) Keine mittelbare Täterschaft bei freiverantwortlichem Suizidenten
bb) Keine vollendete Tötung durch Unterlassen
cc) Keine versuchte Tötung durch Unterlassen mangels Garantenstellung
(1) Keine Übernahme der ärztlichen Behandlung
(2) Keine Garantenstellung aus vorangegangenem gefährlichen Tun (Ingerenz)
(3) Keine Garantenstellung durch Verletzung der Bundesärzteordnung oder des ärztlichen Standesrechts
(4) Pflichtwidrige geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung?
dd) Keine unterlassene Hilfeleistung
b) Der Berliner Fall
aa) Kein vollendetes Tötungsdelikt durch aktives Tun
(1) Keine Tatherrschaft des Angeklagten
(2) Keine mittelbare Täterschaft mangels Verantwortlichkeitsdefizits
(a) Kein Ausschluss der Freiverantwortlichkeit des Selbsttötungsentschlusses
(b) Langjähriger ernsthafter Todeswunsch
(3) Gabe muskelentspannender Medikamente nicht kausal für Tod
(4) Verhindern von Rettungsbemühungen
bb)Mangels Garantenstellung keine versuchte Tötung durch Unterlassen
(1) Vereinbarung einer Sterbebegleitung
(2) Anspruch, in Ruhe sterben zu dürfen
(3) Keine Verpflichtung, gegen den Willen des Suizidenten zu handeln
(4) Verschaffen der Medikamente
cc) Keine unterlassene Hilfeleistung
c) Bewertung der Urteile
3. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu § 217 StGB
a) Hintergrund des Urteils
b) Recht auf selbstbestimmtes Sterben
aa) Recht auf Selbsttötung ohne Reichweitenbegrenzung und Freiheit, angebotene Hilfe in Anspruch nehmen zu dürfen
bb) Unverhältnismäßiger Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht
cc) Keine Verpflichtung zur Suizidhilfe
dd) Verbote in den ärztlichen Berufsordnungen verfassungsrechtlich bedenklich
ee) Europäische Menschenrechtskonvention
ff) Voraussetzungen autonomer Selbstbestimmung
(1) Freier Wille
(2) Umfassende Aufklärung und Beratung
gg) Möglichkeiten des Gesetzgebers zur Regulierung der Suizidhilfe
4. VG Köln und erneute Entscheidung des BVerfG
a) Erlaubnis zum Erwerb von Betäubungsmitteln
b) Verschreibung von Betäubungsmitteln zur Selbsttötung nicht erreicht
c) Erlaubnisanträge nicht erfolgreich
d) Zur Anpassung des Betäubungsmittelrechts
5.Ausblick
a) Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben
b) Recht Dritter, ihre Bereitschaft zur Suizidhilfe rechtlich umzusetzen
c) Grenzen zu § 216 StGB neu definieren?
VIII. Grenzen der Behandlungspflicht bei schwerstgeschädigten Neugeborenen
Teil 4 Strafrechtliche Probleme der Organ- und Gewebetransplantation
I. Die Entnahme von und der Handel mit Organen und Gewebe von Lebenden
1. Begrenzte Zulässigkeit der Lebendorganspende
a) Näher geregelte Einwilligung
b) Arztvorbehalt und Subsidiarität der Lebendspende
c) „Besondere persönliche Verbundenheit“
2.Strafbarkeit der Entnahmen bei Lebendorganspenden
a) § 19 Abs. 1 und 4 TPG
b) Anwendbarkeit des StGB (Konkurrenzen)
II.Die Entnahme von Organen und Gewebe von Verstorbenen
1. Die Zulässigkeit der Organ- und Gewebeentnahme bei Verstorbenen
2. Strafbarkeit der Entnahmen bei Verstorbenen
a) § 19 Abs. 2, 4 und 5 TPG
b) (Weitere) Anwendbarkeit des StGB
3. Im Besonderen: Der strafbare Organhandel (§§ 17, 18 TPG)
III. Implantation fremder Organe
IV. Manipulationen bei der Organallokation
1. Spezialtatbestand des § 19 Abs. 2a TPG
2. Strafbarkeit nach den Tötungs- und Körperverletzungsdelikten
a) Höchstrichterliche Rechtsprechung
b) Praktische Folgen und Bewertung
V. Verstöße gegen Datenschutzbestimmungen
VI. Literaturhinweise
Teil 5 Schwangerschaftsabbruch (§§ 218–219b StGB)
I. Zur Entstehungsgeschichte der gesetzlichen Bestimmungen
II. Übersicht über die gesetzlichen Regelungen
1. Keine Strafbarkeit nidationshindernder Maßnahmen nach dem StGB
2. Die Strafvorschriften und die gesetzlichen Ausnahmen von der Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs
3. Die Vorschrift des § 219 StGB
III.Einzelfragen
1.Abgrenzung des Schwangerschaftsabbruchs von den Tötungs- und Körperverletzungsdelikten
a) Die rechtliche Bedeutung des „Beginns der Geburt“
b) Maßgeblichkeit des Zeitpunkts der schädigenden Einwirkung
c) Die Eröffnungswehen als Bestimmungskriterium für den „Beginn der Geburt“
d) Fallbeispiele
2. Tatobjekt des § 218 StGB
3. Tathandlung des § 218 StGB
4. Subjektiver Tatbestand des § 218 StGB
5. Täterschaft und Teilnahme am illegalen Schwangerschaftsabbruch
6. Strafschärfungs- und Strafmilderungsgründe (§ 218 Abs. 2 und Abs. 3 StGB)
7. Der Versuch des illegalen Schwangerschaftsabbruchs
8. Der Tatbestandsausschluss gemäß § 218a Abs. 1 StGB
9. Der Rechtswidrigkeitsausschluss gemäß § 218a Abs. 2 und Abs. 3 StGB
a)Die medizinisch-soziale Indikation (§ 218a Abs. 2 StGB)
aa) Allgemeines
bb) Speziell: Die Problematik eines späten Abbruchs der Schwangerschaft in Fällen des § 218a Abs. 2 StGB
cc) Die tatbestandlichen Voraussetzungen der medizinisch-sozialen Indikation
b) Die kriminologische Indikation (§ 218a Abs. 3 StGB)
10. Die Einwilligung der Schwangeren als Rechtfertigungsvoraussetzung in § 218a StGB
11. Der persönliche Strafausschließungsgrund des § 218a Abs. 4 S. 1 StGB und das Absehen von Strafe (§ 218a Abs. 4 S. 2 StGB)
Читать дальше