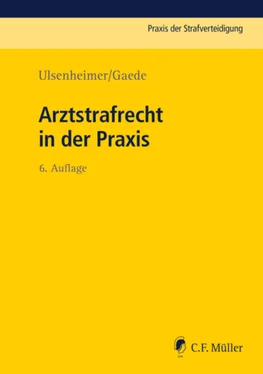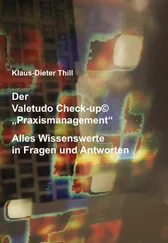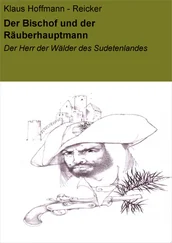aa) Grundlagen der Saldierung
bb) Streng formale Betrachtungsweise im Sozialrecht und begrenzte Saldierung
cc) Kritik der streng formalen Betrachtungsweise und gesetzgeberische Abkehr
dd) Formale Betrachtungsweise und Strafzumessung
ee) Schadensfeststellung durch Schätzung und Hochrechnung
3. Merkmale des subjektiven Tatbestandes
a) Vorsatz
aa) Nachweisanforderungen
bb) Problemfall streitige Anspruchslage – beachtliche Tatbestandsirrtümer
cc) Verteidigung über den Vorsatz?
b) Absicht rechtswidriger Bereicherung
aa) Objektiver Bezugspunkt: rechtswidriger Vermögensvorteil
bb) Stoffgleichheit zwischen Schaden und Vermögensvorteil
cc) Vorsatz bezüglich Rechtswidrigkeit und Stoffgleichheit
dd) Absicht bezüglich der Vorteilserlangung
4. Betrug als Korruptionsdelikt?
5. Übertragung auf die Abrechnung in der Pflege und Rückgriff auf den Verbrechenstatbestand
IV. Ausgewählte Einzelkonstellationen der Privatliquidation
1. Privatliquidation des niedergelassenen Arztes
a) Täuschung im Kontext der GOÄ
b) Irrtumsfeststellung bei Privatpatienten/Selbstzahlern
c) Verfügung und Schadensherleitung
aa) Strikte Medizinrechtsakzessorietät nach der Rechtsprechung
bb) Notwendige Kritik
d) Subjektiver Tatbestand
2. Abrechnungsbetrug im chefärztlichen Liquidationsbereich
a) Tatsachenbehauptungen und Rechtsansichten
b) Irrtumserregung
c) Vermögensschaden
aa) Leistungserbringung durch einen Vertreter
bb) Mögliche Vertretungsfälle
cc) Expertenqualität durch Vertreter
d) Vorsatz und Bereicherungsabsicht
V. Abrechnungsbetrug im Krankenhaus und Verantwortung der Leitungsebene
1. Besonderheiten und Fallgruppen der Krankenhausabrechnung
2. Abrechnungsbetrug durch leitende Verantwortliche insbesondere eines Krankenhauses
VI. Rechtsfolgen des Abrechnungsbetrugs
1. Strafmaß und Strafzumessung
2. Berufsverbot und Folgeverfahren
VII. Verzeichnis abgekürzt zitierter Spezialliteratur
Teil 15 (Vertragsarzt)-Untreue und Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt
I. Grundproblem des Untreuetatbestandes
II. Tatbestandssystematik und Deliktsmerkmale
1. Objektive Tatbestandsvoraussetzungen
a) Vermögensbetreuungspflicht
b) Tathandlung: Missbrauch oder Pflichtwidrigkeit
c) Vermögensnachteil infolge der Tathandlung
2. Subjektiver Tatbestand – Vorsatz
III. Untreue des Vertragsarztes
1. Etablierung und Infragestellung in der Rechtsprechung des BGH
2. Fortführung über Wirtschaftlichkeitsgebot und fehlende Kontrolle
3. Kritik der BGH-Rechtsprechung de lege lata
a) Fortfall der Vertreterthese und des Missbrauchstatbestandes
b) Ergebnisorientiertes Schleifen bisheriger Kriterien – Verschleifung
c) Unnötige Geringschätzung des Betruges
d) Überdehnung der Vermögensbetreuungspflicht
IV. Begrenzung der Untreue losgelöst von der Vermögensbetreuungspflicht
1. Mangelnde Pflichtwidrigkeit
2. Pflichtwidrigkeit jenseits einer Vermögensbetreuungspflicht
3. Strenge Anforderungen an den Vermögensnachteil
4. Mangelnder Vorsatz: Tatbestandsirrtümer und fehlende Inkaufnahme
V. Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt
Teil 16 Strafrechtliche Fragen des Infektionsschutzes und von Pandemien
I.Strafbarkeit nach dem Infektionsschutzgesetz
1. Überblick über das Infektionsschutzgesetz
2. Strafrechtliche Anknüpfung an das maßstabsetzende Verwaltungsrecht und konkrete Anordnungen
3. Verbreitungstatbestand des § 74 IfSG
4. Ggf. qualifizierte Zuwiderhandlungen gemäß § 75 IfSG
II. Strafbarkeitsrisiken nach dem StGB
1. Aktive Verbreitung des Virus
2. Schlechte oder fehlende Verbreitungsvorsorge
3. Unterlassene Hilfeleistung?
III. Triage in epidemischen oder pandemischen Mangelsituationen
1. Prämissen der Indikation und des Behandlungswunsches
2. Sog. ex ante-Triage
a) Rechtfertigende Pflichtenkollision
b) Kriterien der Entscheidung
3. Sog. ex post-Triage
a) Strafbarkeitsrisiko und Rechtfertigung
b) Mindestanforderungen an eine rechtmäßige ex post-Triage
4. Für die Zukunft: gesetzliche Regelung
Kapitel 2 Die Anwaltstätigkeit, insbesondere die Verteidigung in Arztstrafsachen
Teil 1 Die Funktionen des Anwalts in Arztstrafsachen
I. Die Übernahme des Verteidigermandats
1. Umfassende Information des Arztes
2. Klärung der prozessualen Rolle des Arztes
3. Vorermittlungen und informatorische Befragungen
4. Grundsatz: keine Einlassung zur Sache vor Akteneinsicht
5.Aufklärung des Arztes über seine elementaren Schutzrechte
a) Keine Selbstbezichtigung
b) Praktische Folgen des Schweigerechts
c) Keine generelle Anzeige- und Offenbarungspflicht für fremdes Fehlverhalten
d) Nemo-tenetur bei der ärztlichen Leichenschau
e) Keine Anzeigepflicht bei fahrlässiger Körperverletzung
f) Grenzen der Selbstbelastungsfreiheit
g) Informationspflicht betreffend eigene Behandlungsfehler
h) Offenbarung fremder Behandlungsfehler
i) Wahrung der eigenen Interessen
6. Weitere Verhaltensempfehlungen
7. Vorgehen gegen mutwillige Strafanzeigen und Presseberichte
II. Der Anwalt des Verletzten oder der Angehörigen eines verstorbenen Patienten
1. Erstattung der Strafanzeige
2. Einsicht in die Krankenunterlagen
3. Auswirkungen des Strafverfahrens auf den Zivilprozess
4. Konkrete Tätigkeiten im Strafverfahren
5. Das Klageerzwingungsverfahren
6. Nebenklage und Nebenklägervertreter
III. Der Anwalt als Rechtsbeistand eines Zeugen
1. Das Recht des als Zeuge geladenen Arztes auf anwaltlichen Beistand
2. Der Anwalt als Beistand des als Zeuge geladenen geschädigten Patienten
3. Grundsätzliche Fragen der Wahrnehmung der Beistandsfunktion für den Zeugen
IV. Sonstige anwaltliche Beratung anlässlich laufender Strafverfahren sowie über Compliance-Maßnahmen
Teil 2 Die Verteidigertätigkeit in den einzelnen Verfahrensabschnitten
I.Im Ermittlungsverfahren
1. Bedeutung des Ermittlungsverfahrens
a) Aktivität des Verteidigers
b) Ohne Akteneinsicht keine Einlassung
c) Formulierung des Akteneinsichtsgesuchs
d) Zeitpunkt der Akteneinsicht
2. Keine Weitergabe von Originalunterlagen, Übersendung von Fotokopien
3. Eigene Ermittlungstätigkeit des Verteidigers, insbesondere Einholung eines entlastenden Sachverständigengutachtens
a) Zu Punkt 1
b) Zu Punkt 2
c) Zu Punkt 3
4. Die schriftliche Einlassung zur Sache (Schutzschrift)
5. Anwesenheits- und Fragerecht bei richterlichen Vernehmungen von Zeugen oder Sachverständigen
6. Vermeidung der Anklage als Hauptziel
a) Die Verfahrenseinstellung nach §§ 153 und 153a StPO
b) Vor- und Nachteile der Verfahrenseinstellung gegen Zahlung einer Geldauflage
aa) Vorteile
bb) Nachteile
c) Gesichtspunkte für die Bejahung der Einstellungsvoraussetzungen nach § 153a StPO
d) Der Strafbefehl
aa) Vorteile
bb) Nachteile
e) Unterrichtung des Mandanten über die zu erwartende Höhe der Strafe und deren Folgen (Tagessatzprinzip, Begriff des Nettoeinkommens)
7. Abschluss des Ermittlungsverfahrens: Anklageschrift oder Strafbefehlsantrag
II. Die Verteidigertätigkeit im Zwischenverfahren
1. Prüfung des „hinreichenden Tatverdachts“
2. Prüfung der Prozessvoraussetzungen
3.Prüfung des Inhalts der Anklageschrift bzw. des Strafbefehls
a) Der Anklagesatz
b) Ergänzung des Anklagesatzes durch das „wesentliche Ergebnis der Ermittlungen“?
c) Rechtsfolgen einer mangelhaften Anklageschrift
Читать дальше