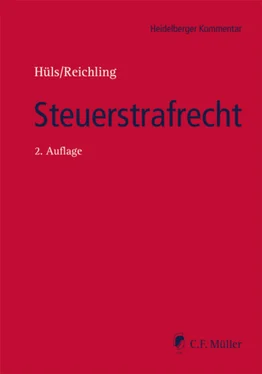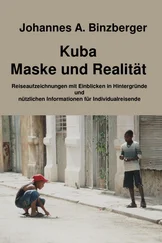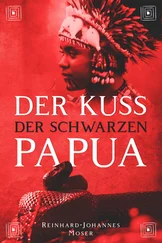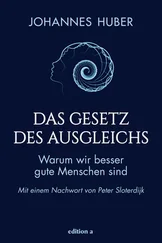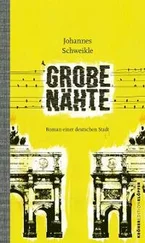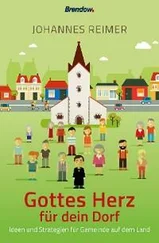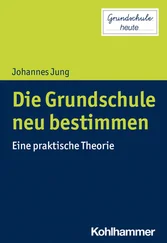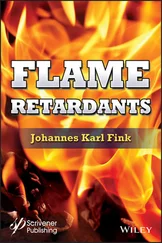aa) Methoden der normsatzkonkretisierenden Auslegung
36
Die gerichtliche Rechtsanwendung hat auf das übliche Instrumentarium der normsatzkonkretisierenden Auslegungzurückzugreifen. Die Bedeutung des Gesetzes ist mit den üblichen Auslegungsmethoden [65] zu ermitteln und beinhaltet die Auslegung nach dem Wortlautdes Gesetzes (grammatische Auslegung, s. auch Rn. 40),[66] nach der Systematikdes Gesetzes (systematische Auslegung),[67] nach der Entstehungsgeschichtedes Gesetzes (historische Auslegung)[68] und nach Sinn und Zweckdes Gesetzes (teleologische Auslegung).[69]
37
Die einzelnen Methoden der Auslegung ergänzen einander, ohne dass sich eine verbindliche Rangfolge ergibt. Eine herausgehobene Bedeutung dürfte allerdings regelmäßig der Wortlaut-Auslegung zukommen (s. sogleich Rn. 40). Äußerste Grenze richterlicher Auslegung ist der mögliche Wortsinn (Details s. Rn. 43).
38
Höherrangiges Rechtist im Rahmen der Auslegung zu berücksichtigen. Anwendungsvorrangiges Recht kann sich vor allem aus dem Verfassungsrecht[70] ergeben. Das Gebot zur verfassungskonformen Auslegunggilt jedoch nur innerhalb des möglichen Wortsinns; ist diese Grenze erreicht, muss das Strafgericht das Verfahren aussetzen und die Entscheidung des BVerfG einholen (Art. 100 Abs. 1 GG).[71]
39
Anwendungsvorrangiges Recht kann sich auch aus dem europäischen Unionsrechtergeben.[72] Auch die unionsrechtskonforme Auslegungist nur innerhalb des möglichen Wortsinnszulässig, und etwaige Unsicherheiten ggf. in Wege eines Vorabentscheidungsverfahren zum EuGH zu ermitteln (Art. 267 AEUV).[73]
bb) Die herausgehobene Bedeutung der Auslegung des Wortlauts
40
Eine herausgehobene Bedeutung wird man der Auslegung des gesetzlichen Wortlautszusprechen müssen, da regelmäßig nur der Wortlaut regelmäßig das rechtsstaatliche Gebot der Vorhersehbarkeit für die Normadressatengewährleisten kann.[74] Die Normadressaten müssen nämlich nach der Rspr. in der Lage sein, „anhand der gesetzlichen Regelung vorauszusehen, ob ein Verhalten strafbar ist“ oder – „in Grenzfällen“ – „wenigstens das Risiko einer Bestrafung“ erkennen können.[75] Argumentationspraktische Einlösung dieser herausgehobenen Bedeutung des Wortlauts dürfte es jedenfalls sein, von wortlautfernen Argumentationen einen erhöhten Begründungsaufwandzu verlangen.[76] Zum möglichen Wortsinn als Grenze der Auslegung s. Rn. 43 f.
cc) Die gerichtliche Mitverantwortung für die Präzisierung des Tatbestands
41
Besondere Verantwortung tragen (Steuer-)Strafgerichte bei der „Handhabung weit gefasster Tatbestände und Tatbestandselemente“. Hier ist nach der Ansicht des BVerfG die Rspr. „gehalten, verbleibende Unklarheiten über den Anwendungsbereich einer Norm durch Präzisierung und Konkretisierung im Wege der Auslegung nach Möglichkeit auszuräumen (Präzisierungsgebot)“.[77]
42
Bei der verfassungsrechtlichen Überprüfung der Einhaltung des Präzisierungsgebotssieht sich das BVerfG nicht auf eine „Vertretbarkeitskontrolle“ beschränkt.[78] Das „Bestehen“ eines durch die Auslegungsarbeit der Rspr. „gefestigte(n) Normverständnis(ses)“ ist „in vollem Umfang“ verfassungsgerichtlich überprüfbar.[79] Was die inhaltlichen Anforderungen anbelangt, gesteht das BVerfG den Fachgerichten einen größeren Spielraum zu, insofern es ausreichen soll, dass das gefestigte Normverständnis „nicht evident ungeeignet zur Konturierung der Norm“ist.[80]
b) Grenzen der Rechtsanwendung im Steuerstrafrecht
aa) Der mögliche Wortsinn als äußerste Grenze richterlicher Auslegung
43
Äußerste Grenze zulässiger richterlicher Auslegung ist der mögliche Wortsinn des Gesetzes.[81] Dies bedeutet zum einen, dass die Strafgerichte gehalten sind „den Gesetzgeber beim Wort zu nehmen“; es ihnen also untersagt ist, den Gesetzgeber in irgend einer Weise zu korrigieren.[82] Zum anderen bedeutet das, dass die Strafgerichte in den Fällen, „die vom Wortlaut einer Strafnorm nicht mehr gedeckt sind“, zu einem Freispruch kommen müssen.[83]
44
Die Bestimmung des möglichen Wortsinns des Gesetzes ist nach der Rspr. des BVerfG „aus der Sicht des Normadressaten– also grundsätzlich nach dem allgemeinen Sprachverständnis der Gegenwart– zu bestimmen“.[84]
bb) Das Verbot der Verschleifung von Merkmalen des gesetzlichen Tatbestands
45
Nach der neueren Rspr. des BVerfG können sich auch Grenzen der Auslegung innerhalb des möglichen Wortsinnsergeben. So dürfen etwa einzelne Tatbestandsmerkmale nicht „vollständig in anderen Tatbestandsmerkmalen aufgehen“ (Verschleifungsverbot).[85]
cc) Das Verbot analoger Strafbegründung oder -verschärfung
(1) Rechtsanwendung und Analogieverbot
46
Absolute Grenzen der Rechtsanwendung im Steuerstrafrecht ergeben sich hinsichtlich des Verbots analoger Strafbegründung oder Strafschärfung(Art. 103 Abs. 2 GG, § 369 Abs. 2i.V.m. § 1 StGB).[86] Nach der Rspr. ist dabei Analogie nicht nur „im engeren technischen Sinn zu verstehen“; vielmehr ist jede tatbestandsausweitende Rechtsanwendungausgeschlossen, die „über den Inhalt einer gesetzlichen Sanktionsnorm hinausgeht“ (erweitertes Analogieverbot).[87] Dies gilt auch dann, wenn dem Gericht die nicht erfassten Verhaltensweisen „ähnlich strafwürdig erscheinen mögen wie das pönalisierte Verhalten“. Die Entscheidung über die Schließung oder Beibehaltung derartiger „Strafbarkeitslücken“liegt in der alleinigen Entscheidungsverantwortung der Gesetzgebung.[88]
47
Ein problematischer Fall ergab sich in der Entscheidung des BGH von 2001 zum Zigarettenschmuggel aus den Niederlanden.[89] Hier hatte der BGH die Anwendung der Steuerhinterziehung auf reine Auslandstaten nach § 370 Abs. 7auch auf die Hinterziehung von Eingangsabgaben nach § 370 Abs. 6bejaht und das Fehlen – nicht ganz unproblematisch – eines entsprechenden Verweises als „offenkundiges redaktionelles Versehen des Gesetzgebers“ bezeichnet.[90] Die Verweiskette ist mittlerweile durch den Gesetzgeber geschlossen worden ( § 370 Abs. 7, s. auch § 369 Rn. 37, 115; § 370 Rn. 12, 257).
48
Keinen Verstoß gegen das Analogieverbot des Art. 103 Abs. 2 GG sah der BGH jüngst bei der Einordnung von Treibhausgas-Emissionszertifikaten als „ähnliche Rechte“ i. S. v. § 3a Abs. 4 Nr. 1 UStG.[91] Da es sich um eine steuerrechtliche Vorschrift handele, sei der Begriff der „Ähnlichkeit“ nicht „aus dem Blickwinkel des Rechts des geistigen Eigentums“ zu bestimmen, sondern „aus der ‚Außensicht‚ des Steuerrechts“, der eine „wirtschaftliche Betrachtungsweise immanent“ sei.[92]
49
Nicht grundsätzlich ausgeschlossenist hingegen die täterbegünstigende Analogie, soweit die allgemeinen Analogievoraussetzungen – planwidrige Regelungslücke, vergleichbare Interessenlage[93] – erfüllt sind.
(2) Die teleologische Einschränkung begünstigender Normen
50
Das erweiterte Analogieverbot erfasst nach der Rspr. auch das Verbot teleologischer Einschränkung täterbegünstigender Normen.[94] Als unzulässige Analogie gilt daher auch die nicht vom möglichen Wortsinn getragene Einschränkung von gesetzlichen Rechtfertigungs-, Entschuldigungs-, Strafmilderungs- oder Strafaufhebungsgründen.[95]
Читать дальше