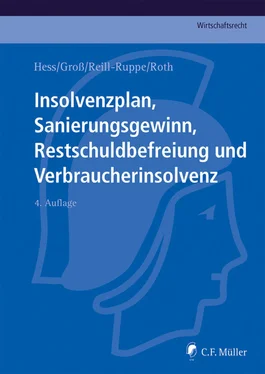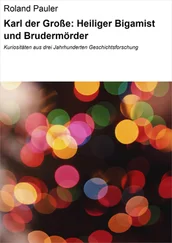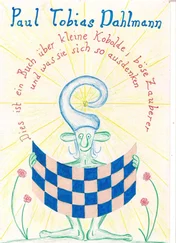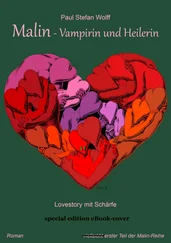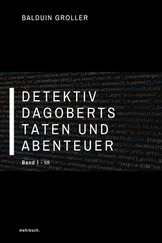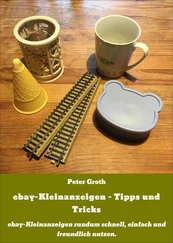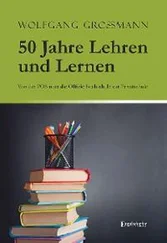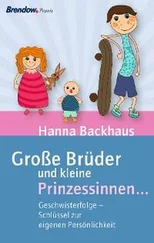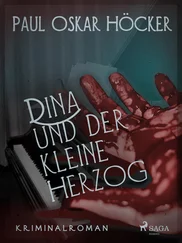13
Ungleicher Zugang der Beteiligten zur Information über den Zustand des Schuldners und über die Verwertungschancen und -risiken behindert wirtschaftlich sinnvolle Ergebnisse ebenfalls. Die Offenlegung solcher Information und die Transparenz eines gerichtlichen Verfahrens schaffen hier Abhilfe.
14
Unkoordinierte Verhandlungen der Beteiligten sind mühsam und regelmäßig sehr zeitaufwendig. Ein geordnetes Verfahren, die Bündelung gleichgerichteter Interessen in Verhandlungs- und Abstimmungsgruppen sowie die Mitwirkung von Gericht und Verwalter beschleunigen die Selbstkoordinierung der Beteiligten und sparen Zeit und Kosten.
15
In freien Verhandlungen kann jeder einzelne Beteiligte eine von anderen gewünschte Verwertungsalternativen blockieren oder aber sich Sondervorteile verschaffen, die wirtschaftlich nicht gerechtfertigt sind. Mehrheitsentscheidungen über einen Planvorschlag bei vollwertigem Minderheitenschutz und ein Schikaneverbot für Gruppen schalten solche Obstruktionen aus.
1› A› II. Marktkonformität der Insolvenzabwicklung
II. Marktkonformität der Insolvenzabwicklung
16
Das Insolvenzrecht ist angelegt, dass die Gesetzmäßigkeiten des Marktes auch die gerichtliche Insolvenzabwicklung steuern. Das Verfahren soll eine marktkonforme Insolvenzbewältigung ermöglichen. Die Herstellung marktkonformer Rahmenbedingungen für die Entscheidung über Liquidation oder Sanierung eines Unternehmens beseitigt die Tendenz zur Zerschlagung. Die Herbeiführung von Sanierungen ist jedoch kein eigenständiges Insolvenzrecht. Es ist nicht die Aufgabe des Rechts, notleidende Unternehmen durch Eingriffe in die Rechte der Beteiligten vor der Zerschlagung zu retten. Der Erfolg des Insolvenzrechts wird nicht daran zu messen sein, ob mehr Sanierungen zustande kommen, sondern daran, ob marktwirtschaftlich sinnvolle Sanierungen ermöglicht und sinnwidrige Sanierungen verhindert werden.
17
Das Insolvenzverfahren soll auch in solchen Fällen eine Verhandlungslösung fördern, in denen diese ohne ein gerichtliches Verfahren nicht zustande kommt. Kein Gesetzesziel ist es hingegen, den Spielraum für die außergerichtliche Insolvenzabwicklung einzuengen und etwa die freie Sanierung von Unternehmen zurückzudrängen. Aus dem Postulat der Marktkonformität ergibt sich eine Reihe von Anforderungen an die Ausgestaltung des Verfahrens:
1. Vermögensorientierung des Verfahrens
18
Ziel des Verfahrens muss die bestmögliche Verwertung des Schuldnervermögens und die optimale Abwicklung oder Umgestaltung der Finanzstruktur des Schuldners im Interesse seiner Geldgeber sein. Die einzelwirtschaftliche Rentabilitätsrechnung der Beteiligten folgt im gerichtlichen Verfahren denselben Rationalitätsgesichtspunkten wie bei einer außergerichtlichen Investitions- oder Desinvestitionsentscheidung. Ein marktkonformes Verfahren ist deshalb an den Vermögensinteressen der Geldgeber des Schuldners auszurichten; es ist vermögens-, nicht organisationsorientiert. Ebenso wenig wie die Gläubiger ein Recht auf den Fortbestand der Unternehmensorganisation des Schuldners haben, hat ein insolventer Schuldner ein schutzwürdiges Interesse am Fortbestand seiner Unternehmerrolle, das gegen die Gläubigerinteressen durchzusetzen wäre. Es ist daher kein Gesetzesziel, gegen die Kräfte des Marktes zu einer Perpetuierung von Unternehmensträgern beizutragen. Die aus dem Gesichtspunkt eines Unternehmensrechts hergeleiteten rechtspolitischen Forderungen, wonach der Organisation des Schuldnerunternehmens in der Insolvenz besonderer Schutz zu gewähren sei, sind also nicht aufzugreifen.
2. Gleichrang von Liquidation, übertragender Sanierung und Sanierung des Schuldners
19
Die marktwirtschaftliche Aufgabe der gerichtlichen wie der außergerichtlichen Insolvenzabwicklung ist es, die in dem insolventen Unternehmen gebundenen Ressourcen der wirtschaftlich produktivsten Verwendung zuzuführen. Welche Verwertung des Schuldnervermögens am sinnvollsten ist, lässt sich nur im Einzelfall entscheiden. Es gibt wirtschaftspolitisch keine Gründe, die Sanierung des Schuldners generell vor der übertragenden Sanierung des Unternehmens zu bevorzugen oder auch nur irgendeine Art der Sanierung stets und überall der Zerschlagungsliquidation vorzuziehen. Die Struktur des Verfahrens muss demnach so angelegt sein, dass keines der möglichen Verfahrensziele vor dem anderen bevorzugt wird. Sämtliche Verwertungsarten sind den Beteiligten gleichrangig anzubieten. Das Verfahren ist ein neutraler Rechtsrahmen, in dem die Beteiligten die für sie vorteilhafteste Lösung entdecken und durchsetzen können.
20
Auf einen gesetzlichen Typenzwang der Verwertungsarten, insbesondere auf ein normatives Sanierungsleitbild, wird verzichtet, damit der Spielraum für privatautonom ausgehandelte Lösungen nicht ohne Not eingeengt wird. Jede von den Beteiligten angestrebte und legitimierte Art der Masseverwertung ist zuzulassen: Es braucht nicht hoheitlich beurteilt zu werden, ob eine angestrebte Sanierung etwa von Dauer sein oder ein bestimmtes wirtschaftliches Ergebnis erzielen werde. Es besteht auch kein Bedürfnis, die Zulässigkeit einer Sanierung von der subjektiven Würdigkeit des Schuldners oder von einer bestimmten Vermögenslage abhängig zu machen. Sogar im Falle der Masseunzulänglichkeit kann die Sanierung wirtschaftlicher sein als eine Liquidation.
3. Flexible Insolvenzabwicklung durch Deregulierung
21
Die marktwirtschaftliche Ordnung beruht auf der aus Erfahrung gewonnenen Einsicht, dass privatautonome Entscheidungen ein höheres Maß an wirtschaftlicher Effizienz verbürgen als die hoheitliche Regulierung wirtschaftlicher Abläufe. Dies gilt auch innerhalb eines staatlichen Insolvenzverfahrens. Im Sinne einer Deregulierung der Insolvenzabwicklung ist deshalb den Beteiligten ein Höchstmaß an Flexibilität für die einvernehmliche Bewältigung der Insolvenz zu gewähren. Die Beteiligten müssen in einem Insolvenzplan in jeder Hinsicht von der gesetzlichen Zwangsverwertung der Insolvenzmasse abweichen können.
22
In privatautonomen Verhandlungen und Austauschvorgängen, die einen solchen Plan legitimieren, wird das wirtschaftliche Optimum durch diejenige Lösung verwirklicht, die mindestens einen Beteiligten besser und alle anderen Beteiligten nicht schlechterstellt als jede andere Lösung. Der wirtschaftliche Vorzug eines Plans gegenüber der Zwangsverwertung liegt darin, dass er es ermöglicht, die Verwertungsentscheidung diesem Optimum anzunähern. Unter der Voraussetzung, dass der Schutz der Vermögensrechte der einzelnen Beteiligten gewährleistet ist, ist deshalb ein Höchstmaß an Differenzierung und Individualisierung des Planinhalts zuzulassen. Dies macht es erforderlich, das bei der Zwangsverwertung unabdingbare Gebot formaler Gleichbehandlung von Beteiligten einer Rangklasse bei der planmäßigen Masseverwertung aufzulockern.
4. Wettbewerb um die beste Verwertungsart
23
Die marktwirtschaftliche Ordnung beweist im wirtschaftlichen Alltag, dass Wettbewerb und freie Verhandlungen zur Auffindung und Durchsetzung der besten Lösung führen. Durch ein breitgefächertes Planinitiativrecht ist den Beteiligten zu ermöglichen, eigene Verwertungs- oder Sanierungskonzepte zu entwickeln und in Form eines Planes zur Abstimmung zu stellen. Auch wenn ein Plan vorbereitet oder vorgelegt wird, können die Beteiligten jederzeit ein Gebot für das Schuldnerunternehmen einholen oder selber abgeben und so eine übertragende Sanierung vorbereiten. Diese Initiativrechte vermögen auch den Verfahrensablauf zu beschleunigen.
5. Verzicht auf Zwangseingriffe in Vermögensrechte
24
Ein marktkonformes Verfahren muss darauf verzichten, den Beteiligten Vermögensopfer abzunötigen. Zwangseingriffe in die private Güterordnung mit der Folge von Vermögensverlagerungen sind ebenso als Mittel zur Eröffnung von Insolvenzverfahren wie als Hilfen zur Durchführung von Sanierungen zurückzuweisen. Dies gilt nicht nur im Verhältnis der Gläubigergruppen – der gesicherten, ungesicherten und nachrangigen Gläubiger – zueinander, sondern auch im Verhältnis der Gläubiger zum Schuldner und zu den am Schuldner beteiligten Personen (Eigentümern), aber auch im Verhältnis der Eigentümer zueinander. Auch das Verhältnis der Mehrheit zu der jeweiligen Minderheit ist verteilungsneutral zu ordnen. Ungleiche wirtschaftliche und rechtliche Interessen der privaten Beteiligten dürfen nicht durch hoheitliche Regulierung künstlich gleichgeschaltet (homogenisiert) werden.
Читать дальше