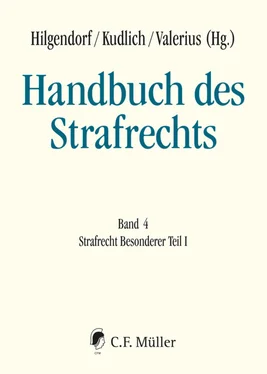122
Ein recht verbreitetes Problem ist das der häuslichen Gewalt, die in der jüngeren Vergangenheit auch in der Praxis von Polizei und Strafverfolgung eine erhebliche Bedeutung erlangt hat. Ähnlich wie beim Gewaltbegriff (siehe Rn. 10 ff.) fehlt es bei der häuslichen Gewalt an einer einheitlichen Begriffsdefinition. Schwander geht dann von häuslicher Gewalt aus, „wenn Personen innerhalb einer bestehenden oder aufgelösten familiären, ehelichen oder eheähnlichen Beziehung physische, psychische oder sexuelle Gewalt ausüben oder androhen“.[459] Das am 1. Februar 2018 in Kraft getretene Gesetz zu dem Übereinkommen des Europarats vom 11. Mai 2011 zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (bekannt als Istanbul-Konvention) umfasst als häusliche Gewalt „alle Handlungen körperlicher, sexueller, psychischer oder wirtschaftlicher Gewalt, die innerhalb der Familie oder des Haushalts oder zwischen früheren oder derzeitigen Eheleuten oder Partnerinnen beziehungsweise Partnern vorkommen, unabhängig davon, ob der Täter beziehungsweise die Täterin denselben Wohnsitz wie das Opfer hat oder hatte“ (vgl. Art. 3 b).
123
Sozialwissenschaftlich fundierte Aussagen über die Verbreitung von häuslicher Gewalt zu treffen ist schwierig, da Erhebungen bei Delikten im sozialen Nahbereich sehr anspruchsvoll sind. Insbesondere bei stark tabuisierten Formen der Gewalt und im Bereich sehr enger Beziehungen[460] ist die Auskunftsbereitschaft der Befragten begrenzt und stark von der Befragungssituation abhängig.[461] Die vorliegenden Zahlen sind daher eher als Mindestwerte einzuordnen. Eine repräsentative Studie im Auftrag der Bundesregierung zum Thema Gewalt gegen Frauen in Deutschland kam 2003 zu dem Ergebnis, dass rund 25 % der in Deutschland lebenden Frauen Formen körperlicher (23 %) und/oder sexueller Gewalt (7 %) durch aktuelle oder frühere Beziehungspartner*innen erlebt haben.[462] Dabei handelte es sich um ein breites Spektrum unterschiedlich schwerwiegender Gewalthandlungen, deren Ausprägung und Kontext sich in den jeweiligen Paarbeziehungen ganz verschieden darstellen. Knapp ein Drittel (31 %) der Opfer gab an, in ihrem Leben lediglich eine Gewaltsituation erlebt zu haben; 33 % gaben an, mehr als zehn bis hin zu 40 solcher Situationen erlebt zu haben.[463] Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die 2013 durchgeführte EU-Untersuchung „Gewalt gegen Frauen“, als bisher umfangreichste Erhebung auf EU-Ebene. Danach haben 22 % der Frauen körperliche und/oder sexuelle Gewalt in einer Partnerschaft erfahren.[464] 34 % der Opfer gaben an, dass durch den*die Täter*in mindestens vier verschiedene Formen körperlicher Gewalt (Stoßen, mit der flachen Hand/Faust geschlagen, Verbrennungen etc.) verwirklicht wurden.[465] Weiter ergab die Untersuchung, dass gerade Gewalt in der Partnerschaft zu verschiedenen Formen von psychischen Langzeitfolgen führt.[466] Es gibt zudem Erkenntnisse zur Gewaltausübung von Frauen an mit ihnen zusammenlebenden Männern, die relativ häufig sei, aber verhältnismäßig selten Verletzungen und Angst auslöse.[467]
124
In den Fokus des Gesetzgebers ist das gesellschaftliche Problem der häuslichen Gewalt seit Ende der 1990er Jahre gerückt. Infolgedessen trat 2001 das Gewaltschutzgesetz in Kraft, wobei der Gesetzgeber häusliche Gewalt als die „am häufigsten auftretende Form der Gewalt“[468] einstufte. Das GewSchG setzte wegen der besonderen Schwierigkeiten im Bereich der häuslichen Gewalt nicht beim Strafrecht an, sondern entwickelte flexiblere Reaktionsformen. Konkret regelt das Gesetz gerichtliche Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt und Nachstellungen; es bezweckt somit primär den Schutz vor Gewalttaten, insbesondere häuslicher Gewalt, aber auch die Sicherstellung des zivilrechtlichen Schutzes gegen unzumutbare Belästigungen und andere Eingriffe in die Privatsphäre.[469] Es soll den Betroffenen zügig und einfach zu ihren Rechten verhelfen und ist lex specialis gegenüber der bisherigen analogen Anwendung von §§ 823, 1004 BGB.[470] Zu diesen Zwecken enthält das GewSchG Ermächtigungsgrundlagen für eine einstweilige Zuweisung der gemeinsamen Wohnung sowie weitere Schutzanordnungen, z.B. Kontakt- und Näherungsverbote.[471] Damit hat der Gesetzgeber auch dem Umstand Rechnung getragen, dass es Betroffenen weniger um eine Bestrafung des*der Täters*Täterin, sondern vor allem um Schutz vor weiteren Übergriffen geht.[472]
3. Besonderer Schutz bestimmter Berufsgruppen
125
Für rechtspolitische Debatten hat in der jüngeren Vergangenheit die Frage gesorgt, ob bestimmte Berufsgruppenim Hinblick auf ihre körperliche Unversehrtheit eines besonderen strafrechtlichen Schutzes bedürfen. Nachdem verschiedene Polizeigewerkschaften diese Forderung für Polizeikräfteüber Jahre hinweg lautstark erhoben hatten, ist der Gesetzgeber dem im Jahre 2017 nachgekommen und hat in Form des § 114 StGB (vgl. dazu → BT Bd. 4: Barton , § 20 Rn. 24 ff.) einen besonderen strafrechtlichen Schutz des individuellen Rechtsguts der körperlichen Unversehrtheit von Polizeikräften geschaffen.[473] Der Gesetzgeber hat diesen vor allem symbolischen Schritt mit der besonderen Schutzwürdigkeit bei der Dienstausübung begründet.[474] Der tätliche Angriff i.S.v. § 114 Abs. 1 StGB setzt keinen (Verletzungs-)Erfolg voraus; der Tatbestand ist – wie schon in § 113 StGB a.F.[475] – als unechtes Unternehmensdelikt ausgestaltet. Er ist bereits vollständig erfüllt, sobald durch das Unternehmen des tätlichen Angriffs eine konkrete Gefährdung des Rechtsgutes eingetreten ist.
126
Im Anschluss an die Einführung dieses besonderen Schutzes von Polizeibeamten*Polizeibeamtinnen ist von Vertretern*Vertreterinnen anderer Berufsständedie Forderung erhoben worden, auch ihre jeweilige Berufsgruppe besonders zu schützen. Hierzu zählen etwa Lehrkräfte, ärztliches Personal und Mitarbeiter*innen in Ämtern. Nicht anders als bei der Polizei sind diese Ansinnen aus strafrechtlicher Sicht zweifelhaft und vor allem symbolischer Natur. Die körperliche Unversehrtheit der genannten Berufsgruppen ist bereits jetzt umfassend und mit massiven Strafdrohungen durch das Strafrecht geschützt. Die Einführung weiterer Sondertatbestände würde daher vor allem dem Ziel dienen, besondere Problemstellungen der einzelnen Berufe in Gesetzesform hervorzuheben.
4. Reformbestrebungen des Gesetzgebers
127
Die Reformtätigkeit des Gesetzgebers weist im Bereich des Schutzes der körperlichen Unversehrtheit eine gewisse Ambivalenz auf. Zum einen ist für den 17. Abschnitt seit dem 6. StrRG wenig Bewegung zu konstatieren.[476] Dies lässt sich u.a. auf das restriktive Rechtsgutverständnis zurückführen, welches psychische Gewalt weitgehend ausschließt. Zum anderen und damit in Verbindung stehend wird ein gleichwohl bejahter Regelungsbedarf in anderen Abschnitten des StGB wie auch in anderen Rechtsgebieten umgesetzt. So wurde beispielsweise das Stalking als Nachstellung in § 238 StGB geregelt, der seit seiner Einführung bereits mehrfach ausgeweitet wurde.[477] Die Neufassung der §§ 113, 114 StGB[478] hat dazu geführt, dass der „tätliche Angriff“ auf Amtsträger*innen heute faktisch zum Schutz der körperlichen Unversehrtheit im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung pönalisiert ist.[479]
128
Betrachtet man die Reformtätigkeit des Gesetzgebers der letzten Jahrzehnte, so ist der Bereich der Körperverletzungstatbestände – nicht anders als das sonstige Strafrecht[480] – von einer Tendenz der Ausweitung und Vorverlagerung von Strafbarkeit geprägt, auch wenn diese Entwicklung im Bereich der §§ 223 ff. StGB weniger stark ausgeprägt ist. Zwar wurden im Laufe der Zeit einzelne Delikte modifiziert oder gestrichen – z.B. der Vergiftungstatbestand, § 229 StGB a.F., welcher jedoch in den heutigen § 224 StGB überführt wurde.[481] Insbesondere die Einführung der Versuchsstrafbarkeit in § 223 Abs. 2 StGB und die Novellierung des § 224 StGB mit einer erheblichen Erhöhung des Strafrahmens durch das 6. StrRG stehen jedoch für eine Entwicklung der Verschärfung, ebenso wie die Einführung des § 226a StGB. Ein Vorstoß im Bundesrat zur Neuschaffung eines § 224a StGB, welcher die Körperverletzung aus niedrigen Beweggründen erfassen und extremistische Gewalttaten besonders bestrafen sollte, wurde indes überwiegend kritisiert und verlief schließlich im Sande.[482] Weitere Änderungen werden durch das europäische und internationale Recht angestoßen.[483]
Читать дальше