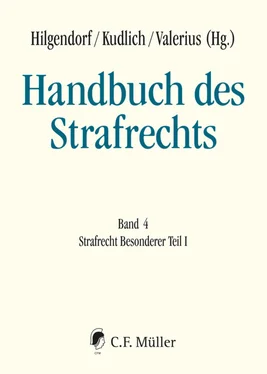II. Begriff, gesellschaftliche Bewertung und Formen der Gewalt
9
Wie in der Einführung dargestellt, überschneiden sich der Anwendungsbereich der §§ 223 ff. StGB und das gesellschaftliche Phänomen der Gewalt großflächig. Dementsprechend kommt für die Relevanz, das Verständnis und die Entwicklung dieses Deliktsbereiches der Frage erhebliche Bedeutung zu, was gesellschaftlich unter Gewalt verstanden und wie Gewalt bewertet wird.
10
Der Begriff „Gewalt“unterliegt hinsichtlich seines Verständnisses einem massiven Wandel im Zeitverlauf und wird in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen unterschiedlich ausgefüllt.[20] So werden in der Soziologie, die zwar grundsätzlich für einen weiten Gewaltbegriff steht, im Detail unterschiedlich weite Gewaltbegriffe vertreten.[21] Danach lassen sich zunächst verschiedene Formen der Gewaltunterscheiden. Eine erste Differenzierung trennt zwischen personaler und struktureller Gewalt. Unter den Begriff der strukturellen Gewalt fallen gesellschaftliche Rahmenbedingungen bzw. Zwangsmerkmale der sozialen Systeme. Dies können beispielsweise bestimmte Pflichten sein, die die Gesellschaft den einzelnen Personen auferlegt, wie Steuerpflichten, die Wehrpflicht oder grundsätzlich der Druck, der über Hierarchien ausgeübt werden kann.[22] Die personale Gewalt lässt sich weiter in die physische und psychische Gewalt ausdifferenzieren. Die physische Gewalt lässt sich ihrerseits unterteilen in Gewalt gegen Personen und Gewalt gegen Sachen (Vandalismus).
11
In der Kriminologie wird regelmäßig auf die verschiedenen Formen der Gewalt nach der benannten soziologischen Kategorisierung verwiesen, es findet sodann eine Konzentration auf personale Gewalt statt, insbesondere auf solche gegenüber anderen Menschen.[23] Der rechtliche Gewaltbegriff ist noch enger. Der Gewaltbegriff des Strafgesetzbuches, welcher insbesondere im Rahmen der Nötigung (§ 240 StGB, vgl. → BT Bd. 4: Brian Valerius , Nötigung, Bedrohung und Zwangsheirat, vgl. § 5 Rn. 30 ff.) sowie der Raubdelikte (§§ 249 ff. StGB) eine Rolle spielt, wird nach überwiegender Auffassung als körperlich wirkender Zwang zur Überwindung eines geleisteten oder erwarteten Widerstands[24] verstanden. Es handelt sich dabei um einen eher engen Gewaltbegriff, der die personale physische Gewalt gegen Personen umfasst.[25] Der statistische Gewaltbegriff des Bundeskriminalamts (BKA) in der PKS wiederum definiert Gewaltkriminalität als Summenschlüssel und fasst darunter ausschließlich physische Gewalt gegen Personen und dabei nur schwere Gewaltdelikte wie Mord, Totschlag, Vergewaltigung und sexuelle Nötigung, Raubdelikte sowie qualifizierte Körperverletzungsdelikte.
12
Das deutsche Strafgesetzbuch schütztpraktisch nur vor personaler Gewalt und hier in erster Linie die körperliche Unversehrtheit, nicht die psychische. Dementsprechend stellen die §§ 223 ff. StGB einen Teil der physischen Gewalt gegen Personen unter Strafe. Gewalt gegen Sachen wird von den Sachbeschädigungsdelikten sowie den Brandstiftungsdelikten abgedeckt. Psychische Gewalt lässt sich schwerer definieren und wird nur ausschnittsweise durch das StGB pönalisiert. So können zwar Drohungen mit Gewalt (Nötigung, Bedrohung, Erpressung) sowie verbale Aggressionen (als Beleidigung i.S.d. §§ 185 ff. StGB) geahndet werden. Andere Formen der psychischen Gewalt hingegen sind nicht oder nur schwer mit dem Strafgesetzbuch verfolgbar (z.B. Mobbing, Diskriminierung, Demütigung). Neuere Entwicklungen zeigen, dass der Gesetzgeber auch psychische Gewalt mehr in den Vordergrund rückt und mit dem Mittel des Strafrechts angehen will. So gibt es seit 2007 den Straftatbestand der Nachstellung (§ 238 StGB, dazu → BT Bd. 4: Jörg Eisele , Freiheitsberaubung und Nachstellung, § 6 Rn. 35 ff.), welcher Stalking unter Strafe stellt. Auch die Neuerungen im Sexualstrafrecht deuten auf eine solche Entwicklung hin.
13
Die gesellschaftliche Wahrnehmung und Bewertung von körperlicher Gewalthaben sich in der jüngeren Vergangenheit in Deutschland stark gewandelt. Insgesamt hat sich in den westlichen Gesellschaften seit den 1970er Jahren der diesbezügliche Diskurs erheblich geändert.[26] Die körperliche Gewalt wird heute deutlich negativer bewertet als früher, dementsprechend stärker geächtet und es besteht eine stärkere Sensibilisierung für einschlägige Geschehensabläufe.[27]
III. Praktische Bedeutung des Bereichs
14
Die praktische Bedeutung der §§ 223 ff. StGB ist erheblich. Jährlich werden in der PKS etwa 550 000[28] Fälle aus diesem Deliktsbereich erfasst. Für eine genauere Bewertung ist zwischen den verschiedenen Deliktsformen in diesem Bereich zu unterscheiden.
15
Die §§ 223 ff. StGB erfassen zunächst einen erheblichen Teil der sog. Gewaltkriminalität. Hierbei handelt es sich um eine statistische Kategorie aus der PKS, die besonders gravierende Gewaltdelikte gegen Personen umfasst (Mord, Totschlag, Vergewaltigung und sexuelle Nötigung, Raub, räuberische Erpressung, Körperverletzung mit Todesfolge, gefährliche und schwere Körperverletzung, erpresserischer Menschenraub u.a.).[29] Nicht berücksichtigt werden u.a. die einfache und die fahrlässige Körperverletzung. Die in dieser Form zusammengefasste Gewaltkriminalität stellt nur einen geringen Anteil von 3 % an der Gesamtkriminalität dar. Wesentlich bedeutsamer ist demgegenüber die vorsätzliche einfache Körperverletzung, die einen Anteil von ca. 6,4 % der Gesamtkriminalität ausmacht.[30] Bis 2007 war im Hellfeld ein kontinuierlicher Anstieg der Gewaltdelikte zu verzeichnen. Seit 2008 folgte ein leichter Rückgang der registrierten Fälle. Ab 2015 steigt die Zahl jedoch wieder geringfügig an und es gibt eine Zunahme insbesondere im Bereich der „gefährlichen und schweren Körperverletzung“ sowie bei der „einfachen vorsätzlichen Körperverletzung“. Dagegen hat die Anzahl der Fälle der „Raubdelikte insgesamt“ abgenommen.[31]
16
Diese Hellfeldzahlenlassen alleine keine Schlüsse bezüglich der tatsächlichen Entwicklung dieses Deliktsbereichs zu, da sie das Dunkelfeld nicht bekanntgewordener Taten nicht berücksichtigen. Welche und wie viele Fälle in das Hellfeld gelangen, ist insbesondere abhängig vom Anzeigeverhalten der Bevölkerung, der Intensität polizeilicher Kontrolle und unterliegt zahlreichen Verzerrungsfaktoren.[32] Eine umfassendere Kenntnis über das tatsächliche Kriminalitätsaufkommen kann nur durch eine gemeinsame Analyse von Hell- und Dunkelfeld erlangt werden. Das Dunkelfeldkann durch Dunkelfeldstudien (Täter*innen- wie Opferbefragung) teilweise aufgehellt werden. Bei der Erhebung von Delikten im sozialen Nahbereich ist dies sehr anspruchsvoll, da in eine Tabuzone vorgedrungen wird.[33] Im deutschen Viktimisierungssurvey aus dem Jahr 2012 gaben 2,8 % der Befragten an, in den vorangegangenen zwölf Monaten mindestens einmal Opfer eines Körperverletzungsdelikts geworden zu sein.[34] Bezogen auf die berichteten Fälle von Körperverletzungen (hier sind auch mehrere Fälle pro Person erfasst) ergab sich für den gleichen Zeitraum eine Belastung von 50 Vorfällen pro 100 000 Einwohner*innen.[35] Zu ähnlichen Ergebnissen gelangten in Niedersachsen und Schleswig-Holstein durchgeführte repräsentative Dunkelfeldstudien, bei denen zwischen 1,9 und 2,3 % der Bevölkerung angaben, im Vorjahr Opfer einer Körperverletzung geworden zu sein (Niedersachsen: 2012 2,3; 2014 1,9; 2016 2,3; Schleswig-Holstein: 2014 2,0; 2016 2,3).[36]
17
Im Rahmen einer repräsentativen Bochumer Studie wurden zu vier verschiedenen Messzeitpunkten (1975, 1986, 1998, 2016) Daten bezüglich der Dunkelfeldkriminalität erhoben.[37] Dabei konnte festgestellt werden, dass bei den Körperverletzungen[38] die Anzahl der angezeigten und nicht angezeigten Körperverletzungen zwischen 1975 und 1986 weitgehend konstant blieb, zwischen 1986 und 1998 wurde indes ein deutlicher Anstieg verzeichnet. Dabei nahmen allerdings vor allem die Hellfelddaten zu und zwar um über 100 %, während die Hell- und Dunkelfelddaten insgesamt nur um 20 % stiegen. Der starke Anstieg im Hellfeld beruhte größtenteils auf einer erhöhten Anzeigebereitschaft in der Bevölkerung.[39] Danach haben Anti-Gewalt-Aufrufe, Anzeigeverpflichtungen der Schulen sowie das Gewaltschutzgesetz u.Ä. zu einer zunehmenden Sensibilisierung der Bevölkerung geführt und sich so auf das Anzeigeverhalten ausgewirkt.[40]
Читать дальше