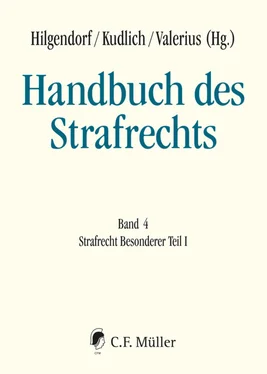49
Auch die Garantie der Menschenwürde nach Art. 7 BV spielt im Zusammenhang mit der Thematik der Sterbehilfe eine wichtige Rolle, da gerade durch die Respektierung des Sterbewunsches und damit der Selbstbestimmung das Individuum nicht als beliebiges Objekt behandelt wird.[323] Erfolgt trotz dem eindringlichen und verständlichen Wunsch eines schwer leidenden Patienten nach direkter aktiver Sterbehilfe keine Rechtfertigung derjenigen Person, welche diese ausführt, obwohl damit nur der Leidensprozess verlängert wird, kann darin eine indirekte Verletzung der Menschenwürde gesehen werden, indem der Kranke zu gesellschaftlichen Normbekräftigungszwecken instrumentalisiert wird.[324]
50
Festzuhalten ist, dass weder die schweizerische Grundrechtsordnung noch die internationalrechtlichen Prämissen dem Staat eine übergeordnete Pflicht auferlegen, die direkte aktive Sterbehilfe generell unter Strafe zu stellen.[325] Dies entspricht der Auffassung in der Lehre zum deutschen Grundgesetz.[326]
II. Sterbehilfe
1. Indirekte aktive Sterbehilfe
51
Die indirekte Sterbehilfe wird in der Schweiz, analog zum Stand in der deutschen Literatur, von der h.M. als zulässig anerkannt, wenn auch die Begründung ebenfalls umstritten bleibt.[327] So wird eine Rechtfertigung etwa einerseits in der Absicht des Arztes gesucht, die einzig auf die Schmerzlinderung ziele und den Tod bloss eventualvorsätzlich in Kauf nehme, andererseits wird sie aus der Berufspflicht des Arztes abgeleitet, weshalb eine gesetzlich erlaubte Handlung nach Art. 14 schwStGB vorliege.[328] Überzeugender erscheint es, die indirekte Sterbehilfe gestützt auf eine verfassungsrechtliche Güterabwägung zu rechtfertigen, indem das Selbstbestimmungsrecht und das Verbot der unmenschlichen Behandlung ausnahmsweise über die Lebenserhaltungspflicht bei terminal Kranken mit Sterbewunsch stellt, falls keine weniger einschneidende Schmerzbekämpfungsmassnahme möglich ist und die Schmerzfreiheit bzw. -reduktion die Lebensverkürzung aufwiegt.[329] Die Ansicht zur deutschen Lehre, welche die Figur des rechtfertigenden Notstandes in Kombination mit der (mutmasslichen) Einwilligung zur Begründung der Straflosigkeit indirekter Sterbehilfe heranzieht,[330] wird in der Schweizer Literatur ebenfalls vertreten: Geth sieht dann die Funktion von Art. 17 schwStGB (rechtfertigender Notstand) darin, die nach Art. 114 schwStGB allein nicht massgebenden „Präferenzen des Betroffenen objektiv zu beglaubigen und damit die […] statuierte Rechtfertigungssperre zu überwinden“.[331] Es kann somit festgehalten werden, dass sowohl in der deutschen als auch in der schweizerischen Strafrechtslehre das Ergebnis, nämlich die Straflosigkeit der indirekten Sterbehilfe, nicht mehr in Frage gestellt wird, die Begründungen jedoch umstritten sind.[332]
2. Direkte aktive Sterbehilfe
52
Anders stellt sich die Situation in Bezug auf die direkte aktive Sterbehilfe dar: Analog der herrschenden Lehrmeinung in Deutschland betrachtet die h.M. in der Schweiz eine aktive Tötung aufgrund der grundrechtlichen Höchstwertigkeit des menschlichen Lebens und der absoluten Einwilligungssperre von Art. 114 schwStGB[333] als einer Rechtfertigung nicht zugänglich.[334] Sie ist somit nach Art. 111 (vorsätzliche Tötung), Art. 113 (Totschlag) oder Art. 114 (Tötung auf Verlangen), seltener wohl nach Art. 112 schwStGB (Mord) strafbar.[335] In Anbetracht dessen, dass direkte aktive Sterbehilfehandlungen unter anderem Titel (Schmerzbekämpfung mit lebensverkürzender Wirkung, aktiven Handlungen beim Behandlungsabbruch), so etwa durch normative Umwertungen und appellatorische Argumente, als gerechtfertigt betrachtet werden und der Übergang zwischen indirekter aktiver und direkter aktiver Sterbehilfe fliessend[336] ist, vertritt ein Teil der Lehre zurecht eine Rechtfertigung der direkten aktiven Sterbehilfe in Extremfällen.[337] In Situationen unheilbarer Krankheiten im terminalen Stadium bei frei geäussertem Wunsch des Patienten nach direkter aktiver Sterbehilfe ist eine Höhergewichtung des individuellen Autonomieanspruchs gegenüber dem Lebensschutz und damit ein (über)gesetzlicher Rechtfertigungsgrund bzw. eine Straflosigkeit der direkten aktiven Sterbehilfe nach Abwägung der konkreten Umstände, bei der alternative Möglichkeiten der Palliativmedizin und -pflege gebührend zu berücksichtigen sind, anzuerkennen.[338] Dies erscheint insbesondere in jenen Fällen vertretbar, welche substanziell einem Suizid gleichkommen, der aber aufgrund des körperlichen Zustands des Sterbenden nicht mehr von ihm selbst ausgeführt werden kann.[339]
53
Bei der passiven Sterbehilfe ist zu differenzieren, ob es sich um eine urteilsfähige oder aber urteils- oder äusserungsunfähige Person handelt. Ist der Betroffene urteilsfähig und somit imstande, sich im Wissen über seinen Zustand sowie die Behandlungsoptionen frei von äusserem Druck oder Zwang gegen eine weitere Behandlung zu entscheiden, haben der Arzt sowie Dritte diesen Entschluss zu respektieren – dies gilt ungeachtet dessen, ob das Stadium der unmittelbaren Todesnähe bereits erreicht ist oder nicht.[340] Dies ergibt sich bereits aus der Strafbarkeit des ärztlichen Heileingriffs[341], aber auch aus der Abwägung des verfassungsrechtlich in Art. 10 Abs. 2 BV verankerten Selbstbestimmungsrechts mit der Schutzpflicht des Lebens.[342] In derartigen Konstellationen tritt das Lebenserhaltungsrecht hinter das Selbstbestimmungsrecht zurück.[343] Bei urteils- oder äusserungsunfähigen Patienten, die im Sterben liegen, ist eine Rechtfertigung nur auf Basis einer schriftlich vorliegenden Patientenverfügung nach den Bestimmungen der Art. 370 ff. ZGB möglich.[344] Gemäss Art. 372 Abs. 2 ZGB hat der behandelnde Arzt der Patientenverfügung grundsätzlich zu entsprechen, ausser wenn diese gegen gesetzliche Vorschriften verstösst oder wenn begründete Zweifel bestehen, dass sie auf freiem Willen beruht oder noch dem mutmasslichen Willen des Patienten entspricht.[345] Zudem müssen die in Art. 371 Abs. 1 ZGB statuierten formellen Anforderungen eingehalten werden.[346] Liegt keine Patientenverfügung vor oder ist diese unklar und sind vertretungsberechtigte Personen vorhanden, entscheiden diese gemäss Art. 378 Abs. 3 ZGB nach dem mutmasslichen Willen und den objektiven Interessen der urteilsunfähigen Person.[347] Widersprechen sich der mutmassliche Wille und die objektiven Interessen, ist ersterem Vorrang zu geben.[348] Zur Feststellung des mutmasslichen Willens müssen insbesondere frühere Äusserungen des Patienten, seine religiösen und sonstigen Wertvorstellungen und Aussagen von nächsten Familienangehörigen oder Bezugspersonen beachtet werden.[349] Ist der mutmassliche Wille nicht feststellbar, muss anhand objektiver Kriterien entschieden werden, ob eine Lebensverlängerung sinnvoll erscheint oder nicht.[350] Umstritten ist, ob gemäss dem Grundsatz „in dubio pro vita“ von einem Abbruch lebenserhaltender Massnahmen eher abzusehen ist oder ob in Extremfällen auch patientenexterne Faktoren (etwa die Sinnlosigkeit der Lebensaufrechterhaltung, die Unzweckmässigkeit medizinischer Massnahmen oder die Unzumutbarkeit der Lebenserhaltung für den Klinikbetrieb) als Rechtfertigung herangezogen werden können.[351] Lassen sich keine Anhaltspunkte für die Feststellung des individuellen mutmasslichen Willens des Patienten finden, kann eine Rechtfertigung nicht mehr auf das grundrechtliche Überwiegen des Selbstbestimmungsrechts gestützt werden.[352] Die Rechtfertigungsgründe der mutmasslichen Einwilligung des Verletzten bzw. der Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 419, 422 OR) oder des rechtfertigenden Notstandes greifen im Sonderfall der Sterbehilfe nicht, weil ihr Grundgedanke auf einen Erfolg oder Vorteil der Behandlung ausgerichtet ist.[353] Vorzuziehen ist deshalb zur Rechtfertigung der passiven Sterbehilfe im engeren Sinne bei Urteilsunfähigen die Einschränkung der ärztlichen Berufspflicht und somit der Garantenstellung, welche in denjenigen Fällen entfällt, in welchen die Pflicht des Arztes zur Leidensverminderung in den Vordergrund rückt, da sich bei hohem Behandlungsaufwand nur geringfügige lebensverlängernde Wirkungen realisieren lassen und das Leiden unter Umständen intensiviert wird.[354] Liegt ein Fall passiver Sterbehilfe im weiteren Sinne bei Urteilsunfähigen vor – dies betrifft vor allem Personen in einem persistent vegetative state – und besteht eine Patientenverfügung oder ein feststellbarer mutmasslicher Wille, ist die Unterlassung der Lebensverlängerung gerechtfertigt, da die Selbstbestimmung in einer grundrechtlichen Abwägung vor die Lebenserhaltungspflicht tritt.[355] Ist auch ein mutmasslicher Wille des Patienten nicht feststellbar, folgt die h.L. den SAMW-Richtlinien, welche einen Verzicht auf lebenserhaltende Massnahmen bei Langzeitkomapatienten als gerechtfertigt ansehen, wenn der irreversible und definitive Verlust seiner kognitiven Fähigkeiten, der Willensäusserung und der Kommunikation nach mehrmonatiger Beobachtungszeit wiederholt bestätigt wird.[356]
Читать дальше