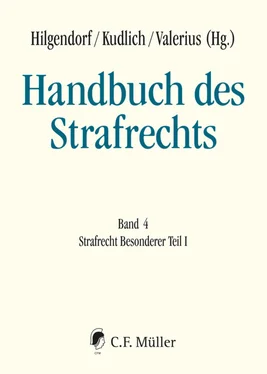34
Ein Gesetzesentwurf, der die Rechtssicherheit für Ärzte und Patienten herstellen und die Selbstbestimmung von unheilbar erkrankten Patienten stärken wollte, wurde vom Bundestag abgelehnt.[217] Dem Entwurf zufolge wäre eine Suizidbeihilfe unter den engen Voraussetzung zulässig gewesen, „dass eine unheilbare, unmittelbar zum Tode führende Erkrankung durch mindestens zwei Ärzte nach dem Vier-Augen-Prinzip festgestellt wurde, eine umfassende ärztliche Beratung über mögliche Behandlungsalternativen stattgefunden hat, der Patient volljährig und einwilligungsfähig ist und sowohl die Beratung des Patienten wie auch die Durchführung der Suizidhilfe ausschliesslich durch einen Arzt und auf freiwilliger Grundlage erfolgt“.[218]
35
Die Straflosigkeit der Teilnahme an einer Selbsttötung besteht nur solange, als sie nicht in eine täterschaftliche Fremdtötung übergeht und die Selbsttötung auf einer freiverantwortlichen Willensentschliessung beruht.[219] Nach h.M. ist die Freiverantwortlichkeit anhand der Voraussetzung der Wirksamkeit der Einwilligung bzw. der Ernstlichkeit des Tötungsverlangens zu bestimmen (sog. Einwilligungsprinzip).[220] Falls die Selbsttötung nicht freiverantwortlich ist, kann ein Tötungsdelikt in mittelbarer Täterschaft vorliegen – denkbar wäre dies etwa im Falle einer schwer dementen Person, welche von ihren Angehörigen einer Sterbehilfeorganisation zugeführt wird.[221] Bei fahrlässiger Verkennung der Unfreiheit des Selbsttötungsentschlusses sowie bei pflichtwidriger Schaffung oder Nichtbeseitigung einer erkennbaren Gefahr eines nicht freiverantwortlichen Suizids kommt § 222 StGB in Betracht.[222] Von der Tötung auf Verlangen ist die Suizidteilnahme nach überwiegender Meinung danach abzugrenzen, ob die Herrschaft über den unmittelbar lebensbeendenden Akt beim Suizidenten oder beim Aussenstehenden liegt – im ersten Fall handelt es sich um straflose Beihilfe zum Suizid, im zweiten jedoch um eine strafbare Tötung auf Verlangen.[223] Relevant ist diese Unterscheidung freilich nur, wenn sich der Tatbeteiligte nicht nur auf Tatanstösse, Ratschläge oder Vorbereitungshilfen beschränkt, sondern sich unmittelbar in das Tötungsgeschehen hineinziehen lässt.[224]
36
Ein Garant, der eine freiverantwortliche Selbsttötung nur geschehen lässt, ist nach h.M. nicht als Unterlassungstäter strafbar, sofern sich nicht nach der Tötungshandlung der Wille des Suizidenten weiterzuleben manifestiert.[225] Dies entspricht im Ergebnis auch der gesetzgeberischen Wertung des § 1901a Abs. 2, Abs. 3 BGB.[226] Im Gegensatz dazu bejahte der Bundesgerichtshof in seiner älteren Rechtsprechung eine Rettungspflicht des Garanten bei jedem Selbsttötungsversuch ab dem Zeitpunkt der Hilfsbedürftigkeit des Suizidenten.[227] Für Nichtgaranten wurde in älteren Entscheidungen ohne weiteres eine Strafbarkeit nach § 323c StGB begründet.[228] In der Entscheidung BGHSt 32, 369, 375 wurde bei freiverantwortlichem Suizid nach eintretender Bewusstlosigkeit ein Tatherrschaftswechsel angenommen, wodurch eine Pflicht des Arztes zum Eingreifen entsteht.[229] Trotzdem könne im Einzelfall eine Strafbarkeit entfallen, weil etwa dem Arzt keine Rechtspflicht auferlegt werden kann, erlöschendes Leben „um jeden Preis“ zu erhalten.[230] Die Zumutbarkeit rettenden Eingreifens ist dann zu verneinen, wenn der Patient nur mit schweren Dauerschäden überleben würde.[231] Kritisiert wurde diese Rechtsprechung dahingehend, dass die Selbstbestimmung sowie die Eigenverantwortlichkeit des Suizidenten nicht hinreichend beachtet worden sei; inwiefern das aus dem Selbstbestimmungsrecht folgende Verbot ärztlicher Eingriffe gegen den Willen des Patienten in Fällen eines freiverantwortlichen Suizidversuchs suspendiert werden kann, bleibt fraglich.[232] Es besteht keine tragfähige Begründung für eine unterschiedliche Bewertung der Entscheidungen eines „Normalpatienten“ einerseits und eines „Suizidpatienten“ im Falle eines freiverantwortlichen Suizidversuchs andererseits.[233] Die neuere Rechtsprechung misst der freiverantwortlichen Selbsttötung deshalb zu Recht eine erheblich grössere Bedeutung zu[234]; dies bestätigt auch der Einstellungsbeschluss der Staatsanwaltschaft München aus dem Jahr 2010, wonach „einem Angehörigen kein strafrechtlicher Vorwurf gemacht werden kann, wenn er den ernsthaften Todeswillen seines Angehörigen respektiert und nicht sofort bei Verlust der Handlungsfähigkeit und des Bewusstseins ärztliche Hilfe ruft oder sonstige Rettungsmassnahmen einleitet“.[235] Dasselbe muss auch für einen Arzt gelten.[236] Diese Lösung erscheint denn auch unter teleologischen Gesichtspunkten überzeugend, zumal das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit, welches die Straffreiheit der Suizidteilnahme trägt, auch eine strafrechtliche Verantwortlichkeit bzgl. der Nichthinderung eines freiverantwortlichen Suizids verhindert.[237] Liegt ein freiverantwortlicher Suizidversuch vor, fehlt es nicht erst an einer Pflicht, sondern bereits an einem Recht des Garanten zum Eingreifen.[238] Die Einschränkung des Selbstbestimmungsrechts bei Suizidpatienten ist mit dem Autonomieprinzip nicht vereinbar; auch hier muss die freiverantwortliche Entscheidung der Patienten zur Verweigerung lebenserhaltender Massnahmen verbindlich sein.[239] Die in der neueren Rechtsprechung des BGH vorgenommene Stärkung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten im Kontext der Sterbehilfe muss auch für die Konstellation eines freiverantwortlichen Suizids gelten.[240] Die Verbindlichkeit dieser freiverantwortlich getroffenen Entscheidung des Suizidenten muss auch nach Eintritt der Bewusstlosigkeit bestehen.[241] Mit Inkrafttreten des neuen § 217 StGB, welcher die geschäftsmässige Förderung der Selbsttötung unter Strafe stellt, besteht neuerdings eine abschliessende Regelung von Suizidteilnahmehandlungen, weshalb die Möglichkeit der Umdeutung der Suizidbeihilfe in eine strafbare Tötung durch Unterlassen oder in eine unterlassene Hilfeleistung schon grundsätzlich versperrt erscheint.[242]
II. Strafbarkeit der geschäftsmässigen Förderung der Selbsttötung (§ 217 StGB)
37
Mit § 217 StGB ist am 10. Dezember 2015 ein neuer Straftatbestand in Kraft getreten,[243] welcher in Absatz 1 die geschäftsmässige Förderung der Selbsttötung unter Strafe stellt und in Absatz 2 Angehörige oder andere dem Suizidwilligen nahestehende Personen, die sich lediglich als nicht geschäftsmässig handelnde Teilnehmer an der Tat beteiligen, von der Strafandrohung ausnimmt.[244] Die davor durch Zeitablauf gescheiterte Initiative für ein Verbot der „gewerbsmässigen Sterbehilfe“[245] wurde als zu eng betrachtet, weshalb die Wendung „geschäftsmässig“ dem Begriff der Gewerbsmässigkeit vorgezogen wurde.[246] Damit soll verhindert werden, dass sich Sterbehilfeorganisationen durch die Schaffung von Vereinsstrukturen und Handeln ohne Gewinnerzielung der Strafbarkeit entziehen können.[247] Im Vordergrund steht dabei die Befürchtung, dass sich durch die Kommerzialisierung der Suizidbeihilfe Menschen zur Selbsttötung verleiten lassen oder bei schwer kranken und alten Menschen ein Erwartungsdruck entstehen könnte, ihren Angehörigen oder der Gemeinschaft nicht zur Last zu fallen.[248] Am Konzept der Straflosigkeit der eigenverantwortlichen Selbsttötung sowie die Teilnahme daran soll zwar weiterhin festgehalten werden, jedoch sei „eine Korrektur aber dort erforderlich, wo geschäftsmässige Angebote die Suizidhilfe als normale Behandlungsoption erscheinen lassen und Menschen dazu verleiten können, sich das Leben zu nehmen“.[249] Strafrechtsdogmatisch handelt es sich bei § 217 StGB um ein abstraktes Gefährdungsdelikt; die Tat ist mit der Förderungshandlung vollendet.[250]
38
Es ist erforderlich, dass sich die Tathandlung auf eine Selbsttötung bezieht; Akte, bei denen die Tötung nur mittelbar eintritt, werden von § 217 StGB nicht erfasst, womit indirekte wie auch Sterbehilfe per se nicht in dessen Anwendungsbereich fallen.[251]
Читать дальше