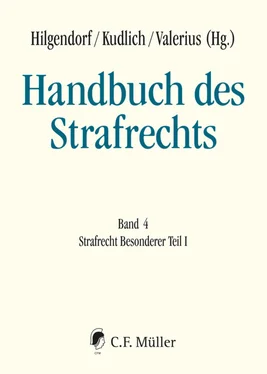23
Zu Recht beurteilen Teile des Schrifttums den technischen Behandlungsabbruch durch Abschalten von Geräten als aktives Tun und das „Unterlassen durch Tun“ als dogmatischen Kunstgriff, um die Straflosigkeit auch aktiven Tötungshandelns zu erreichen.[155] Der dogmatische Kunstgriff wird besonders deutlich, wenn man in die Strafprozessordnung blickt. Bei der Unterscheidung zwischen Tun und Unterlassen geht es um die Einordnung eines sozialen Sachverhalts (beweisbare Tatsache) und nicht um eine normative Reduktion des Tatbestandes. Gemäß § 244 Abs. 2 StPO gilt der Ermittlungsgrundsatz, nach welchem das wirkliche Geschehen, d.h. die materielle Wahrheit, zu erforschen ist. Die Staatsanwaltschaft wird kaum Beweise dafür vorlegen, dass nichts getan wurde. Der BGH stimmt mit seinem Grundsatzurteil vom 25. Juni 2010 – 2 StR 454/09 dieser Sichtweise zu, indem er festhält, dass eine solche normativ wertende Umdeutung aktiven Tuns in ein Unterlassen den auftretenden Problemen nicht gerecht werden könne.[156] Sowohl aktive als auch passive Formen der Beendigung medizinischer Massnahmen fasst er unter dem Begriff des „Behandlungsabbruchs“ zusammen, wobei eine Rechtfertigung durch die Einwilligung des Patienten erfolgt.[157] Diese Lösung ist insofern zutreffend, als die Straflosigkeit des technischen Behandlungsabbruchs auf Erbeten des Kranken nicht von der Einordnung von Zufälligkeiten des Behandlungsablaufs abhängen kann, sondern dass materielle Faktoren wie das Selbstbestimmungsrecht des Patienten dafür massgebend sein müssen.[158]
II. Bildung neuer Kategorien mit dem Grundsatzurteil BGHSt 55, 191
1. Der normativ-wertende Oberbegriff des Behandlungsabbruchs
24
Durch den Grundsatzentscheid des BGH im Jahr 2010 wurde die traditionelle Differenzierung in aktive und passive Sterbehilfe durch den normativ-wertenden Oberbegriff des Behandlungsabbruchs ersetzt, welcher sowohl durch Unterlassen als auch durch aktives Tun vorgenommen werden kann.[159] Der Sachverhalt dieses sog. „Fuldaer Falls“ oder auch „Fall Putz“ lässt sich folgendermassen zusammenfassen[160]: Die nach einer Hirnblutung im Wachkoma liegende Patientin befand sich in einem Pflegeheim und wurde durch eine Sonde künstlich ernährt. Sie war nicht ansprechbar und eine Besserung ihres Gesundheitszustandes nicht zu erwarten. Aufgrund früherer Äusserungen gegenüber ihren Angehörigen bezüglich der Einstellung lebensverlängernder Massnahmen im Falle ihrer Einwilligungsunfähigkeit bemühte sich die als Betreuerin bestellte Tochter um eine Einstellung der künstlichen Ernährung und wurde dabei vom behandelnden Arzt unterstützt. Dieser verneinte eine medizinische Indikation zur Fortsetzung der künstlichen Ernährung. Nachdem die Heimleitung erst ihre Zustimmung erteilte, setzte sie jedoch auf Weisung der Geschäftsleitung die künstliche Ernährung fort und drohte der Tochter mit Hausverbot. Auf Anraten des sie in dieser Sache beratenden Rechtsanwaltes schnitt die Tochter daraufhin die Magensonde durch. Das Heimpersonal bemerkte den Eingriff und veranlasste kurzfristig die Anbringung einer neuen Sonde, worauf die Patientin wenig später aufgrund anderer Ursache verstarb. Die als Betreuerin bestellte Tochter wurde vom Landgericht Fulda vom Vorwurf des Totschlags aufgrund unvermeidbaren Verbotsirrtums basierend auf dem als vertrauenswürdig einzustufenden Ratschlag des Rechtsanwalts freigesprochen.[161] Der vom Landgericht wegen mittäterschaftlich begangenen versuchten Totschlags in einem minder schweren Fall zu einer bedingten Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilte Rechtsanwalt wurde vom BGH freigesprochen.[162]
25
Das Grundsatzurteil bestätigt einerseits, dass es nicht sachgerecht ist, in Fällen des Behandlungsabbruchs an einer „naturalistischen“ Unterscheidung von aktivem Tun und Unterlassen festzuhalten und diese dann normativ umzudeuten, sondern dass für den Abbruch einer medizinischen Massnahme in der Regel eine Vielzahl unterschiedlicher Handlungen erforderlich sind, welche nicht klar den Kategorien des aktiven Tuns oder des Unterlassens zugeordnet werden können.[163] Ein Behandlungsabbruch, definiert als Sterbehilfe durch Unterlassen, Begrenzen oder Beenden einer begonnenen medizinischen Behandlung, ist andererseits nur dann einer Rechtfertigung durch Einwilligung zugänglich, wenn dies dem tatsächlichen oder mutmasslichen Patientenwillen entspricht und dazu dient, einem ohne Behandlung zum Tod führenden Krankheitsprozess seinen Lauf zu lassen.[164] Für die Feststellung des behandlungsbezogenen Patientenwillens gelten beweismässig strenge Massstäbe – dies insbesondere dann, wenn keine schriftliche Patientenverfügung vorliegt.[165] Die Sterbehilfehandlung muss objektiv und subjektiv einen unmittelbaren Bezug zu einer medizinischen Behandlung aufweisen, wobei davon nur das Unterlassen einer lebenserhaltenden Behandlung oder deren Abbruch sowie Handlungen in Form der indirekten Sterbehilfe erfasst sind.[166] Beschränkt wird der zulässige Behandlungsabbruch zudem durch das Erfordernis einer lebensbedrohlichen Erkrankung der betroffenen Person.[167] Explizit erwähnt wird weiter, dass eine Rechtfertigung des Behandlungsabbruchs nicht auf das Handeln der den Patienten behandelnden Ärzte sowie der Betreuer und Bevollmächtigten beschränkt ist, sondern auch das Handeln Dritter erfassen kann, soweit sie als von dem Arzt, dem Betreuer oder dem Bevollmächtigten für die Betreuung hinzugezogene Hilfspersonen tätig werden.[168] Damit sind im Ergebnis neu die dem Begriff des Behandlungsabbruchs immanenten Kriterien der Behandlungsbezogenheit und der Verwirklichung des auf die Behandlung bezogenen Willens der betroffenen Person anstelle der bisherigen Unterscheidung zwischen aktivem und passivem Handeln massgebend.[169]
26
Im Ergebnis verdient das Urteil Zustimmung bezüglich der Ableitung der Zulässigkeit der Sterbehilfe aus dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten, womit die strafrechtliche Rechtsprechung Anschluss an die gesetzliche Entscheidung der §§ 1901a ff. BGB hält.[170] Ebenfalls zu begrüssen ist die Klarstellung, dass Sterbehilfe durch aktives Tun zulässig ist, ohne dass dazu das dogmatische Konstrukt eines Unterlassens durch Tun herangezogen werden muss.[171] Dies schenkt der Tatsache Beachtung, dass gemäss dem heutigen Stand der Medizin ein Behandlungsabbruch regelmässig in der Vornahme von verschiedenen Handlungen besteht und sich nicht in blosser Untätigkeit erschöpft.[172] Das Unterscheidungsmerkmal des Behandlungszusammenhangs erscheint als geeignetes Kriterium, um nicht nur eine gänzlich behandlungsfremde Massnahme, sondern auch eine vorsätzlich überdosierte Medikamentenabgabe als Tötungsdelikt auszuweisen.[173] Unglücklich erscheint indes die begründungslose Einbeziehung der indirekten Sterbehilfe[174], da die Lebensverkürzung durch Schmerzmittelgabe mit einem Behandlungsabbruch unmittelbar nichts zu tun hat.[175]
27
Kritisiert wird zu Recht die Aufgabe der Unterscheidung der gesetzlich vorgegebenen Handlungsformen des Tuns und Unterlassens.[176] Eine Abgrenzung zwischen Tun und Unterlassen muss nur schon deshalb erfolgen, weil bei unechten Unterlassungsdelikten für die Strafbarkeit zusätzliche Voraussetzungen wie etwa das Erfordernis einer Garantenstellung bestehen und nur bei einer Begehung durch Unterlassung § 13 Abs. 2 StGB greift.[177] Betrachtet man das Urteil des BGH im entsprechenden Kontext wird jedoch deutlich, dass dem 2. Strafsenat allein an der Klarstellung daran gelegen war, dass die Rechtmässigkeit von Sterbehilfemassnahmen nicht davon abhängen darf, ob es sich beim entsprechenden Vorgehen strafrechtlich um ein Tun oder Unterlassen handelt; der Vorwurf, dass mit dem Grundsatzurteil des BGH eine Einebnung der Verhaltensformen des Tuns und Unterlassen stattgefunden habe, erweist sich somit als unbegründet.[178] Bereits vor dem „Fall Putz“ wurde die strafrechtliche Bewertung eines Behandlungsverzichts nicht von der Einordnung als Tun oder Unterlassen abhängig gemacht – die Lösung per se war somit nie umstritten.[179]
Читать дальше