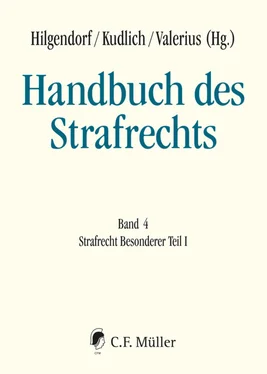2. Aktive Sterbehilfe
a) Direkte aktive Sterbehilfe
12
Die gezielte Tötung eines anderen sowie die Beschleunigung des Todeseintritts bei einem anderen durch ein aktives Tun stellt eine strafbare Tötung dar, auch wenn der Sterbende dies ausdrücklich verlangt.[85] Dies gilt auch bei nur geringfügiger Verkürzung des Lebens des Opfers.[86] In diesem Zusammenhang unterstreicht die Bestimmung von § 216 StGB (Tötung auf Verlangen), dass selbst das Verlangen als gesteigerte Form der Einwilligung keinen Ausschluss der Strafbarkeit bewirkt.[87] Somit bleibt etwa das Setzen einer Giftspritze durch einen Arzt, um den leidenden Patienten auf dessen ausdrücklichen Wunsch von seinen qualvollen Schmerzen zu erlösen, nach § 216 StGB strafbar.[88] Eine Rechtfertigung nach § 34 StGB scheidet nach h.M. aus.[89] In der Literatur wird jedoch durchaus auch die gegenteilige Meinung vertreten, dass in Fällen extremen Leidens des Moribunden eine Rechtfertigung der gezielten aktiven Lebensverkürzung nach den Regeln des rechtfertigenden Notstands in Betracht kommen soll.[90] Insbesondere in Fällen, welche substanziell einem Suizid gleichkommen, der aber aufgrund des physischen Zustandes des Sterbenden nicht mehr von ihm selbst ausgeführt werden kann, erscheint eine Rechtfertigung vertretbar.[91] Duttge schlägt die Einführung eines „minderschweren Falls“ in einem Abs. 3 in § 216 StGB vor, mit welchem für aussergewöhnliche und einzigartige Fälle aufgrund einer Gesamtwürdigung der konkreten Umstände die blosse Verurteilung mit Strafvorbehalt (§ 59 StGB) erlaubt würde.[92] Rosenau plädiert ebenfalls für eine gesetzliche Regelung der begrenzten Freigabe aktiver Sterbehilfe; ein fakultatives Absehen von Strafe reiche nicht weit genug, da klare und vor allem berechenbare Konsequenzen nötig seien.[93] Diesen Tendenzen ist zuzustimmen, ist es doch nicht logisch zu begründen, dass eine Abwägung zwischen dem Lebensinteresse des Patienten und seinem Interesse an Schmerzfreiheit im Falle der indirekten Sterbehilfe zulässig, bei nicht mehr therapeutisch beherrschbaren Qualen jedoch unzulässig sein soll.[94] Das auf § 216 StGB gestützte absolute Verbot ist in Fällen medikamentös nicht mehr unterdrückbarer Vernichtungsschmerzen rechtspolitisch sowie dogmatisch zweifelhaft.[95] Im genannten Grenzbereich ist eine auf die Befürchtung eines „Dammbruchs“ gestützte Abgrenzung zur indirekten Sterbehilfe kaum realistisch.[96] Die geltende Rechtslage führt in der Praxis zu einem Dunkelfeld von Mitleids-Tötungen im Grenzbereich zur indirekten Sterbehilfe.[97]
b) Indirekte aktive Sterbehilfe
13
Indirekte Sterbehilfe liegt vor, wenn ein früherer Todeseintritt unvermeidliche, aber auch unbeabsichtigte Folge der Verabreichung schmerzlindernder Medikamente an einen Todkranken oder einen Sterbenden mit dessen (mutmasslicher) Einwilligung ist.[98] Es handelt sich dabei um einen Unterfall der aktiven Sterbehilfe.[99] Der BGH hat in seiner Grundsatzentscheidung zur Straflosigkeit der indirekten Sterbehilfe ausgeführt, dass eine ärztlich gebotene schmerzlindernde Medikation entsprechend dem erklärten oder mutmasslichen Patientenwillen bei einem Sterbenden nicht dadurch unzulässig wird, dass sie als unbeabsichtigte, aber in Kauf genommene unvermeidbare Nebenfolge den Todeseintritt beschleunigen kann.[100] In ähnlicher Weise äussern sich auch die Grundsätze der Bundesärztekammer: „Bei Sterbenden kann die Linderung des Leidens so im Vordergrund stehen, dass eine möglicherweise unvermeidbare Lebensverkürzung hingenommen werden darf.“[101]
14
Nach dem Stand der heutigen Schmerztherapie wird eine Lebensverkürzung zwar nur noch selten gegeben sein, auszuschliessen ist sie jedoch im Einzelfall nicht.[102] Obwohl die Zulässigkeit der indirekten Sterbehilfe in Deutschland seit langem anerkannt ist, besteht über deren Begründung sowie Reichweite nach wie vor Uneinigkeit.[103] Was die Reichweite betrifft, besteht die Straflosigkeit der indirekten aktiven Sterbehilfe nach h.M. auch dann, wenn der Arzt die lebensverkürzende Wirkung als sicher voraussieht, somit mit dolus directus zweiten Grades handelt.[104] Des Weiteren kann es nicht auf die Zeitspanne der Lebensverkürzung ankommen, weshalb kein Grund besteht, die Straflosigkeit auf die Fälle der Sterbehilfe im engeren Sinn zu begrenzen.[105] Die Zulässigkeit der indirekten Sterbehilfe erstreckt sich somit auf alle mit unzumutbaren Schmerzen oder anderen unzumutbaren Leiden verbundenen „tödlichen Krankheiten“.[106]
15
Begründet wird die Straflosigkeit von Teilen des Schrifttums durch Tatbestandsausschluss, weil die indirekte aktive Sterbehilfe sozialadäquat sei und daher ihrem Sinngehalt nach den Bestimmungen einer strafbaren Tötung (§§ 212, 216 StGB) nicht unterliege.[107] Vereinzelt wird auch die Rechtsfigur des erlaubten Risikos herangezogen.[108] Nach der heute überwiegenden Meinung liegt zwar eine Tötung vor, diese ist jedoch wegen rechtfertigenden Notstandes straflos.[109] Die Annahme einer rechtfertigenden Einwilligung des Todkranken wird durch die Einwilligungssperre von § 216 StGB verunmöglicht.[110] Eine Rechtfertigung der indirekten Sterbehilfe aufgrund von § 34 StGB bedingt die Abwägung der Interessen des in die Behandlung (mutmasslich) einwilligenden Patienten und der entgegenstehenden Interessen an längstmöglicher Lebenserhaltung.[111] Es fliessen somit Einwilligungselemente in den Abwägungsvorgang im Rahmen der Notstandslösung mit ein.[112] Vereinzelt wird der Standpunkt vertreten, dass das Rechtsgut „Leben“ abwägungsresistent sei und deshalb eine Notstandssituation, welche eine solche Abwägung gerade voraussetzt, nicht vorliegen kann.[113] § 34 StGB stellt jedoch entscheidend auf eine Abwägung nicht der Rechtsgüter, sondern der konkreten Interessen ab, weshalb ein wesentliches Überwiegen des Schmerzlinderungsinteresses über das Interesse an einem (leidvollen) Weiterleben nicht an der Höchstwertigkeit des Rechtsguts Leben scheitern kann.[114] Einige Autoren sowie der Bundesgerichtshof begründen mit dem Recht des Patienten auf ein humanes Sterben in Würde ein Überwiegen des Schmerzlinderungsinteresses gegenüber der Lebensverkürzung, indem die Menschenwürde als verfassungsrechtlicher Höchstwert über dem Lebensrecht steht.[115] Zudem wird vorgebracht, dass § 34 StGB auf die Kollision der Rechtsgüter verschiedener Personen zugeschnitten sei; dagegen lässt sich einwenden, dass Wortlaut und Systematik eine Subsumtion von Sachverhalten, welchen Interessenkollisionen innerhalb der Sphäre ein und derselben Person zugrunde liegen, zulassen.[116] Eine analoge Anwendung auf Sachverhalte der indirekten Sterbehilfe ist zumindest möglich.[117] Die Diskussion verdeutlicht, dass die Trennung der strafbaren und straflosen Formen aktiver Sterbehilfe zweifelhaft und kriminalpolitisch zunehmend problematisch ist.[118]
3. Passive Sterbehilfe
16
Von passiver Sterbehilfe spricht man, wenn eine zur Lebensverlängerung notwendige Behandlung durch eine Betreuungsperson, in den meisten Fällen den behandelnden Arzt, unterlassen wird.[119] Der Begriff der „passiven“ Sterbehilfe ist insofern irreführend, als sich die Unzulässigkeit von ärztlichen Eingriffen bei entscheidungsfähigen Patienten bereits aus dem Selbstbestimmungsrecht ergibt; bei Unterlassen solcher Eingriffe kann somit nicht sinnvoll von „Sterbehilfe“ gesprochen werden.[120]
17
Grundsätzlich sind der Arzt und sonstige Betreuungspersonen gegenüber dem Patienten als Garanten verpflichtet, das ihnen medizinisch Mögliche zur Wahrung der Belange des Patienten zu unternehmen.[121] Es besteht jedoch weitgehend Einigkeit darüber, dass die Nichteinleitung oder Nichtweiterführung lebenserhaltender Massnahmen in der Sterbephase oder bei einem tödlich Kranken rechtmässig sein kann.[122] Aus der erforderlichen Einwilligung in ärztliche Heilmassnahmen als Kern des Arzt-Patienten-Verhältnisses ergibt sich, dass der Patient vom Arzt jederzeit die Einstellung der Behandlung verlangen kann, selbst wenn dadurch mit Sicherheit der Tod des Patienten eintreten wird.[123] Massnahmen künstlicher Lebensverlängerung gegen den Willen des Patienten sind mit dessen Selbstbestimmungsrecht unvereinbar.[124]
Читать дальше