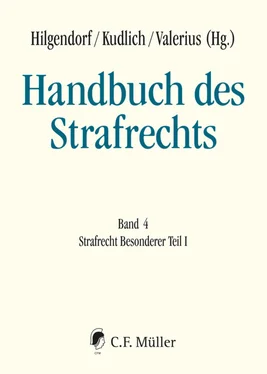[279]
SK- Sinn , § 212 Rn. 72.
[280]
Ansätze bei MK- Schneider , § 212 Rn. 92; Sch/Sch- Eser/Sternberg-Lieben , § 212 Rn. 12a; SK- Sinn , § 212 Rn. 75.
[281]
SK- Wolters , § 221 Rn. 1.
[282]
LK- Jähnke , § 221 Rn. 23; MR- Safferling , § 221 Rn. 4.
[283]
BGHSt 38, 78, Leitsatz.
[284]
BGHSt 38, 78, 79.
[285]
Vgl. einerseits LK- Jähnke , § 221 Rn. 40: „Da der Versuch der Aussetzung nach Absatz 1 nicht strafbar ist, muss mithin die Möglichkeit eines Verbrechensversuchs nach Absatz 3 ausscheiden“; andererseits SK- Wolters , § 221 Rn. 16: „… dass der Versuch des Grunddelikts nicht unter Strafe steht, hat hierbei keine Bedeutung.“.
[286]
MR- Safferling , § 221 Rn. 1; Rengier , BT/2, § 10 Rn. 1.
[287]
MR- Safferling , § 221 Rn. 20.
[288]
MR- Safferling , § 221 Rn. 5.
[289]
LK- Jähnke , § 221 Rn. 11.
[290]
LK- Jähnke , § 221 Rn. 18; MR- Safferling , § 221 Rn. 7; SK- Wolters , § 221 Rn. 3.
[291]
MR- Safferling , § 221 Rn. 8.
[292]
LK- Jähnke , § 221 Rn. 20.
[293]
SK- Wolters , § 221 Rn. 4.
[294]
LK- Jähnke , § 221 Rn. 21; MR- Safferling , § 221 Rn. 9; SK- Wolters , § 221 Rn. 5.
[295]
Dazu instruktiv SK- Wolters , § 221 Rn. 3: „gefestigtes Zwischenstadium“.
[296]
SK- Wolters , § 221 Rn. 6.
[297]
MR- Safferling , § 221 Rn. 11.
[298]
LK- Jähnke , § 221 Rn. 26; SK- Wolters , § 221 Rn. 9.
[299]
LK- Jähnke , § 221 Rn. 9.
[300]
LK- Jähnke , § 221 Rn. 8.
[301]
Sch/Sch- Eser , § 221 Rn. 14.
[302]
LK- Jähnke , § 221 Rn. 37.
[303]
SK- Wolters , § 221 Rn. 14.
[304]
Fischer , § 221 Rn. 21.
[305]
Heger , ZStW 119 (2007), 593, 613; Krey/Hellmann/Heinrich , BT/1, Rn. 140; Maurach/Schroeder/Maiwald , BT/1, § 4 Rn. 17; I. Sternberg-Lieben/Fisch , Jura 1999, 45, 49.
[306]
SK- Wolters , § 221 Rn. 14.
[307]
MR- Safferling , § 221 Rn. 24; SK- Wolters , § 221 Rn. 15.
[308]
Vgl. BGHSt 39, 322 ff.
[309]
MR- Safferling , § 221 Rn. 25.
[310]
MR- Safferling , § 221 Rn. 18; Sch/Sch- Eser , § 221 Rn. 10; SK- Wolters , § 221 Rn. 12.
[311]
LK- Jähnke , § 221 Rn. 37.
[312]
MR- Safferling , § 221 Rn. 20.
[313]
Vgl. die Beispiele bei LK- Jähnke , § 221 Rn. 35.
[314]
SK- Wolters , § 221 Rn. 16.
[315]
LK- Jähnke , § 221 Rn. 40.
[316]
SK- Wolters , § 221 Rn. 16.
[317]
SK- Wolters , § 222 Rn. 2.
[318]
Sch/Sch- Eser , § 222 Rn. 2.
[319]
MR- Safferling , § 222 Rn. 6.
[320]
BGHSt 24, 342, 344.
[321]
MR- Safferling , § 222 Rn. 3.
[322]
Rengier , AT, § 52 Rn. 26.
[323]
BGHSt 11, 1, 7.
[324]
BGHSt 24, 31, 34; 33, 61, 63.
[325]
BGHSt 24, 31, 34; 33, 61, 64.
[326]
BGHSt 33, 61, 64.
[327]
MR- Engländer , § 231 Rn. 7.
[328]
MR- Engländer , § 224 Rn. 14.
1. Abschnitt: Schutz von Leib und Leben› § 2 Sterbehilfe
Christian Schwarzenegger
A.Verfassungs- und konventionalrechtliche Grundlagen der Sterbehilfe1 – 7
I. Recht auf Leben1, 2
II. Menschenwürde3, 4
III. Selbstbestimmungsrecht5 – 7
B.Beginn und Ende des Lebens8 – 10
I. Beginn des menschlichen Lebens8, 9
II. Ende des menschlichen Lebens10
C.Unterscheidung der verschiedenen Formen von Sterbehilfe11 – 32
I.Traditionelle Differenzierung11 – 23
1. Abgrenzung Sterbehilfe im engeren und im weiteren Sinn11
2.Aktive Sterbehilfe12 – 15
a) Direkte aktive Sterbehilfe12
b) Indirekte aktive Sterbehilfe13 – 15
3.Passive Sterbehilfe16 – 23
a) Begriff16 – 21
b) Technischer Behandlungsabbruch als Unterlassen22, 23
II.Bildung neuer Kategorien mit dem Grundsatzurteil BGHSt 55, 19124 – 32
1. Der normativ-wertende Oberbegriff des Behandlungsabbruchs24, 25
2. Würdigung26 – 32
D.Suizidbeihilfe33 – 47
I. Prinzipielle Straflosigkeit der Suizidbeihilfe33 – 36
II.Strafbarkeit der geschäftsmässigen Förderung der Selbsttötung (§ 217 StGB)37 – 47
1. Allgemeines37
2. Objektiver Tatbestand38 – 43
3. Subjektiver Tatbestand44
4. Strafausschliessungsgrund des Abs. 245, 46
5. Kritik47
E.Vergleich der Sterbehilfe in Deutschland und der Schweiz48 – 57
I. Verfassungsrechtliche Erwägung48 – 50
II.Sterbehilfe51 – 55
1. Indirekte aktive Sterbehilfe51
2. Direkte aktive Sterbehilfe52
3. Passive Sterbehilfe53 – 55
III. Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord56, 57
Ausgewählte Literatur
1. Abschnitt: Schutz von Leib und Leben› § 2 Sterbehilfe› A. Verfassungs- und konventionalrechtliche Grundlagen der Sterbehilfe
A. Verfassungs- und konventionalrechtliche Grundlagen der Sterbehilfe
1
Das in Art. 2 Abs. 2 GG garantierte personale Freiheitsrecht der körperlichen Integrität (Leben und körperliche Unversehrtheit) ist von fundamentaler Bedeutung, da das Leben eine Voraussetzung für die Ausübung aller Freiheitsrechte darstellt.[2] Die staatliche Schutzpflicht für das menschliche Leben gilt jedoch nicht absolut und unbeschränkt; als positives Tätigkeitsrecht hängt sie von den jeweils bestehenden Umständen ab, wodurch dem Gesetzgeber ein weiter Gestaltungsspielraum, abgesteckt durch die Grenzen des Untermassverbotes, eingeräumt wird.[3] Dadurch kann den Besonderheiten der Sterbehilfe Rechnung getragen und ein dem Lebensschutz entgegenstehendes Autonomieinteresse berücksichtigt werden.[4] Um eine Kollision zwischen Wesensgehaltsgarantie (Art. 19 Abs. 2 GG) und Eingriffsermächtigung (Art. 2 Abs. 2 S. 3 GG) zu vermeiden, lässt sich Art. 19 Abs. 2 GG in Bezug auf das Leben nur in einem generellen, institutionellen Sinne verstehen.[5] Dadurch bleibt Raum für eine Abwägung der im Einzelfall konkret bestehenden Interessen, insbesondere zwischen Lebensgarantie, Menschenwürde und Selbstbestimmung.[6] Ein Recht auf die Beendigung des eigenen Lebens kann aus dem Recht auf Leben jedoch nicht abgeleitet werden; so ist ein Recht auf Selbsttötung jedenfalls von Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG nicht umfasst.[7] Diese Entscheidung ist vielmehr Ausfluss der allgemeinen Handlungsfreiheit im Rahmen von Art. 2 Abs. 1 GG.[8] Zwar besteht aufgrund von Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG eine Schutzbefugnis des Staates, die Freiheit des Betroffenen aus gewichtigen Gründen einzuschränken, jedoch kommt der Entscheidungsfreiheit des Betroffenen grosses Gewicht zu.[9] Der objektive Wertgehalt des „Rechts auf Leben“ darf nicht gegen die Selbstbestimmung des Grundrechtsträgers ausgespielt werden.[10]
2
Art. 2 EMRK schützt, wie auch Art. 6 UNO-Pakt II, ebenfalls das Recht auf Leben; aus Art. 2 EMRK kann kein Recht zu sterben und ebenso wenig ein Recht auf Selbstbestimmung im Sinne eines Rechts auf Entscheidung für den Tod anstelle des Lebens abgeleitet werden.[11] Der Staat muss somit gemäss Urteil Pretty vs. United Kingdom die aktive Sterbehilfe nicht zulassen – (ausdrücklich) offen gelassen wurde die Frage, ob er sie zulassen darf .[12] Bei der Auslegung von Art. 2 EMRK sollte der durch die Rechtsprechung des EGMR herausgebildete konventionsrechtliche Menschenwürdeansatz[13] miteinbezogen werden – dies in dem Sinne, dass sich der Ausdruck „deprivation of life“ im Hinblick auf bestimmte Fälle systematisch und teleologisch reduzieren lässt.[14] Bei der passiven Sterbehilfe hingegen liegt keine gezielte Lebensbeendigung vor, sondern lediglich die Nichtaufnahme lebenserhaltender Massnahmen durch einen Dritten, weshalb durch die Möglichkeit des Behandlungsverzichts keine staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 EMRK verletzt wird.[15] Auch der Abbruch lebenserhaltender Massnahmen wird durch die h.L. hier eingeordnet, obwohl dies strittig ist.
Читать дальше