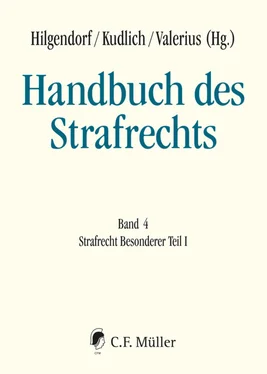46
Eine Legaldefinition des Begriffs des Angehörigen findet sich in § 11 Abs. 1 Nr. 1 StGB, derjenige der nahestehenden Person entspricht dem des § 35 Abs. 1 StGB.[291] Aufgrund der Gleichstellung mit den Angehörigen ist das Bestehen eines auf eine gewisse Dauer angelegten zwischenmenschlichen Verhältnisses erforderlich, wobei entscheidend ist, dass dem Angehörigenverhältnis entsprechende Solidaritätsgefühle existieren, woraus eine vergleichbare psychische Zwangslage folgt.[292] Als solche Verhältnisse „basaler Zwischenmenschlichkeit“ gelten etwa feste Liebesverhältnisse, nahe Freundschaften, im Regelfall auch nichteheliche bzw. nicht eingetragene Lebens- und langjährige Wohngemeinschaften, möglicherweise auch bei dauerhafter Aufnahme in den eigenen Haushalt, nicht aber der sympathiegetragene gesellschaftliche Umgang mit Sports- und Parteifreunden oder Berufskollegen und Nachbarn.[293] Gefordert wird ein Verhältnis, welches auf Gegenseitigkeit beruht; nicht genügend ist zudem ein Betreuungsverhältnis.[294] Die kumulative Formulierung des Nichtvorliegens einer Geschäftsmässigkeit neben der Angehörigenstellung verdeutlicht, dass der Strafausschliessungsgrund von Absatz 2 bei lediglich nicht geschäftsmässig Handelnden, die nicht in einem Näheverhältnis der genannten Art stehen, keine Anwendung findet.[295]
47
Kritiker sehen in § 217 StGB die Aussendung eines rechtspolitisch falschen Signals und eine kontraproduktive Wirkung, indem Suizidwillige sich selbst überlassen werden.[296] Verfassungsrechtliche Bedenken bestehen etwas aus Sicht der Suizidwilligen selbst, indem sie sich in ihrem Selbstbestimmungsrecht über das eigene Leben und Sterben gemäss Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG verletzt sehen.[297] Das Bundesverfassungsgericht hat jedoch einen Antrag auf Eilrechtsschutz von vier Mitgliedern des Vereins Sterbehilfe Deutschland e.V. gegen die Strafbarkeit der geschäftsmässigen Sterbehilfe mit der Begründung abgewiesen, dass im Rahmen einer Folgenabwägung die Nachteile im Falle einer Aussetzung des Vollzugs des § 217 StGB überwiegen, da eine Verleitung von Menschen zur Selbsttötung zu befürchten wäre.[298] Potentielle Suizidenten seien nicht Normadressaten der Strafandrohung von § 217 StGB, da eine Strafbarkeit des potentiellen Suizidenten wegen Anstiftung oder Beihilfe zu einer geschäftsmässigen Förderung der Selbsttötung bereits nach den Grundsätzen einer sog. notwendigen Teilnahme nicht in Betracht komme.[299] Sie seien nur insoweit betroffen, als das Verbot einer geschäftsmässigen Förderung der Selbsttötung die von ihnen grundsätzlich gewünschte konkrete Art eines begleiteten Suizids verhindere.[300] Schliesslich sei zu berücksichtigen, „dass die von den Beschwerdeführern gewünschte Selbstbestimmung über ihr eigenes Sterben durch eine Fortgeltung des § 217 StGB nicht vollständig verhindert, sondern lediglich hinsichtlich des als Unterstützer in Betracht kommenden Personenkreises beschränkt wird“.[301] Aus Sicht hilfswilliger Dritter können die Grundrechte der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) sowie unter Umständen auch der Berufsfreiheit (Art. 12 GG)[302] und der Freiheit des Gewissens (Art. 4 GG) betroffen sein.[303] Die Argumentation des VG Berlin[304] gilt nicht nur bezüglich ärztlicher Suizidbeihilfe, sondern auch dann, wenn sie durch eine andere Person, zum Beispiel einen Angehörigen oder einen anderen nahestehenden Menschen, etwa einen Sterbebegleiter, erfolgt; somit ist auch organisierte Sterbehilfe grundrechtlich geschützt, sofern das Vorliegen von Gewissensnot bejaht werden kann.[305] Das Erfordernis des geschäftsmässigen Handelns von § 217 StGB wird zwar ein besondere Gewissensnöte erzeugendes Näheverhältnis zum Suizidwilligen in vielen Fällen ausschliessen; bestehen bleibt jedoch das Grundrecht des Sterbewilligen, sich beim Sterben von hilfsbereiten Personen helfen zu lassen.[306] Die Tätigkeit – ob individueller oder organisierter – Hilfswilliger darf deshalb vom Staat nicht ohne Weiteres untersagt, sondern nur unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes eingeschränkt werden.[307] Ein Verbot der organisierten Sterbebegleitung und Sterbehilfe im engeren Sinne in Deutschland verkennt zudem die ethische Dimension sowie die Rechtswirklichkeit und nimmt billigend in Kauf, dass Suizidwillige ohne angemessene Beratung und Betreuung in Selbsttötungen getrieben werden und begünstigt den „Sterbetourismus“ ins Ausland.[308] Kritisiert wird auch das strafrechtliche Verbot als schärfstes staatliches Mittel anstelle einer Intervention über das Sicherheitsrecht, welche überwiegend als ausreichend erachtet wird.[309] Hilgendorf betrachtet ein strafrechtliches Verbot lediglich in solchen Fällen als sinnvoll, in denen Sterbehilfe aus Gewinnsucht oder unter Ausbeutung einer Zwangslage des Suizidwilligen in Bereicherungsabsicht erfolgt, womit er sich dem in der Schweiz geltenden Tatbestand von Art. 115 schwStGB annähert.[310] Zu Recht kritisch beurteilen zudem Rosenau/Sorge die „bedenklich weite Vorverlagerung der Strafbarkeit“, indem für die Begründung der Strafbarkeit nicht einmal ein Suizidversuch notwendig ist, sondern die „Gelegenheit“ dazu ausreicht; diese Erhebung blosser Moralvorstellungen zum Massstab des Strafrechts verstosse gegen das „ultima ratio“-Prinzip.[311]
1. Abschnitt: Schutz von Leib und Leben› § 2 Sterbehilfe› E. Vergleich der Sterbehilfe in Deutschland und der Schweiz
E. Vergleich der Sterbehilfe in Deutschland und der Schweiz
I. Verfassungsrechtliche Erwägung
48
Das in Art. 10 Abs. 2 BV statuierte Selbstbestimmungsrecht umfasst die individuelle Entscheidung über Art und Zeitpunkt der Beendigung des eigenen Lebens.[312] Dies entspricht dem von Art. 2 Abs. 1 GG gewährleisteten Recht auf selbstbestimmtes natürliches Sterben.[313] Voraussetzung ist, dass der Betroffene in der Lage ist, seinen Willen frei zu bilden und danach zu handeln.[314] Die Pflicht des Staates, das Recht auf Leben gemäss Art. 10 Abs. 1 BV grundsätzlich zu schützen, geht nicht soweit, dass er dies auch gegen den ausdrücklichen Willen des urteilsfähigen Betroffenen tun müsste.[315] Eine Abwägung des Rechts auf Leben und des Selbstbestimmungsrechts führt somit in Fällen des Suizids sowie der uneigennützigen Beihilfe zur Selbsttötung, der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung (Behandlungsverzicht) und der indirekten aktiven Sterbehilfe zu einer Relativierung der Lebensgarantie.[316] Ein Anspruch auf staatliche Hilfe zur Selbsttötung besteht nach geltendem Recht nicht.[317] So stellt etwa die Regelung, dass die Abgabe eines tödlichen Mittels an einen Suizidwilligen zwecks Verhinderung von Missbräuchen von einem ärztlichen Rezept und einer psychiatrischen Begutachtung abhängig ist, einen rechtmässigen Eingriff in Art. 10 Abs. 2 BV dar.[318] Der EGMR fordert hingegen in seiner Rechtsprechung zu Art. 8 EMRK verständliche und klare gesetzliche Richtlinien für die Abgabe einer letalen Dosis eines Medikaments zur Beendigung des Lebens.[319] Die Rechtfertigungs- oder Entschuldbarkeitsmöglichkeit einer aktiven Tötung durch einen Dritten aufgrund der Einwilligung eines Sterbewilligen wird im Rahmen der geltenden Verfassungsordnung von der h.L. und Rechtsprechung für die vorsätzliche Tötung unter Hinweis auf die strafrechtliche Wertungssystematik (absolute Einwilligungssperre von Art. 114 schwStGB) abgelehnt.[320] Diese Begründung widerspricht jedoch der Normenhierarchie, indem damit faktisch vom Gesetz auf die grundrechtliche Abwägung rückgeschlossen wird.[321] Vielmehr müssten die betroffenen Grundrechte gegeneinander abgewogen werden; nur dann, wenn bei dieser Prüfung ein überwiegendes Interesse am Schutz des Lebens resultiert, wird die strafrechtliche Wertungssystematik bestätigt.[322]
Читать дальше