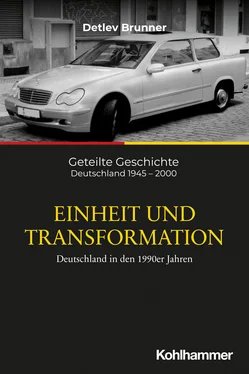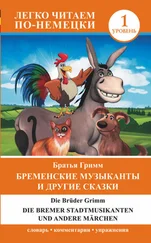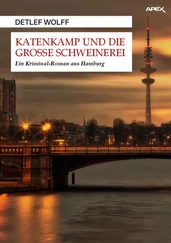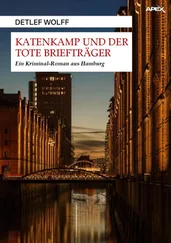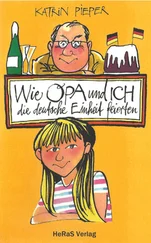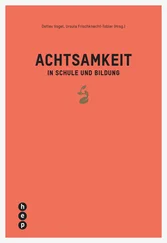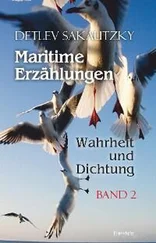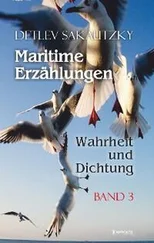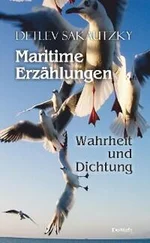Seit dem Dresden-Besuch im Dezember 1989 war Kohl deutlicher denn je auf das Ziel der deutschen Einheit konzentriert. Modrows Versuche, einen eigenständigen Beitrag zur Gestaltung der deutschen Einheit auf der Basis einer selbstständigen DDR zu leisten, waren chancenlos. Die Modrow-Regierung erweiterte zwar mit der Initiative »Deutschland, einig Vaterland« die Idee einer Vertragsgemeinschaft in Richtung einer Vereinigung der deutschen Staaten und reagierte damit auf die Einheitsforderungen aus der Bevölkerung. Doch der Handlungsrahmen der DDR-Regierung wurde zunehmend kleiner. Da halfen auch Bekenntnisse, wie sie Modrow am 5. Februar 1990 bei der Begründung seines Deutschlandplanes geäußert hatte, nicht mehr. Modrow konstatierte, »daß die Einheit der deutschen Nation nie verlorengegangen sei« 1.
Forderungen zur Stabilisierung der DDR, insbesondere die Zahlung eines Solidaritätsbeitrages in Höhe von 15 Mrd. DM, wie sie Modrow in Dresden und noch einmal bei seinem Besuch in Bonn am 13. Februar 1990 vortrug, wies Kohl zurück. Eine derartige Stützung der Regierung Modrow kam für die Bundesregierung nicht mehr in Frage. »In das bankrotte DDR-System noch einen Pfennig zu investieren, verbot sich einfach.« 2Die Haltung der Bundesregierung war eindeutig: Es ging zuallererst um die demokratische Legitimation der Regierung als Voraussetzung für weitere Schritte, die staatliche Vereinigung war die terminlich noch nicht gefasste Perspektive.
In der DDR begann nach der revolutionären Phase des Herbstes, die den Sturz der alten Macht bewirkt hatte, eine weitere Stufe des demokratischen Umbruchs. Der Terminus der Zeit lautete »Dialog«. Als zentrales Forum des Dialogs zwischen den neuen demokratischen Kräften und den Vertretern des alten Regimes konstituierte sich am 7. Dezember 1989 der zentrale »Runde Tisch«. Vorbilder gab es in Polen, in der DDR war die Initiative von den verschiedenen Organisationen der Bürgerbewegung ausgegangen. Die beiden Kirchen übernahmen Einladung und Moderation. Der »Runde Tisch« war kein Ersatz für das nach wie vor nicht demokratisch legitimierte DDR-Parlament, aber er war der Ort, an dem die zentralen Aufgaben des Übergangs hin zu einer demokratischen Ordnung verhandelt wurden, insbesondere die Vorbereitung von freien Wahlen, Verfassungsfragen sowie die Auflösung und die Sicherung der Hinterlassenschaften der Staatssicherheit. Unter der Regierung Modrow wurde zwar das Ministerium für Staatssicherheit durch das sogenannte Amt für Nationale Sicherheit abgelöst. Doch allein die Entscheidung, dieses Amt unter die Führung des bisherigen Mielke-Stellvertreters Wolfgang Schwanitz zu stellen, zeigte, dass hier alles andere als ein Neuanfang stattfand. Auch weitere Versuche der Regierung Modrow, eine Art Verfassungsschutz der DDR bzw. einen Nachrichtendienst mit bisherigem Stasi-Personal zu installieren, zeigten ein halbherziges Vorgehen in dieser Frage. Inzwischen besetzten Bürgerkomitees Dienststellen des MfS und sicherten so vorhandene Aktenbestände, mit deren Vernichtung die Stasi bereits begonnen hatte. Angesichts des enormen Drucks auch seitens des »Runden Tischs« erklärte Modrow in der Volkskammer am 12. Januar 1990 den Verzicht auf die Einrichtung eines »Verfassungsschutzes«. Am 15. Januar 1990 übernahm auch in der MfS-Zentrale in Berlin-Lichtenberg ein Bürgerkomitee in einer sogenannten »Sicherheitspartnerschaft« mit Staatsanwaltschaft und Volkspolizei die Aufsicht. Zum 31. März 1990 wurden alle Mitarbeitende der Stasi entlassen.
Die Monate ab Dezember 1989 waren eine Übergangsphase, in der die Zukunft der DDR nicht klar zu bestimmen war. In den Köpfen vieler Akteure war eine Zukunft auf eigenständiger Basis erstrebenswert, zum anderen zeichneten sich Entwicklungen ab, die die Perspektive einer weiterhin selbstständigen DDR unwahrscheinlich werden ließen. Die Handlungsfähigkeit der Regierung Modrow war eingeschränkt, seit dem 5. Februar 1990 war sie zwar um Vertreter der Bürgerbewegung zur Regierung der Nationalen Verantwortung erweitert worden, aber nach wie vor fehlte ihr – wie der Volkskammer – ein entscheidendes Kriterium: die demokratische Legitimation. Die DDR befand sich nicht nur politisch in einem äußerst labilen Zustand. Die massiven wirtschaftlichen Probleme hielten ebenso an wie der Exodus der Bevölkerung Richtung Westen. Regierungschef Modrow beklagte ein zunehmendes Schwinden der Autorität der Regierung auch auf der lokalen Ebene. Der Zerfall der DDR, so Modrow am 2. Februar 1990 in einem Gespräch mit Kohl, beschleunige sich täglich. 3
Der »Runde Tisch« hatte in seiner ersten Sitzung am 7. Dezember 1989 auf Antrag der Sozialdemokratischen Partei beschlossen, dass am 6. Mai 1990 freie Wahlen zur Volkskammer der DDR stattfinden sollten. Angesichts der rapiden Verschlechterung der wirtschaftlichen und politischen Situation waren die Modrow-Regierung und die Oppositionsvertreter am »Runden Tisch« am 28. Januar 1990 übereingekommen, den Wahltermin auf den 18. März vorzuverlegen. Fraglich war, ob die DDR im Mai überhaupt noch existieren würde.
Die Startbedingungen der Parteien zu dieser letzten und zugleich ersten freien Volkskammerwahl in der DDR waren höchst unterschiedlich. Die SED, nun mit dem Zusatz PDS (Partei des demokratischen Sozialismus) versehen, 4hatte zwar massive Mitgliedereinbußen zu verzeichnen, aber noch immer zählte sie 890.000 Mitglieder (im Mai 1989 waren es noch mehr als 2,2 Mio. gewesen) und verfügte über eine flächendeckende Organisationsstruktur. Auch die einstmaligen Blockparteien, insbesondere die CDUD und die LDPD, konnten auf bisherige Organisationsstrukturen zurückgreifen. Sie kamen als potenzielle Partner für die westdeutsche CDU und FDP in Frage. Hier gab es zwar deutliche Vorbehalte angesichts der politischen Vergangenheit der Blockparteien, doch beide Parteien entschlossen sich zur Unterstützung ostdeutscher Bündnisse, die im Falle der CDU, die Ost-CDU, den aus der Bürgerbewegung entstandenen Demokratischen Aufbruch (DA) sowie die konservative und von der bayrischen CSU unterstützte Deutsche Soziale Union (DSU) umfasste – die »Allianz für Deutschland«. Bei der FDP war es der Bund Freier Demokraten, dessen größter Anteil von der ehemaligen Blockpartei LDPD gebildet wurde.
Die im Herbst 1989 neugegründete Sozialdemokratische Partei verfügte zwar nicht über Strukturen wie die alten DDR-Parteien, konnte jedoch auf die Unterstützung einer starken Partnerin rechnen, der SPD der Bundesrepublik. Ein Wahlsieg der Sozialdemokraten galt vielen als ausgemacht. In Umfragen vom Anfang Februar 1990 lag die SPD mit 54 Prozent in der Wählergunst vorn, die SED-PDS mit 12 Prozent noch vor der CDU mit 11 Prozent. 5Weitgehend ohne westdeutsche Unterstützung agierten jene Gruppierungen, die das Herz der Friedlichen Revolution gebildet hatten, das Neue Forum, Demokratie Jetzt und die Initiative für Frieden und Menschenrechte, die sich für die Wahl zum »Bündnis 90« zusammenschlossen.
Schon der Wahlkampf zeigte deutliche Veränderungen zur bisherigen Kultur der Friedlichen Revolution, zu den basisdemokratischen Strukturen der Bürgerbewegung. Die Orientierung am westdeutschen parteipolitischen Modell war unübersehbar, und das hing auch mit dem immer deutlicher werdenden Einheitswillen zusammen. Anfang Februar 1990 ergaben Meinungsumfragen des Leipziger Zentralinstituts für Jugendforschung und eines westdeutschen Marktforschungsinstituts eine Zustimmung zur Vereinigung von 75 Prozent der Befragten in der DDR, im November 1989 waren es noch 48 Prozent gewesen 6.
Helmut Kohl zog bei seinen Wahlveranstaltungen in der DDR seit Februar 1990 Hunderttausende an. Der westdeutsche Kanzler war seit seiner Dresdner Rede im Dezember 1989 in der DDR-Bevölkerung äußerst populär. Obwohl er ja gar nicht zur Wahl stand, erschien er als der Garant für Einheit und Wohlstand. Dabei spielte auch eine Rolle, dass der Kanzler am 6. Februar 1990 eine Wirtschafts- und Währungsunion angekündigt hatte, um, so seine Ausführungen vor der Presse, »schnellstmöglich Anschluß an das Realeinkommensniveau der Bundesrepublik zu finden« 7– eine Perspektive, die sich in der Folge als erheblich zu optimistisch erwies. 8Während Kohl so als Retter erschien, zeigten sich führende westdeutsche Sozialdemokraten, darunter der Kanzlerkandidat Oskar Lafontaine und der Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Hans-Jochen Vogel, als Skeptiker. Ihre Vorbehalte gegen eine schnelle Währungsunion waren sachlich begründet und nachvollziehbar, psychologisch gesehen trafen sie jedoch nicht die Stimmungslage der Mehrheit der DDR-Bevölkerung. Nicht zuletzt deshalb fiel das Ergebnis der Volkskammerwahlen deutlich anders aus, als viele erwartet hatten.
Читать дальше