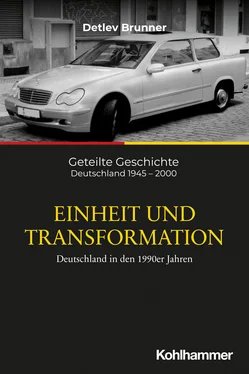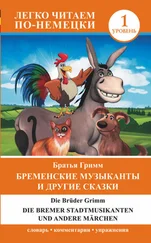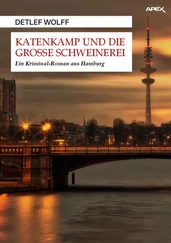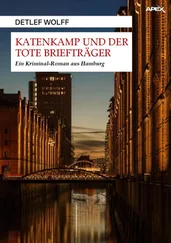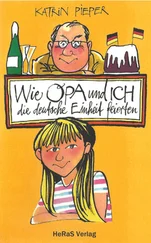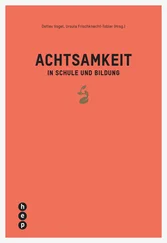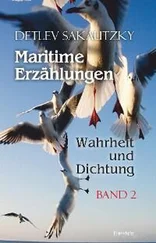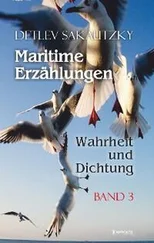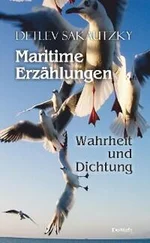War der 9. Oktober 1989 der Höhepunkt der Friedlichen Revolution, so war der 9. November 1989 eine Zäsur im Hinblick auf ein vereintes Deutschland. Wie auch immer die zeitliche Perspektive aussehen konnte, angesichts der Probleme der DDR und angesichts der nun offenen Grenze erschien die Einheit als ein Ziel, das nunmehr anzusteuern sei. Doch zunächst herrschte Zurückhaltung vor.
Am 16. November 1989 bekannte Bundeskanzler Helmut Kohl im Deutschen Bundestag, dass die Bundesrepublik jede Entscheidung respektieren werde, die die Menschen in der DDR in freier Selbstbestimmung träfen. »Unsere Landsleute in der DDR müssen selbst entscheiden können, welchen Weg in die Zukunft sie gehen wollen.« Man wolle die Bürger der DDR nicht »bevormunden«, ihnen allerdings auch nicht »einreden, das Beste sei die staatliche Teilung unseres Vaterlandes«. 33Dieser Hinweis auf staatliche Einheit war zu diesem Zeitpunkt von Bonner Seite das Äußerste an offiziellen Verlautbarungen. Auch Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) warnte davor, den Menschen in der DDR hineinzureden und empfahl:
»Wir, die wir im freiesten und sozialsten Staat unserer Geschichte leben, tun gut daran, ohne Überheblichkeit zu prüfen, was wir von dieser neuen politischen Kultur und von den mündigen Bürgern in der DDR lernen können.« 34
Am 17. November 1989 schlug der neue Regierungschef der DDR, Hans Modrow, in seiner Regierungserklärung eine »Vertragsgemeinschaft« zwischen den beiden deutschen Staaten vor. Modrows Ziel war keine »Wiedervereinigung«, er wollte die Verbindung mit der Bundesrepublik nutzen, um Anschluss an den Binnenmarkt der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) zu erlangen und damit das Überleben der DDR ökonomisch zu sichern. 35
Am 20. November 1989 notierte Horst Teltschik, stellvertretender Kanzleramtschef und enger Berater des Bundeskanzlers:
»Die internationale wie die innenpolitische Diskussion über die Chancen einer Wiedervereinigung Deutschlands ist voll entbrannt und nicht mehr aufzuhalten. […] Mehr und mehr sind wir uns dessen bewusst, doch die Weisung des Bundeskanzlers bleibt, in der öffentlichen Diskussion Zurückhaltung zu üben. Weder innerhalb der Koalition, und damit innenpolitisch, noch außenpolitisch will er Angriffsflächen bieten.« 36
Doch eine Woche später war es mit der Zurückhaltung vorbei. Am 28. November 1989 präsentierte der Bundeskanzler dem Deutschen Bundestag ein »Zehn-Punkte-Programm«, das im Bundeskanzleramt am 23./24. November 1989 ausgearbeitet worden war. Zuvor waren Signale aus Moskau erfolgt, die als Akzeptanz einer möglichen Wiedervereinigung gedeutet wurden. Konkret ging es um ein Treffen Teltschiks mit Nikolai Portugalow, Berater der Abteilung für internationale Beziehungen des ZK der KPdSU am 21. November 1989. Portugalow hatte ein Papier mit einer Vielzahl von Fragen übergeben, die vor einer Vereinigung zu lösen wären. Allein die Übergabe dieses Papiers wurde als Hinweis auf eine grundsätzliche Bereitschaft der Sowjetunion gedeutet, sich mit einer Wiedervereinigung auseinanderzusetzen. Dass dies eine sehr weitgehende Interpretation war, zeigten die Bedenken, die die Sowjetunion in den weiteren Verhandlungen vorbrachte. Die US-amerikanische Regierung war als einzige der verbündeten Mächte vorab von dem Plan informiert worden. Mit den übrigen Verbündeten, Großbritannien und Frankreich, war nicht gesprochen worden.
Im Zehn-Punkte-Programm war zwar auch der Vorschlag einer »Vertragsgemeinschaft« enthalten, den die Modrow-Regierung unterbreitet hatte, doch in der Öffentlichkeit wurden Kohls »Zehn Punkte« schnell als Plan zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten wahrgenommen. Dabei hatte sich Kohl weder auf einen Zeitplan noch auf die konkrete Ausgestaltung eines vereinten Deutschlands festgelegt. Das Programm enthielt zudem eine klare europäische Dimension, denn Kohl war bewusst, dass eine deutsche Vereinigung nur in dieser Verbindung anzusteuern und zu vermitteln war. Die Zielrichtung war gleichwohl klar. Über eine Vertragsgemeinschaft sollten konföderative Strukturen mit dem Ziel einer Föderation der beiden Staaten erreicht werden. Voraussetzung seien freie Wahlen in der DDR und eine entsprechend legitimierte Regierung. Auf dieser Basis könnten dann gesamtdeutsche Institutionen geschaffen werden, darunter auch eine gemeinsame parlamentarische Körperschaft. Dann schließlich könne das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangen. 37So unbestimmt der Zeitplan, das Ziel der Einheit war nun eindeutig formuliert.
In der DDR setzte sich währenddessen der Erosionsprozess der alten Machtstrukturen fort. Am 1. Dezember 1989 beschloss die Volkskammer nach nur kurzer Debatte die Streichung des in der DDR-Verfassung verankerten Führungsanspruches der SED, der darin ebenfalls festgeschriebene Charakter des Staates als sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern sollte jedoch weiter aufrechterhalten bleiben. Am 3. Dezember 1989 trat Egon Krenz und mit ihm das neu gewählte Politbüro der SED geschlossen zurück, am 6. Dezember 1989 trat Krenz auch von seiner Funktion als Vorsitzender des Staatsrates zurück. Diese Schritte waren lautstark von der Demokratiebewegung gefordert worden und sie waren im Sinne einer Demokratisierung nur folgerichtig. Krenz, der den Begriff »Wende« gerne für seine Amtsübernahme in Anspruch nahm, war alles andere als eine Alternative zur bisherigen SED-Führung. Nicht nur die Tatsache, dass er ihr ja selbst seit langem angehört hatte, stand dagegen, sondern auch seine Vorstellungen von »Wende«, die er noch Ende Oktober gegenüber westdeutschen Gesprächspartnern geäußert hatte. In seinem ersten Telefonat mit Kanzler Kohl am 26. Oktober 1989 betonte Krenz, dass Wende »keinen Umbruch« bedeute und eine sozialistische DDR auch im Interesse der Stabilität in Europa sei. 38In einer Unterredung mit Ministerpräsident Johannes Rau und weiteren Vertretern der SPD aus Nordrhein-Westfalen am 9. November 1989 antwortete Krenz auf die Frage, ob denn nun Vertreter der Opposition in die Regierung aufgenommen würden, er sei gegen den Begriff der Opposition, die Verfassung sehe vor, dass die Regierung im Rahmen der Nationalen Front gebildet werde. 39Das waren wahrlich keine Reformtöne und von einer politischen Wende konnte keine Rede sein.
Am 19. Dezember 1989 traf Bundeskanzler Kohl zum ersten Mal mit dem DDR-Ministerpräsidenten Hans Modrow in Dresden zusammen. Die Koordinaten im deutsch-deutschen Verhältnis hatten sich in dramatischer Weise verändert. Die DDR war kein zu stabilisierender Faktor mehr im Mächtespiel der ideologischen und militärischen Blöcke, sondern ein dem Untergang geweihter Staat. Hans Modrow, einstmaliger Hoffnungsträger einer reformierten SED, verhandelte anders als der am 18. Oktober 1989 zurückgetretene Erich Honecker nicht mehr annähernd auf gleicher Augenhöhe mit dem westdeutschen Kanzler. Das, was in den Jahren zuvor seitens der Bundesregierung als nicht aktuelles Fernziel formuliert worden war, dem man in kleinen Schritten der »Normalisierung« näherkommen wollte, stand nun unerwartet vor der Tür. Die »deutsche Frage« war nicht mehr »offen«, sie musste gestaltet werden und die Gestaltungsmacht lag eindeutig auf westlicher Seite. Die Bundesregierung und namentlich Helmut Kohl hatten nach anfänglicher Vorsicht und Zurückhaltung die Initiative ergriffen.
Als Kohl am 19. Dezember 1989 auf der »holprigen Betonpiste« des Flughafens Dresden-Klotzsche gelandet war, sei ihm, so seine »Erinnerungen«, »schlagartig« bewusst geworden: »Dieses Regime ist am Ende. Die Einheit kommt!« Und als er den wartenden Modrow mit »versteinerter Miene« sah, drehte Kohl sich auf der Gangway zu Kanzleramtsminister Rudolf Seiters um und bemerkte: »Die Sache ist gelaufen.« 40
Doch entscheidender als dieses Flughafenerlebnis war ein anderes Ereignis an diesem Tag. Kohl hielt am Abend eine improvisierte Rede vor der Ruine der Dresdner Frauenkirche. Er selbst gab später an, dass er mit seiner Rede die Emotionen nicht habe anheizen wollen. Doch die Menge feierte ihn begeistert mit »Deutschland, Deutschland« und »Helmut, Helmut«-Rufen. Und Kohl bekannte: »Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation.« Bei einem abschließenden Umtrunk im Kreis der Delegation resümierte Kohl den vergangenen Tag: »Ich glaube, wir schaffen die Einheit. Das läuft. Ich glaube, das ist nicht mehr aufzuhalten, die Menschen wollen das. Das Regime ist definitiv am Ende.« 41
Читать дальше