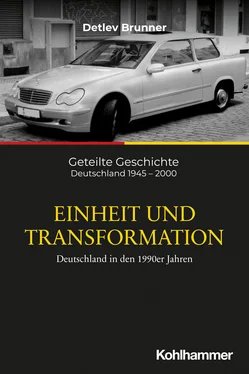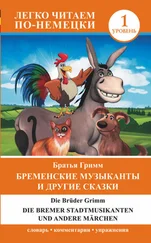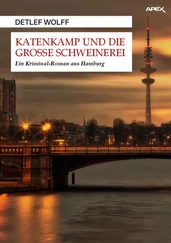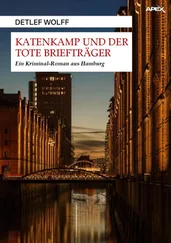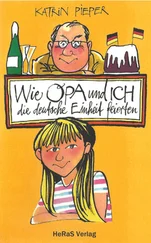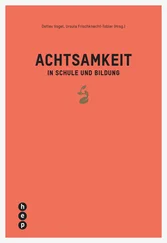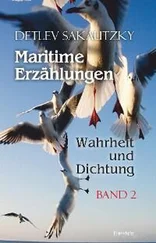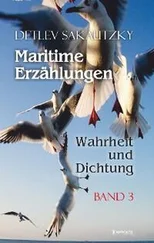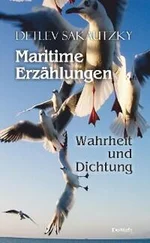Die chinesischen Ereignisse wurden international mit Bestürzung aufgenommen. Mit Verstörung wurde in der Bundesrepublik registriert, dass die SED-Führung das Vorgehen der chinesischen Führung unterstützte. Am 5. Juni 1989 feierte das »Neue Deutschland« die Niederschlagung der chinesischen Demokratiebewegung mit der Schlagzeile: »Volksbefreiungsarmee Chinas schlug konterrevolutionären Aufruhr nieder.« 10Egon Krenz, Mitglied des Politbüros, wies bei einem Besuch einer DDR-Delegation in Saarbrücken am 7. und 8. Juni 1989 kritische Äußerungen des saarländischen Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine (SPD) über die Pekinger Vorgänge als Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Volksrepublik zurück. Krenz äußerte Verständnis für das chinesische Vorgehen und kommentierte die Niederschlagung mit den Worten, es sei »etwas getan worden, um die Ordnung wiederherzustellen«. 11Von Walter Momper am 19. Juni 1989 auf die Pekinger Ereignisse angesprochen, reagierte Honecker mit der Bemerkung, er halte sich nicht an die westlichen Horrormeldungen, sondern an die offiziellen Mitteilungen der chinesischen Bruderpartei – damit war der Fall für ihn erledigt 12.
Was die Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 anging, so konstatierte Honecker schlicht, die Wahlkommissionen seien öffentlich besetzt gewesen, Manipulationen deshalb ausgeschlossen. Wenn Kritiker anderes behaupteten, habe dies keine Grundlage und keine Bedeutung 13. Die Kommunalwahlen wurden, wie üblich, offiziell mit einer Wahlbeteiligung von 98,77 Prozent und einer Zustimmung von 98,85 Prozent zur Liste der »Nationalen Front« – eines Zusammenschlusses aller Parteien und »Massenorganisationen« der DDR unter Vormachtstellung der SED – abgeschlossen. Und ebenfalls wie üblich wurde dieses Wahlergebnis als ein »klares Votum des Volkes für starken Sozialismus und sicheren Frieden« gefeiert, so Egon Krenz als Vorsitzender der Wahlkommission am Abend des Wahltages. Es war in der DDR ein offenes Geheimnis, dass derartige Wahlen eine Farce waren und dass sie zudem manipuliert wurden, obwohl es sich um Einheitslistenwahlen handelte, in denen die Verteilung der Mandate der jeweiligen Parteien und Massenorganisationen festgelegt waren unter Gewährleistung der »führenden Rolle« der SED. Immerhin, man konnte entweder nicht zur Wahl gehen, konnte theoretisch Kandidaten von der Liste streichen oder die gesamte Liste ablehnen. Im Prinzip war auch das Wahlgeheimnis gewährleistet, d. h. man durfte die Wahlkabine aufsuchen und dort seinen Wahlzettel ausfüllen. Wer allerdings diese prinzipiellen Rechte für sich in Anspruch nahm, kam schon in Verdacht. Das sogenannte »Zettelfalten«, also das offene Abstimmen und Einwerfen des Wahlzettels in die Urne, war deshalb die Regel. Es wurden dennoch zusätzliche Maßnahmen getroffen, um das erwünschte Ergebnis sicherzustellen. Bereits im Vorfeld wurden Personen von den Wählerlisten gestrichen, deren Ablehnung der Kandidatenlisten vermutet wurde – Ausreiseantragsteller, bekannte Oppositionelle und Nichtwähler. 14
Trotz aller Vorbereitung verliefen die Wahlen 1989 anders als gewohnt. Oppositionelle Gruppen in Ost-Berlin, Leipzig, Dresden und anderen Städten der DDR stellten Überlegungen an, wie man sich angesichts dieser Wahlen verhalten solle. In anderen Ländern des Ostblocks waren zu diesem Zeitpunkt bereits erste Demokratisierungsansätze festzustellen; in der Sowjetunion hatte 1988 eine Wahldebatte eingesetzt, eine Verfassungsänderung legte fest, dass bei den Wahlen im Mai/Juni 1989 mehrere Kandidaten zur Auswahl stehen sollten. In Polen und in Ungarn kam es ebenfalls zur Demokratisierung der Wahlen. Nur die SED-Führung hielt von derlei Veränderungen nichts. In den genannten oppositionellen Kreisen kristallisierte sich die Idee heraus, die öffentliche Stimmauszählung systematisch zu beobachten und dann mit den offiziell bekanntgegebenen Ergebnissen zu vergleichen. Die gesetzliche Grundlage in der DDR bot die Möglichkeit dazu. In der Wahlordnung von 1974 hieß es im § 40: »Die Auszählung der Stimmen ist öffentlich und wird vom Wahlvorstand durchgeführt.« 15Diese Bestimmung nutzten nun oppositionelle Kreise, um das übliche Wahlschauspiel zu demaskieren. In vielen Wahllokalen fanden sich kritische Bürgerinnen und Bürger bei der Stimmenauszählung ein. Das Beispiel Dresden legte die Wahlfälschung offen. Dort waren in den kontrollierten Wahllokalen bei 104.727 Wahlberechtigten 12.379 Gegenstimmen gezählt worden. Das offizielle Ergebnis wies jedoch bei 389.569 abgegebenen Stimmen nur 9.751 Gegenstimmen auf. Insgesamt stellten die unabhängigen Stimmenauszähler einen Anteil der Gegenstimmen in den Größenordnungen zwischen drei und 30 Prozent fest, die Wahlbeteiligung betrug meist zwischen 60 und 80 Prozent. 16DDR-weit ist von einem Anteil der Gegenstimmen in Höhe von 10 Prozent auszugehen. 17Die genaue Zahl lässt sich nicht rekonstruieren, da die Wahlunterlagen wenige Tage nach dem 7. Mai 1989 vernichtet wurden.
Der Betrug war offenkundig und die Impertinenz der SED-Führung, die die Fälschung wie eh und je als Vertrauensbeweis propagierte, regte zum Widerspruch und zum wachsenden Widerstand an. Eingaben, offene Briefe und Strafanzeigen gegen unbekannt waren die Folge. Der DDR-Generalstaatsanwalt verfügte am 19. Mai 1989, dass auf derartige Anzeigen nicht reagiert werden solle. Der Protest wurde auch auf die Straße getragen. Fortan fanden jeweils am 7. des Monats Demonstrationen statt, die die Wahlfälschung anprangerten.
Die Proteste gegen die Wahlfälschung waren eine wichtige Quelle für die Demokratiebewegung in der DDR, die sich vor allem nach dem Sommer 1989 formierte. Doch bevor die Demonstrationen in vielen Städten zu Massendemonstrationen anschwollen, geriet die DDR durch eine andere Entwicklung unter enormen Druck: durch die Ausreisebewegung.
Bereits in den 1980er Jahren war die Zahl jener erheblich angestiegen, die der DDR den Rücken kehren wollten und einen Antrag auf ständige Ausreise gestellt hatten, die sogenannten »Ausreiser«. 1989 erhielt diese Ausreisebewegung eine Dynamik von bislang nicht gekanntem Ausmaß. Zum Sommer 1989 lagen insgesamt 160.000 Ausreiseanträge vor. Und die Zahl derer, die nicht auf eine Genehmigung warten wollten, stieg gewaltig.
DDR-Bürgerinnen und -Bürger besetzten bundesdeutsche Botschaften in Warschau, Prag, Budapest und die Ständige Vertretung in Ost-Berlin, um aus der DDR ausreisen zu können. Die spektakulärste Besetzung war die in Prag, wo ab Februar/März 1989 erste Zufluchtssuchende aus der DDR eintrafen. Bis zu dem denkwürdigen Abend am 30. September 1989, als Außenminister Hans-Dietrich Genscher die Möglichkeit der Ausreise in die Bundesrepublik verkündete, hatten sich zeitweise mehrere Tausend Menschen gleichzeitig auf dem Botschaftsgelände unter katastrophalen Bedingungen aufgehalten. In der Nacht zum 1. Oktober 1989 wurden in einer ersten Ausreisewelle etwa 6.000 Flüchtlinge aus Prag und 800 aus Warschau mit Sonderzügen in die Bundesrepublik gefahren, die Fahrt führte über DDR-Territorium. Offiziell sollte der Schein aufrechterhalten werden, dass sie aus der DDR ausgewiesen worden seien.
Schon im Frühjahr des Jahres hatte der »Eiserne Vorhang« Löcher bekommen. Am 2. Mai 1989 kündigte Ungarn die Demontage der Grenze zu Österreich an. Am 27. Juni des Jahres zerschnitten der ungarische Außenminister Gyula Horn und sein österreichischer Kollege Alois Mock symbolisch den Stacheldrahtzaun nahe dem Ort Sopron. Zu einer spektakulären Massenflucht kam es am 19. August 1989 anlässlich des sogenannten »paneuropäischen Frühstücks«, das unter der Schirmherrschaft des deutschen Europa-Abgeordneten Otto von Habsburg, des ehemaligen letzten Kronprinzen der 1918 untergegangenen Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, und des ungarischen Staatspräsidenten Imre Pozsgay in Grenznähe bei Sopron stattfand. Mehrere Hundert DDR-Bürgerinnen und -Bürger nutzten die Gunst der Stunde und flohen nach Österreich, die ungarischen Grenztruppen verhielten sich passiv.
Читать дальше