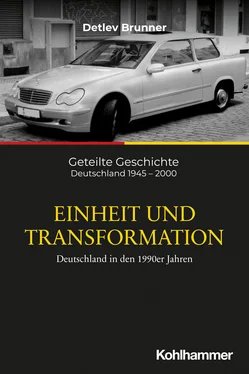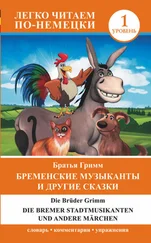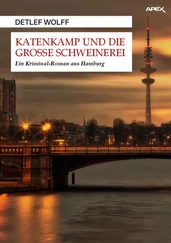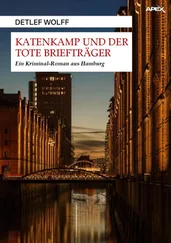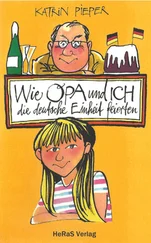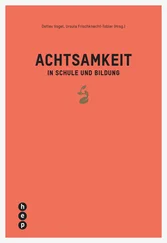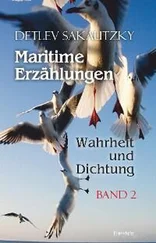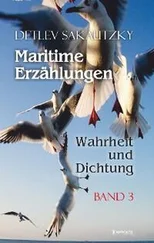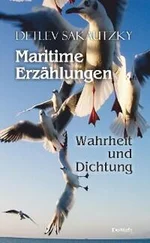Am 14. Juli 1989 besuchten Mitglieder der Partei- und Staatsführung der DDR das Museum für Deutsche Geschichte in Ost-Berlin. Es war der 200. Jahrestag des Sturms auf die Pariser Bastille am 14. Juli 1789, das Symbolereignis der Französischen Revolution. Das Museum zeigte seit Mai 1989 die Ausstellung »Freiheit. Gleichheit. Brüderlichkeit. 200 Jahre Französische Revolution«; die DDR-Post hatte eine Briefmarkenserie zu Ehren der Revolution aufgelegt und der Generalsekretär der SED und Vorsitzende des Staatsrates der DDR, Erich Honecker, telegrafierte zum Jubiläumstag an den französischen Staatspräsidenten François Mitterrand: »Vor zwei Jahrhunderten wurde in Paris das Tor in eine neue Zeit aufgestoßen.« Die humanistischen Ideen von »Freiheit. Gleichheit. Brüderlichkeit« hätten die Völker seither in ihrem Streben nach »Menschenwürde, sozialer Gerechtigkeit und gesellschaftlichem Fortschritt beflügelt«. Das Jubiläum werde deshalb auch in der DDR »gebührend gewürdigt«. 1
1.1 »… eine gewisse Stabilität«
Die Erwartung, dass auch in der DDR das Tor in eine »neue Zeit« aufgestoßen werden könnte, spielte in diesen Bekundungen selbstredend keine Rolle. Aber auch gut informierte Beobachter aus dem Westen sahen keine revolutionären Entwicklungen in der DDR heraufziehen. Der Anfang Januar 1989 aus dem Amt scheidende Ständige Vertreter der Bundesrepublik bei der DDR, Hans Otto Bräutigam, schätzte in einem Interview am 2. Januar 1989, die DDR habe »eine gewisse Stabilität« erreicht, ein Zustand, den sie werde halten können. Auch nach einem Führungs- und Generationswechsel werde sich in der DDR keine ganz neue Politik einstellen, die DDR sei kein Land für »dramatische Änderungen und Wechsel«. 2
Aus der Rückschau betrachtet war das eine Fehleinschätzung, aber zeitgenössisch vertrat Bräutigam keine Einzelmeinung. Die Stabilität der DDR war angesichts der unkalkulierbaren Umbruchphase im Ostblock ein wichtiger Faktor – noch waren die späteren umwälzenden Ereignisse des Jahres 1989 nicht in Sichtweite.
Am 19. Januar 1989 hielt Erich Honecker eine Rede, in der er auf aktuelle Fragen einging. Eine Rolle spielte die Frage der Menschenrechte in der DDR. Honecker verwies auf die eben zu Ende gehende KSZE-Nachfolgekonferenz in Wien. Das dort auch von der DDR unterzeichnete Abschlussdokument beinhaltete unter anderem, »dass es jedermann freisteht, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen und in sein Land zurückzukehren« 3. Honecker verknüpfte seine Behauptung, in der DDR würden alle Menschenrechte gewährleistet, mit dem Vorwurf an die Adresse der Bundesrepublik und die USA, sie trügen letztlich die Verantwortung für die fehlende Reisefreiheit für DDR-Bürgerinnen und -Bürger. Denn sie seien für die Gründe verantwortlich, die zum Bau der Mauer geführt hätten, und, so Honecker weiter: Die Mauer werde so lange bleiben, »wie die Bedingungen nicht geändert werden, die zu ihrer Errichtung geführt haben. Sie wird in 50, auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind.« 4
Kaum eineinhalb Jahre zuvor hatte Honecker im September 1987 bei seinem Besuch in seiner saarländischen Heimatstadt Neunkirchen noch ganz andere Töne angeschlagen. Er sprach davon, dass die Grenzen nicht so seien, wie sie sein sollten, und dass der Tag komme, an dem uns Grenzen »vereinen« – im Vergleich dazu waren die Äußerungen im Januar 1989 ein Rückfall. 5Sie standen auch im Kontrast zu Honeckers Bemerkungen beim Abschiedsbesuch Hans Otto Bräutigams am 19. Dezember 1988. In der Bundesrepublik, so Honecker, sei noch nicht genügend gewürdigt worden, »dass es einen Schießbefehl nicht mehr gibt«. 6Honecker hatte, so Bräutigams Erinnerung, großen Wert auf das Ziel einer anerkannten, friedlichen Grenze gelegt. Doch Bräutigam hegte Zweifel – zu Recht, wie sich kurze Zeit später herausstellte.
Das letzte erschossene Opfer an der Berliner Mauer war am 6. Februar 1989 zu beklagen. Es war der 20-jährige Chris Gueffroy, der beim Fluchtversuch im Kugelhagel der DDR-Grenzsoldaten starb. Sein Freund Christian Gaudian überlebte schwer verletzt. Dieser Fall sorgte für heftige Verstimmungen. Nicht nur die drei westalliierten Kommandanten Berlins protestierten empört und forderten ein Ende dieser »Verbrechen«. Besuche von Bundesministern in der DDR wurden abgesagt. Der Sprecher der Bundesregierung Friedhelm Ost sprach von »schweren Belastungen« der innerdeutschen Beziehungen. »Wer auf Menschen schießen lässt, beeinträchtigt in erheblichem Maße die Atmosphäre für eine friedliche Nachbarschaft und für die Entwicklung guter innerdeutscher Beziehungen auf allen Feldern.« 7
Fast schienen die deutsch-deutschen Beziehungen in vergangene Zeiten der Konfrontation zurückversetzt. Intern gab Honecker Egon Krenz, als Politbüromitglied und ZK-Sekretär zuständig für Sicherheitsfragen, die Anweisung, den Schießbefehl aufzuheben – einen Befehl, den es offiziell gar nicht gab, denn, so die immer wieder bemühte Version, die Grenztruppen der DDR befolgten Anweisungen, wie sie im Grenzverkehr international üblich seien. Honecker begründete seine Anweisungen an Krenz mit dem Argument, die internationalen Proteste müssten aufhören. Krenz rief daraufhin am 2. April 1989 den stellvertretenden Verteidigungsminister Generaloberst Horst Streletz an und gab Honeckers Anweisung weiter. In einer Gesprächsnotiz darüber heißt es: »Lieber einen Menschen abhauen lassen, als in der jetzigen politischen Situation die Schusswaffe anzuwenden.« 8
Angesichts der erneuten Mauerschüsse waren zwar Besuche von Bundesministern abgesagt worden, aber die deutsch-deutsche Gesprächsdiplomatie wurde deshalb nicht abgebrochen. Johannes Rau (SPD), Ministerpräsident des größten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, war nicht der einzige wichtige Landespolitiker, der – am 12. März 1989 – in die DDR reiste. Vor ihm hatten bereits Lothar Späth (CDU), Ministerpräsident von Baden-Württemberg sowie der Erste Bürgermeister aus Hamburg, Henning Voscherau (SPD), Honecker aufgesucht. Nach Rau folgten Ministerpräsident Ernst Albrecht (CDU) aus Niedersachen und als letzter der Länderchefs der Regierende Bürgermeister von Berlin, Walter Momper (SPD), am 19. Juni 1989. 9
Alle westlichen Landespolitiker verwiesen auf die Vorfälle an der Mauer, waren allerdings daran interessiert, dass sich das Verhältnis zur DDR dadurch nicht verschlechtere. Stabilität war das Ziel dieser führenden westdeutschen Politiker unterschiedlicher Couleur. Und Honecker ging es selbstverständlich um gute Beziehungen zum deutschen Nachbarn; angesichts der schwierigen Lage der DDR waren gerade wirtschaftliche und finanzielle Beziehungen von elementarer Bedeutung.
1.2 Die chinesische Lösung
Als der Regierende Bürgermeister von Berlin Walter Momper am 19. Juni 1989 mit Erich Honecker im Schloss Niederschönhausen in Ost-Berlin zusammentraf, war es innerhalb und außerhalb der DDR zu Ereignissen gekommen, die der Partei- und Staatsführung erneut einiges an Erklärungen abverlangten. Dies betraf zum einen die Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 und zum anderen das Verhalten der SED-Führung angesichts der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung in China, die im Massaker auf dem Tiananmen-Platz in Peking am 4. Juni 1989 gipfelte.
Im April 1989 hatte sich in China eine Studentenbewegung formiert, die sich zu einer breiten Oppositionsbewegung ausweitete und etwa 1 Million Menschen am 17. Mai 1989 in Peking auf die Straße brachte. In diesem Zeitraum fand auch das erste sowjetisch-chinesische Gipfeltreffen seit 1959 statt. Die zahlreichen Pressevertreter aus aller Welt konnten zugleich vom Auftreten der chinesischen Demokratiebewegung berichten. Nach der Abreise des sowjetischen Parteichefs Michail Gorbatschow am 18. Mai 1989 verhängte die chinesische Regierung den Ausnahmezustand, Hunderttausende ignorierten das jedoch und hinderten Armeeeinheiten am Vordringen ins Pekinger Zentrum. In der Nacht vom 3. auf den 4. Juni 1989 ging die chinesische »Volksbefreiungsarmee« gegen die Demonstrierenden vor. Auf dem »Platz des Himmlischen Friedens« walzten Panzer dort in Zelten kampierende Studierende nieder – 100 Menschen kamen ums Leben, auch an anderen Orten waren Tote zu beklagen, auf etwa 3.000 wird ihre Zahl geschätzt.
Читать дальше