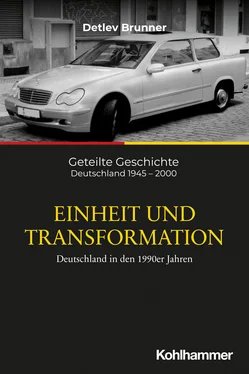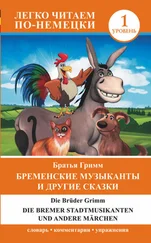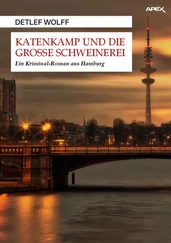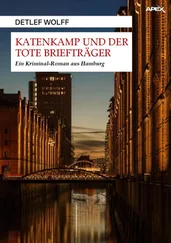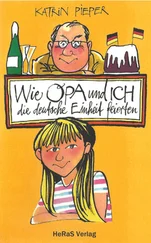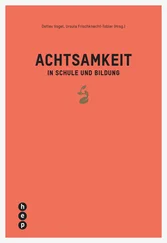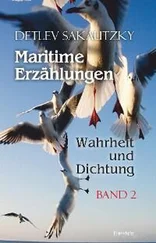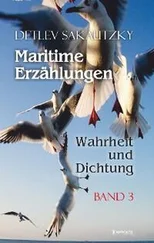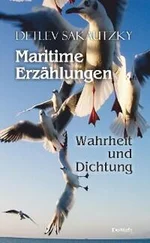»Revolutionstheoretisch war in Leipzig etwas Neues entstanden: das Modell einer friedlichen, aber nicht gewaltfreien Revolution. […] Die friedliche Revolution in der DDR fand ihren Höhepunkt am 9. Oktober 1989 in Leipzig. An diesem Tag wurde hier Weltgeschichte geschrieben.« 26
In den folgenden Tagen und Wochen überstürzten sich die Ereignisse. Am 17. Oktober 1989 stimmte das Politbüro einstimmig für die Ablösung Erich Honeckers als Generalsekretär. Der 77-jährige Honecker trat am 18. Oktober 1989 »aus gesundheitlichen Gründen« zurück – mit ihm der langjährig für die Wirtschaftspolitik zuständige Günter Mittag und Joachim Herrmann, verantwortlich für Agitation – damit war das »Machtzentrum Honecker« zerschlagen.
Am 30. Oktober 1989 lag dem SED-Politbüro, nun mit dem eine Generation jüngeren Egon Krenz an der Spitze, eine Analyse der ökonomischen Lage der DDR mit Schlussfolgerungen vor. Erarbeitet war diese Bestandsaufnahme von einer Gruppe von Wirtschaftsexperten der DDR, allen voran Gerhard Schürer, dem Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission, außerdem waren beteiligt Gerhard Beil, Außenhandelsminister, Alexander Schalck-Golodkowski, Leiter des »geheimen« Bereichs für »Kommerzielle Koordinierung« im DDR-Außenministerium, Ernst Höfner, Finanzminister der DDR und Arno Donda, Leiter der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik. Die Erstellung einer derartigen Analyse war am 24. Oktober 1989 vom Politbüro beschlossen worden. Das Ergebnis war eine Mischung aus einer schonungslosen Offenlegung der Probleme und dem verzweifelten Versuch, das Überleben einer »sozialistischen DDR« durch politische Angebote an die Bundesrepublik zu erreichen, um die erforderlichen Kredite in Milliardenhöhe von dort zu erhalten. Einige Schlüsselsätze:
»Im Zeitraum seit dem VIII. Parteitag [d. h. seit 1971] wuchs insgesamt der Verbrauch schneller als die eigenen Leistungen. Es wurde mehr verbraucht als aus eigener Produktion erwirtschaftet wurde zu Lasten der Verschuldung im NSW [=nicht sozialistisches Wirtschaftsgebiet], die sich von 2 Mrd. VM 271970 auf 49 Mrd. VM 1989 erhöht hat. Das bedeutet, daß die Sozialpolitik seit dem VIII. Parteitag nicht in vollem Umfang auf eigenen Leistungen beruht, sondern zu einer wachsenden Verschuldung im NSW führte.« 28
Das, was als besonderer Vorzug des DDR-Sozialismus hervorgehoben wurde, die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik, und die unter dieser Parole gewährten Leistungen beruhten demnach zu einem rapide wachsenden Teil auf Schulden, die in kapitalistischen Ländern gemacht wurden. Allein dies kam einer Bankrotterklärung gleich, vor allem wenn man sich die bis zuletzt von Honecker betonten Vorzüge der DDR vor kapitalistischen Systemen vor Augen hält. Die Autoren forderten die Durchsetzung des Leistungsprinzips. Alle Elemente der Subventions- und Preispolitik, die diesem Prinzip widersprächen und zur Verschwendung oder Spekulation führten, seien zu beseitigen. Ziel war die Entwicklung einer »an den Marktbedingungen orientierten sozialistischen Planwirtschaft«. Um der Bundesrepublik den »ernsthaften Willen der DDR« zu Veränderungen glaubhaft zu machen, sollte erklärt werden, »daß durch diese und weitergehende Maßnahmen der ökonomischen und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit DDR-BRD noch in diesem Jahrhundert« – also binnen zehn Jahren – »solche Bedingungen geschaffen werden könnten, (um) die heutige existierende Form der Grenze zwischen beiden deutschen Staaten überflüssig zu machen.« Das war das letzte Pfund, das die DDR-Wirtschaftsfunktionäre meinten noch einsetzen zu können – die Öffnung der innerdeutschen Grenze als Perspektive und Gegenleistung für die Gewährleistung des staatlichen Überlebens. 29
Am 4. November 1989 kam es zu einem weiteren Höhepunkt der demokratischen Revolution der DDR. Mehrere hunderttausend Menschen versammelten sich auf dem Berliner Alexanderplatz, eine Kundgebung, auf der Künstler, Vertreter der Bürgerbewegung, aber auch mancher Repräsentant des alten Regimes sprach, darunter Markus Wolf, der ehemalige Chef der Auslandsspionage des MfS, und Günter Schabowski, Mitglied des Politbüros und Berliner Bezirkschef der SED – beide wurden ausgepfiffen. Diese Kundgebung nimmt einen zwiespältigen Platz in der Geschichte der Friedlichen Revolution ein. Die Demonstration war nach ersten Überlegungen im »Neuen Forum« von Kulturschaffenden aus den Theatern Ost-Berlins initiiert worden. Allerdings versuchten die SED-Bezirksleitung Berlin und das MfS im Vorfeld im Verein mit der Gewerkschaft Kunst Einfluss zu nehmen bis hin zur Frage, welche Rednerinnen und Redner auftreten sollten. So wurde ein Auftritt des 1976 ausgebürgerten Wolf Biermann abgelehnt. Bärbel Bohley, eine der Galionsfiguren der Bürgerbewegung, die Biermann eingeladen hatte, stieß ebenfalls auf Ablehnung. Auch die Initiative für Unabhängige Gewerkschaften durfte ihren Aufruf zur Gründung unabhängiger Gewerkschaften nicht verlesen; dies tat dann Heiner Müller, der international bekannte Dramatiker und Regisseur, der wenige Monate später der letzte Präsident der DDR-Akademie der Künste werden sollte. In der Öffentlichkeit vermittelte diese Massenkundgebung trotz aller Ambivalenzen dennoch ein Signal des Aufbruchs – viele namhafte Künstler und Schriftsteller der DDR forderten Reformen, Demokratie und Öffnung. Die Versuche der Staatsmacht, die Massenkundgebung für ihre Zwecke zu instrumentalisieren, konnten die Demokratiebewegung nicht aufhalten. 30
Am 6. November wurde der Entwurf eines neuen Reisegesetzes veröffentlicht, der es DDR-Bürgern zugestand, bis zu 30 Tage im Jahr ins Ausland zu reisen, nach Antrag und Genehmigung. Was vor einem Jahr noch als großer Wurf angesehen worden wäre, war nun längst überholt – Reisefreiheit war die Devise, keine bürokratischen Prozeduren – und so verwarf selbst der zuständige Volkskammerausschuss den Entwurf als unzureichend. Am 7. November 1989 trat der Ministerrat unter Führung von Willi Stoph zurück, am folgenden Tag das Politbüro der SED. Das ZK der SED wählte ein verkleinertes »reformiertes« Politbüro, Egon Krenz war weiterhin Generalsekretär, der als Reformer geltende SED-Bezirkschef Hans Modrow aus Dresden war im neuen Gremium vertreten. Am 13. November 1989 wurde Modrow in der Volkskammer zum Ministerpräsidenten der DDR gewählt, doch zuvor überschlugen sich wieder einmal die Ereignisse.
Am Nachmittag des 9. November 1989 informierte Egon Krenz das ZK der SED, dass die Regierung soeben eine Entscheidung über die neuen Reisebestimmungen getroffen habe. Gegen 18 Uhr übergab Krenz dem neuen ZK-Sekretär für Information, Günter Schabowski, ein zweiseitiges Papier, das die neuen Reisebestimmungen enthielt. Schabowski war auf dem Weg ins Internationale Pressezentrum am Berliner Alexanderplatz, um die dort versammelten Journalisten über die Ergebnisse der ZK-Tagung zu unterrichten. Krenz bemerkte bei der Übergabe des Papiers an Schabowski knapp: »Gib das bekannt, das wird ein Knüller für uns.« 31Krenz spekulierte darauf, dass die neuen Reisebestimmungen die äußerst angespannte Lage entkrampfen würde. Schabowski spulte eher routinemäßig das Programm ab, bis sich der italienische Journalist der Nachrichtenagentur ANSA, Riccardo Ehrman, zu Wort meldete; er wollte wissen, ob die mittlerweile schon verworfene, am 6. November 1989 vorgestellte Reiseregelung nicht ein »großer Fehler« gewesen sei. Schabowski antwortete zunächst ausweichend, viele Probleme seien zu bewältigen, aber, soviel er wisse, sei heute eine Entscheidung getroffen, eine Empfehlung des Politbüros sei aufgegriffen worden. »Und deshalb (äh) haben wir uns dazu entschlossen, heute (äh) eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht (äh), über Grenzübergangspunkte der DDR (äh) auszureisen.« Auf Nachfragen, wann dies in Kraft trete, entgegnete Schabowski: »Das tritt nach meiner Kenntnis … ist das sofort, unverzüglich […].« 32Tausende von Berlinerinnen und Berlinern im Ostteil der Stadt interpretierten Schabowskis Äußerung als Öffnung der Grenze, auch wenn Schabowski dies so gar nicht verkündet hatte. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 sammelten sich Massen an den Berliner Grenzübergängen; die überraschten und überforderten DDR-Grenzpolizisten waren nicht in der Lage, sie aufzuhalten – die Mauer war offen, 28 Jahre der Teilung waren zu Ende.
Читать дальше