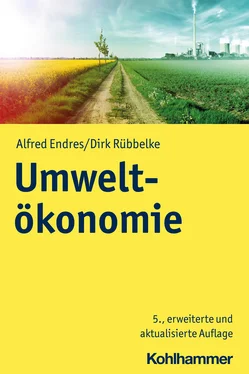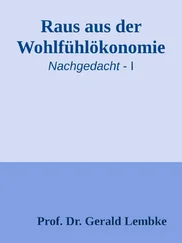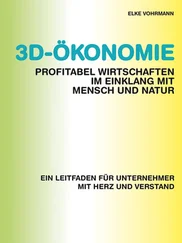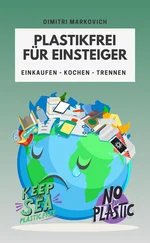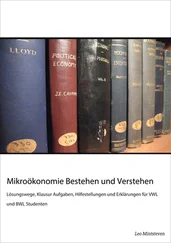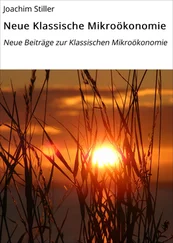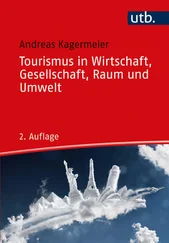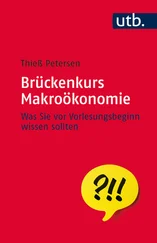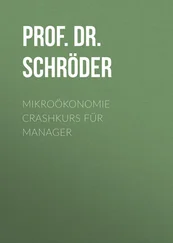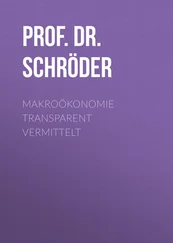48Zur Ökonomie intrinsischer Motivation und der Gefahr ihrer Verdrängung durch extrinsische Anreize, vgl. z. B. Chao (2017), Festré/Garrouste (2015), Goeschl/Perino (2012), Kits/Adamowicz/Boxall (2014), Rommel/Buttmann/Liebig/Schönwetter/Svart-Gröger (2015). Weitere Ausführungen hierzu finden sich im Vierten Teil dieses Buches, in dem die Verhaltensökonomik behandelt wird.
49Jetzt aber mal im Ernst: Interdependente Nutzenfunktionen sind in der traditionellen Wirtschaftstheorie zwar Sidestream, aber doch unübersehbar. Es gibt eine Fülle von Ansätzen, z. B. Becker (1974), Bergstrom (2006) und Mercier Ythier (2010). Zum Verzicht auf Engstirnigkeit bei der Interpretation der Figur des Homo Oeconomicus vgl. z. B. Kirchgässner (2008), Endres/Martiensen (2007), Teil I. Einen Blick auf die Herausforderungen in diesem Kontext aufseiten der Verhaltensökonomik werfen bspw. Kesternich/Reif/Rübbelke (2017).
50Quelle: Steinmann/Westfalenpost. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Urhebers.
51Allerdings ist die Wirtschaftstheorie ein so weites (und »biologisch« äußerst dynamisches) Feld, dass stets der Satz gilt: »Es gibt nichts, was es nicht gibt.« Zur ökonomischen Theorie endogener (also gerade nicht als gegeben vorausgesetzter) Präferenzen vgl. z. B. Chesterley (2016) und v. Weizsäcker (2002, 2014) zur Unterscheidung zwischen exogenen Präferenzen und endogenem Geschmack.
52Dass man dies auch völlig anders sehen kann (muss?!?), erhellt schlaglichtartig der Untertitel von Frey/Benz/Stutzer (2004): »Not only What, but also How Matters.« Vgl. auch Chlaß/Güth/Miettinen (2019) und Stutzer (2020).
53Vgl. Selten (1990). Nobelpreisträger Kahneman beschreibt seine (gemeinsamen) Forschungen (mit Amos Tversky) als die Suche nach einer Karte für begrenzte Rationalität. Siehe Kahneman (2003).
54Vgl. z. B. die einführende Darstellung bei Varian (2016).
55Diese Unterscheidung wird unten, insbesondere bei der Diskussion von Verhandlungen als Internalisierungsstrategie, noch eine wesentliche Rolle spielen.
56Ein Zuruf aus der (gar nicht allzu) fernen Wirtschaftspraxis: »Der Wert von Kunst ermisst sich letztlich an dem, was ein bestimmter Mensch bereit ist, dafür zu bezahlen« – so der New Yorker Kunstexperte und -händler Michael Findlay in Die Zeit, Nr. 16 vom 12.04.2012, S. 57.
57Die ökonomischen Prinzipien der Bewertung von Umweltgütern mit Hilfe des Zahlungsbereitschaftskonzepts und die zugehörigen Methoden der empirischen Sozialforschung werden in diesem Buch aus Platzgründen nicht näher erörtert. Ein Überblick findet sich z. B. in der in Fußnote 37, oben, angegebenen Literatur.
58Um die hier zu Grunde liegenden Konzepte des Utilitarismus und des normativen Individualismus hat es in der Literatur reichlich Streit gegeben. Ein Beispiel hierfür ist die Kritik von Binmore (2005), die aber ihrerseits auf Widerspruch gestoßen ist, siehe z. B. Gintis (2006).
59Für das Verständnis von mit technischem Fortschritt sinkenden Vermeidungskosten empfiehlt es sich, von der vereinfachenden Vorstellung abzugehen, die Emissionen seien strikt proportional zum Output. Wir stellen uns stattdessen vor, die Emissionen könnten (zusätzlich zum Mittel der Outputreduktion) durch Maßnahmen des technischen Umweltschutzes gesenkt werden. Diese können additiv (z. B. Filterinstallation (dann aber auch: einschalten!)) oder integriert (z. B. Erhöhung des Verbrennungsgrades) ausgerichtet sein.
60Die obige Darstellung sei durch den Hinweis entdramatisiert, dass auch aus ökonomischer Sicht nicht jede Änderung des Optimums automatisch eine Anpassung der nach Internalisierung strebenden Umweltpolitik nötig macht. Hier müssen den Nutzen des Politikwechsels die Politikkosten (im weitesten Sinne) gegenübergestellt werden. Es wäre interessant zu untersuchen, inwieweit sich die Kosten des Politikwechsels bei verschiedenen Internalisierungsstrategien unterscheiden.
61Die Zusammenhänge zwischen Verteilung und Lage des Allokationsoptimums werden im Zweiten Teil, Kapitel A.II.1 ausführlich erläutert.
62Auf diesen Zusammenhang gehen wir unten in Abschnitt C.II., des Dritten Teils ausführlicher (und in Kapitel E. des Vierten Teils noch ausführlicher) ein.
63Näheres zum Konzept der Schattenpreise und seiner Bedeutung für die Nutzen-Kosten-Analyse im Umweltschutz z. B. bei Young (2005), Molinos-Senante/Hanley/Hernández-Sancho/Sala-Garrido (2015).
64Mit »Kritikfähigkeit« ist hier (anders als dies häufig in der umweltpolitischen Diskussion verstanden wird) nicht nur die Fähigkeit zur Kritik an »der Industrie« gemeint. Vielmehr geht es um die Fähigkeit zu erkennen, inwieweit in der Öffentlichkeit vorgetragene Argumente von Interessen geleitet sind. Dazu gehört das Interesse des Industrievertreters an der Verharmlosung der externen Kosten seiner Produktion ebenso wie das Interesse der Journalistin/des Journalisten (der Wissenschaftlerin/des Wissenschaftlers!) an Aufsehen erregender Berichterstattung oder das Interesse der Politikerin/des Politikers an der eigenen Profilierung.
65Vgl. z. B. Atkinson/Mourato (2015), Feess/Seeliger (2021), Hansjürgens/Lienhoop (2015), Johansson/Kriström (2018) und Markandya (2016).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.