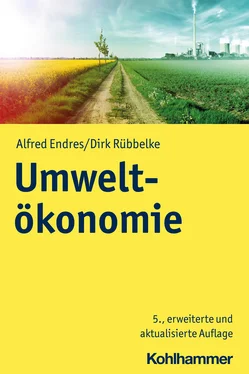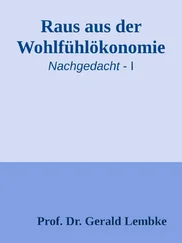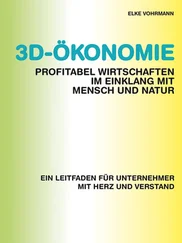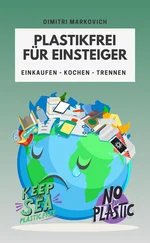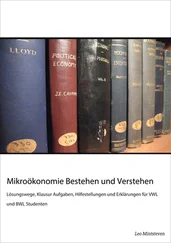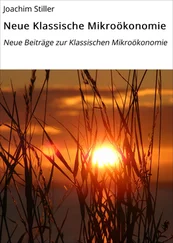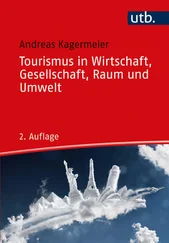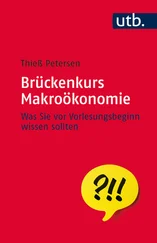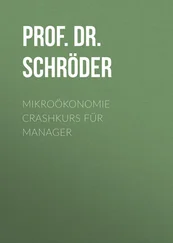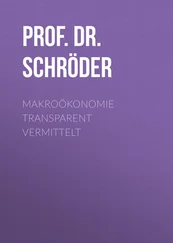Dirk Rübbelke - Umweltökonomie
Здесь есть возможность читать онлайн «Dirk Rübbelke - Umweltökonomie» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Umweltökonomie
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Umweltökonomie: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Umweltökonomie»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Umweltökonomie — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Umweltökonomie», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Das Pareto-Kriterium hat gegenüber dem oben kurz erklärten Konzept der Maximierung der sozialen Wohlfahrt als Summe individueller Nutzen den großen Vorteil, dass es ohne ein kardinales Nutzenkonzept auskommt. Für die Anwendung des Pareto-Kriteriums müssen wir weder voraussetzen, der Nutzen eines einzelnen Individuums könne quantitativ bestimmt werden noch davon ausgehen, ein Nutzenvergleich zwischen verschiedenen Individuen sei möglich. Da kann an der ordinalen Nutzentheorie geschulten Wohlfahrtsökonomen schon ein Stein vom Herzen fallen. 30 Der Vorteil des Pareto-Kriteriums mit schwächeren Annahmen auszukommen, hat jedoch seinen Preis: 31
Anders als die Idee der Maximierung der aggregierten Nettonutzen der Gesellschaft leidet das Pareto-Kriterium darunter, dass es unendlich viele Zustände gibt, bei denen das Kriterium überhaupt nicht in der Lage ist, eine Ordnung nach deren sozialer Erwünschtheit aufzustellen. Es ist per definitionem nach dem Pareto-Kriterium nicht zu sagen, ob ein Zustand C oder ein Zustand D sozial vorgezogen wird, wenn in C ein Mitglied der Gesellschaft besser steht als in D, ein anderes aber schlechter. Außerdem gibt es unendlich viele Pareto-Optima. Es ist noch nicht einmal so, dass ein beliebig herausgegriffener pareto-optimaler Zustand nach dem Pareto-Kriterium stets einem beliebig herausgegriffenen nicht pareto-optimalen Zustand sozial überlegen ist.
Mit Blick auf das umweltökonomische Anliegen dieses Buches können wir diese wohlfahrtsökonomischen Aussagen hier nicht ausführlicher erläutern. Sie können sie bei Bedarf jedoch leicht nachvollziehen, wenn Sie in einem mikroökonomischen Lehrbuch den Text zur Edgeworth-Box aufsuchen. 32 Pareto-optimale Zustände finden Sie in Hülle und Fülle auf der »Kontraktkurve«, die in dieser Box illustriert ist. Nicht pareto-optimale Zustände gibt es diesseits und jenseits dieser Kurve – und zwar ohne Ende.
IV. Abweichungen zwischen Gleichgewicht und Optimum durch externe Effekte: Das Problem des »Marktversagens«
Natürlich stellt das oben kurz skizzierte ökonomische Modell eine radikale Vereinfachung der in der Realität herrschenden Verhältnisse dar. Berücksichtigt man seine außerordentliche Schlichtheit, so muss es zwar wohl erstaunen, dass es doch mit diesem Modell in Ansätzen gelingt, wichtige Triebkräfte des wirtschaftlichen Handelns bzw. die Natur wirtschaftlicher Institutionen (z. B. Gewinn-, Nutzenstreben, Konkurrenz, Durchsetzung von Präferenz und Kaufkraft auf dem Markt usw.) in Ansätzen darzustellen. Andererseits kann jedoch kein Zweifel darüber bestehen, dass es für eine unmittelbare wirtschafts- bzw. umweltpolitische Anwendung viel zu grob strukturiert ist.
So ist es z. B. offensichtlich, dass in der Realität auch einzelne Anbieter bisweilen erheblichen Einfluss auf den Preis des von ihnen hergestellten Produktes haben. Dies ist für die Optimalität des Marktgleichgewichts sehr folgenschwer. Im Extremfall des Monopols realisiert der Anbieter ein Gleichgewicht, bei dem die Grenzkosten unter dem Marktpreis liegen. Im Gleichgewicht sind daher marginale Zahlungsbereitschaft und Grenzkosten nicht aneinander angeglichen, d. h. die sozial optimale Produktionsmenge wird verfehlt. In ähnlicher Weise wird die Optimalität des Marktgleichgewichts durch staatliche Interventionen, z. B. Zölle oder Produktsteuern, gestört, die einen Keil zwischen den von den Konsumenten gezahlten und den von den Produzenten empfangenen Preis treiben. Auch hier wird ein Ausgleich der marginalen Zahlungsbereitschaften mit den Grenzkosten nicht erreicht. Eine Fehlallokation ist die Folge. Ein weiterer im wirklichen Leben (und in etwas komplexeren ökonomischen Modellen) wichtiger Aspekt, der oben ausgeblendet wurde, liegt darin, dass die Akteure nicht über ausreichende Informationen verfügen, um sich in der oben erklärten Weise zu verhalten. Insbesondere kann die Information (z. B. hinsichtlich der Qualität eines Produktes) zwischen Anbieter und Nachfrager asymmetrisch verteilt sein. Ist der Nachfrager nicht in der Lage, alle relevanten Produkteigenschaften vor dem Kauf zu beobachten, können sich Fehlallokationen ergeben. Die einschlägige ökonomische Theorie geht zurück auf die 1970 erschienene Arbeit über The Market for »Lemons«: Quality Uncertainty and the Market Mechanism von G. Akerlof. 33 Der Autor wurde im Jahre 2001 für seine bahnbrechenden Arbeiten zur Informationsökonomik mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft ausgezeichnet. Im Kontext unserer mit der Theorie externer Effekte befassten Erörterung verzichten wir auf eine ausführliche Darstellung und begnügen uns mit der folgenden Kurzfassung.

Seitenblick 2: 34 Ökonomische Theorie der asymmetrischen Information – Kurzfassung
Keine Frage: Die Liste der in der Realität vorzufindenden Unterschiede zu dem oben skizzierten idealtypischen Modell ist lang. Sie ist Teil der Folklore mikroökonomischer Lehrbücher. Allerdings ist nicht in jedem Erörterungszusammenhang jeder Eintrag in dieser Liste von Interesse. Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass die ökonomische Modellbildung gerade nicht das Ziel verfolgt, die Realität wie ein Foto abzubilden. Wir wollen uns daher im Folgenden auf die für die Analyse von Umweltproblemen relevanteste Abweichung zwischen Realität und Modell konzentrieren: 35 In der obigen idealtypischen Darstellung war (implizit) unterstellt, dass von der Produktion des Gutes x lediglich die Produzenten und die Nachfrager (ferner auch die marktlichen Anbieter der zur Produktion erforderlichen Produktionsfaktoren) betroffen sind.
Jegliche Nutzen- oder Kostenwirkung, die mit dem Gut x einhergeht, ist in diesem Modell über Märkte vermittelt: Die Nutzen aus dem Konsum des Gutes x fallen ausschließlich bei den Konsumenten an, die für den Kauf dieses Gutes auf dem Markt für das Gut bezahlen. Die Kosten für die Produktion fallen ausschließlich bei den produzierenden Firmen an, die für ihren Aufwand über den Markterlös kompensiert werden. Sie setzen zur Produktion lediglich Produktionsfaktoren ein, die auf Faktormärkten gekauft werden. In dem oben kurz skizzierten Modell für das Gut x existieren keine Beziehungen, die nicht Marktbeziehungen sind. Dieser Umstand muss angesichts der in der Realität herrschenden Verhältnisse als drastische Vereinfachung gelten. Wir bezeichnen in der Ökonomie über Märkte vermittelte Interdependenzen zwischen Individuen als »interne Effekte«.
Ein »externer Effekt« besteht dagegen darin, dass die Nutzensituation (bei Firmen: Gewinnsituation) eines Individuums unmittelbar, d. h. ohne Vermittlung durch den Marktmechanismus, von einer Aktivität abhängt, die von einem anderen Individuum kontrolliert wird. Legt man diese Definition zugrunde, so wird man unmittelbar feststellen, dass die Lebenswelt jedes Einzelnen ein dichtes Gestrüpp externer Effekte enthält. Nicht alle diese Effekte sind in unserem Zusammenhang relevant und es besteht keineswegs Konsens in der Gesellschaft darüber, um welche es sich dabei handelt. Ein konsensfähiges Beispiel für einen externen Effekt dürfte in der Staubemission einer Firma bestehen. 36
Aus einer monetären Bewertung der externen Effekte gehen die externen Kosten hervor. 37 Die insgesamt durch die Produktion verursachten Kosten, die »sozialen Kosten«, ergeben sich als Summe aus privaten und externen Kosten.
Zur Erläuterung der Auswirkungen eines externen Effekts auf die Optimalität eines Konkurrenzgleichgewichts kehren wir wieder zu unserem obigen Beispiel der Produktion des Gutes x zurück. Nehmen wir zur Vereinfachung an, es existiere ein dritter Haushalt 38 , m, der durch die Rußemission (wie auch immer definierte) Schäden erleidet. Es sei möglich, die Höhe der Schäden in Abhängigkeit von der Emissionsmenge in Geldeinheiten anzugeben. Die Auswirkung dieser Modellerweiterung auf die Optimalität des Marktgleichgewichts und damit auf den wirtschaftspolitischen Handlungsbedarf lässt sich durch eine Konfrontation der oben schon erörterten Interessen der Firmen i und j sowie der Haushalte k und l einerseits und des Haushalts m andererseits darstellen. Um die Darstellung nicht unnötig unübersichtlich werden zu lassen, fassen wir die oben besprochenen Interessen von i, j, k und l zusammen, indem wir die Angebotskurve und die Nachfragekurve für das Gut x aus Abbildung 1 saldieren. Die Nachfragekurve gibt, wie oben ausgeführt, den Bruttonutzen der Produktion des Gutes x an. Die Angebotskurve gibt, wie ebenfalls oben aufgeführt, die Kosten dieser Produktion an, soweit sie durch den Verbrauch vermarkteter Produktionsfaktoren entstehen. Daher repräsentiert die Differenz der beiden Kurven die marginalen Nettonutzen der Produktion bei ausschließlicher Berücksichtigung der über den Markt koordinierten Beteiligten (i, j, k, l). In Abbildung 1 sinkt die saldierte Kurve N - A im Punkt optimaler Produktion (x *) auf null ab, über dem die Angebotskurve die Nachfragekurve schneidet. Anstatt diese Kurve in konventioneller Weise von null ausgehend in Richtung zunehmender Produktionsmengen abzulesen, können wir sie auch umgekehrt, d. h. vonx *in Richtung 0 betrachten. Dann gibt uns die Kurve an, wie hoch der Nettonutzen ist, auf den die Gesellschaft, soweit sie am Markt für x repräsentiert ist, verzichtet, wenn die Produktion von x eingeschränkt wird. Diese Nutzenverzichte sind nichts anderes als die Opportunitätsgrenzkosten einer Verminderung des Produktionsniveaus. Unterstellen wir, dass der externe Effekt (hier die Rußemissionen der Produzenten) strikt proportional zur Produktionsmenge ist 39 , so können wir die saldierte Kurve als Grenzvermeidungskostenkurve der Rußemission bezeichnen. Die Grenzvermeidungskostenkurve, GVK, ist in der Abbildung 2 eingetragen. 40 Außerdem enthält die Abbildung die beim Haushalt m anfallenden Grenzschäden, GS, in Abhängigkeit vom Produktions-(Emissions-)Niveau. 41
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Umweltökonomie»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Umweltökonomie» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Umweltökonomie» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.