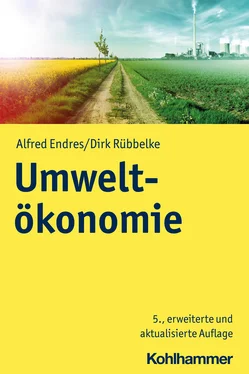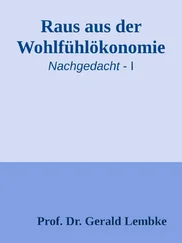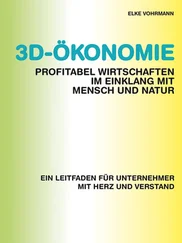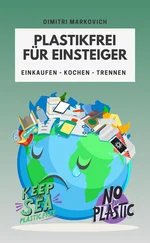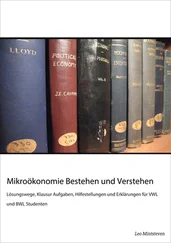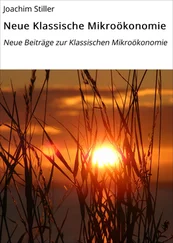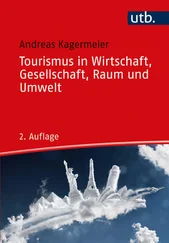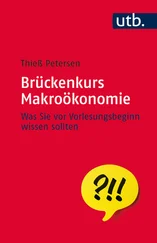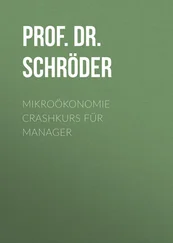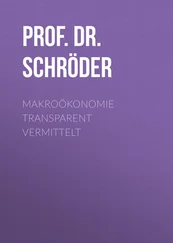Aus dieser Erörterung folgt eine wichtige Eigenschaft des in Abbildung 1 skizzierten Konkurrenzgleichgewichts: Im Konkurrenzgleichgewicht wird der Konflikt zwischen den beiden Nachfragern k und l um das Gut x durch die Institution des Marktes so ausgetragen, dass eine Aufteilung der insgesamt produzierten Menge x *auf die Interessenten herbeigeführt wird, bei der die marginalen Zahlungsbereitschaften der beiden Individuen gleich dem Marktpreis sind. Da der Marktpreis (im hier unterstellten Konkurrenzmodell) für alle Konsumenten gleich ist, sind die marginalen Zahlungsbereitschaften der verschiedenen Nachfrager im Gleichgewicht auch untereinander gleich.
Ähnlich wie oben für die Nachfrageseite recht ausführlich geschehen, lässt sich für die Angebotsseite argumentieren. Hier konkurrieren die beiden Firmen i und j um Produktionsfaktoren, die zur Produktion des Gutes x notwendig sind. 22 Jede Firma bekommt über den Markt die Menge an Produktionsfaktoren »zugewiesen«, die sie in die Lage versetzt, eine Endproduktmenge herzustellen, für die der Preis gleich den individuellen Grenzkosten ist. Da der Preis im Modell vollständiger Konkurrenz für alle Anbieter identisch ist, sind im Gleichgewicht auch die Grenzkosten der Anbieter einander gleich. Im Konkurrenzgleichgewicht ist also sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite die »Grenzausgleichsbedingung« 23 erfüllt.
III. Die »soziale Optimalität« des Marktgleichgewichts im idealtypischen ökonomischen Modell
Wir hatten oben darauf hingewiesen, dass sich die Mikroökonomie (und damit auch die Umweltökonomie als Kind der Mikroökonomie) nicht auf die Beschreibung, Erklärung und Prognose menschlichen Verhaltens beschränkt (»positive Analyse«), sondern auch den Versuch einer Wertung unternimmt (»normative Analyse«). 24 Dies ist allerdings nicht so zu verstehen, dass der analysierende Ökonom seine eigenen Präferenzen über die relative Wünschbarkeit von Gütern und sozialen Zuständen zum Maßstab seiner Beurteilung macht. In diesem Sinne muss die ökonomische Analyse wertfrei sein. Beim normativen Ansatz geht es vielmehr darum, Vorstellungen über die Determinanten sozialer Wohlfahrt und die Natur ihrer Verknüpfung, die in der Gesellschaft selbst eine wesentliche Rolle spielen, aufzunehmen und zu operationalisieren. Eine Conditio sine qua non besteht dabei darin, dass das verwendete soziale Wohlfahrtskriterium expliziert wird. So kann der Versuch unternommen werden, von der Gesellschaft hervorgebrachte Allokationen (und Institutionen) an den eigenen Wertvorstellungen der Gesellschaft zu messen und damit Abweichungen aufzudecken, die auf irrtümlich begangene Steuerungsfehler hinweisen oder Anhaltspunkte dafür zu geben, dass gesellschaftliche Handlungsträger tatsächlich andere Ziele verfolgen, als sie vorgeben.
Insgesamt betrachtet ist die Ausbildung einer normativen Komponente notwendig, wenn die Ökonomie auch ein Instrument der kritischen Analyse gesellschaftlicher Zustände und politischer Entscheidungen sein soll. Der normative Ansatz ist keine Spezialität der Wirtschaftswissenschaft. Vielmehr wird eine Vorstellung von dem, was die soziale Wohlfahrt ausmacht, allgemein zur gesellschaftlichen Orientierung als unverzichtbar angesehen. In der öffentlichen Diskussion wird lediglich ein anderer Begriff, nämlich der des »Gemeinwohls«, verwendet. Es gibt wohl keine Gesellschaft, die versucht, ohne diesen Begriff auszukommen.
Andererseits muss jeder, der versucht hat, den Begriff der sozialen Wohlfahrt (des Gemeinwohls) zu operationalisieren und womöglich Bedingungen für ein soziales Optimum (Maximum der sozialen Wohlfahrt) zu identifizieren, einräumen, dass dieses Projekt unter schwerwiegenden grundsätzlichen Problemen und ungezählten Schwierigkeiten im Detail leidet. Hier muss man wohl sagen: Der Weg ist das Ziel. 25
Wir wollen das umweltökonomische Anliegen dieses Buches effizient verfolgen und meiden daher den Irrgarten der Wohlfahrtstheorie. Dabei hilft eine einfache (und wohl deshalb in der Literatur sehr populäre) Konvention: Unter der gesellschaftlichen Wohlfahrt verstehen wir die Summe der Nutzen aller Gesellschaftsmitglieder. Die Nutzen können positiv oder negativ sein. Für negative Nutzen hat sich der Begriff »Kosten« eingebürgert.
Ein Zustand ist sozial optimal, wenn er die Differenz zwischen den über alle Gesellschaftsmitglieder aggregierten (positiven) Nutzen und Kosten maximiert. Das Gemeinte wird womöglich (noch!) deutlicher, wenn wir die vorstehend recht allgemein formulierte Frage nach der Definition eines sozial optimalen Zustandes auf das obige Beispiel der Produktion eines Gutes x verengen: Die sozial optimale Produktionsmenge ist dadurch definiert, dass die Differenz zwischen den aggregierten Nutzen und den aggregierten Kosten der Produktion maximal ist.
Natürlich ist mit diesem Konzept gleich die nächste (äußerst unbequeme) Frage aufgeworfen: Wie soll denn der Nutzen gemessen werden? Bei der in Rede stehenden Konvention wird als Näherungsgröße für den Nutzen, den ein Individuum aus dem Gut x zieht, die Zahlungsbereitschaft des Individuums für die Versorgung mit der betrachteten Gütermenge verwendet. Geht es um die Versorgung mit einer zusätzlichen (marginalen) Einheit, so dient entsprechend die marginale Zahlungsbereitschaft als Proxivariable. Nicht alle Individuen ziehen positiven Nutzen aus dem betreffenden Gut. Manche sind vielmehr mit Kosten belastet, insbesondere (im umweltökonomischen Kontext ist hinzuzufügen: aber nicht nur) die Produzenten. Die Zahlungsbereitschaft dafür, Kosten zu tragen, ist negativ. Die negative Zahlungsbereitschaft entspricht der Forderung, für die erlittene Nutzeneinbuße kompensiert zu werden. Geht es um eine (marginale) zusätzliche Einheit des Gutes, so sprechen wir von der marginalen Kompensationsforderung bzw. den Grenzkosten. 26
Mit den hier kurz erläuterten Konventionen lautet also die Antwort auf die oben gestellte Frage: Die sozial optimale Produktionsmenge des Gutes x ist erreicht, wenn die Differenz aus der aggregierten Zahlungsbereitschaft für x und den aggregierten von der x-Produktion verursachten Kosten maximal ist.
Betrachten wir nun die marktliche Allokation bei vollständiger Konkurrenz und wenden uns zunächst den Konsumenten als »Nutznießern« der Produktion zu. Da die individuelle Nachfragekurve eines jeden Konsumenten, wie oben begründet, die marginale Zahlungsbereitschaft dieses Konsumenten widerspiegelt, ist die aggregierte Nachfragekurve auf dem Markt eine grafische Illustration des aggregierten »Grenznutzens« (im Sinne der marginalen Zahlungsbereitschaft), den die Konsumenten aus diesem Produkt ziehen. Die Fläche unter der Nachfragekurve repräsentiert daher den gesamten Nutzen der Konsumenten aus dem Gut x.
Wenden wir uns nun der Kostenseite des Marktgleichgewichts und damit den Produzenten als den »Leidtragenden« der Produktion zu. Im idealtypischen Modell, das hier (zunächst) betrachtet wird, spiegeln die Grenzkosten der Produzenten den korrekt bewerteten Ressourcenverzehr wider, der durch die Produktion einer zusätzlichen Einheit des Gutes x entsteht. Die Angebotskurve auf dem Markt repräsentiert daher letztlich die volkswirtschaftlichen Grenzkosten der Produktion des Gutes x. Die Fläche unter der Angebotskurve ist demnach (von den Fixkosten einmal abgesehen) als grafische Illustration der gesamten Kosten anzusehen, die mit der Produktion des Gutes x einhergehen.
Offensichtlich ist das Optimalitätskriterium der Maximierung der Nutzen-Kosten-Differenz dort erfüllt, wo die Differenz der Flächen unter der Nachfrage- und Angebotskurve maximal ist. Anders ausgedrückt, ist die optimale Menge dadurch definiert, dass »Grenznutzen« und Grenzkosten von x einander gleich sind. Dies ist aber gerade im Schnittpunkt von Angebots- und Nachfragekurve der Fall. Damit sind auch zwischen Angebots- und Nachfrageseite die relevanten Marginalgrößen (Grenzkosten und marginale Zahlungsbereitschaft) ausgeglichen. Wir sehen also, dass im idealtypischen Grundmodell der »vollständigen Konkurrenz« der Marktmechanismus im Gleichgewicht die gesellschaftlich optimale Menge des betrachteten Gutes zur Verfügung stellt.
Читать дальше