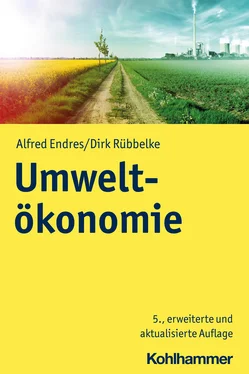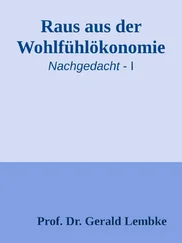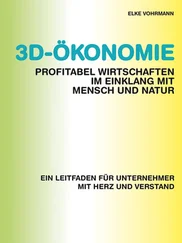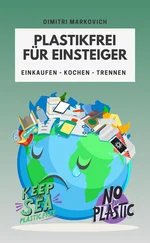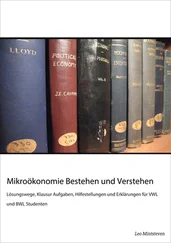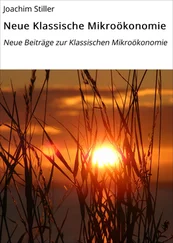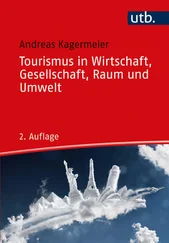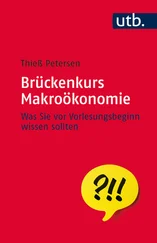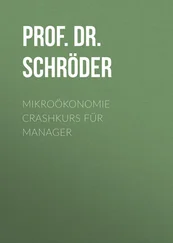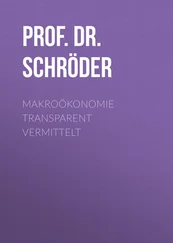Alfred Endres und Dirk Rübbelke
Hagen und Freiberg im November 2021
1Entsprechend könnten die Internalisierungsstrategien als »schadensorientierte« Instrumente bezeichnet werden.
2Trends in der umweltökonomischen Forschung lassen sich fortlaufend aus den Programmen der Jahrestagungen der einschlägigen wissenschaftlichen Vereinigungen ablesen, z. B. der Association of Environmental and Resource Economists (AERE) oder der European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE). Mit einem gewissen Lag gilt das auch für die führenden umweltökonomischen Zeitschriften wie Ecological Economics, Environmental and Resource Economics, Energy Economics, Environmental Economics and Policy Studies, International Review of Environmental and Resource Economics, Journal of Environmental Economics and Management, Resource and Energy Economics, Journal of the Association of Environmental and Resource Economists. Eine thematische Auswertung dieser Zeitschriften präsentieren Kvamsdal et al. (2021). Stärker zukunftsgerichtet (also zu den Herausforderungen, denen sich die Umweltökonomie wird stellen müssen) vgl. Bretschger/Pittel (2020).
Erster Teil
Die Internalisierung externer Effekte als Leitbild der Umweltpolitik
So können natürlich die Dinge in Wirklichkeit nicht aneinander passen, wie die Beweise in meinem Brief, … aber mit der Korrektur, die sich durch diesen Einwurf ergibt, … ist meiner Meinung nach doch etwas der Wahrheit Angenähertes erreicht …
Franz Kafka, Brief an den Vater, 1919
A. Wirtschaftstheoretische Grundlagen
I. Gegenstand und Methoden der mikroökonomischen Theorie
Die Mikroökonomie ist die Wissenschaft von der Knappheit und der Bewältigung von Knappheitsfolgen. Knappheit entsteht dadurch, dass die zur Deckung der Bedürfnisse der Menschen vorhandenen Ressourcen nicht ausreichen, um alle vorhandenen Wünsche zu erfüllen. Der Begriff der Knappheit bezieht sich also hier nicht (nur) auf das Fehlen des Notwendigsten, sondern auf jede Divergenz zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Die zentralen Begriffe der »Bedürfnisse« und »Ressourcen« sind in der modernen Ökonomie sehr weit gefasst.
Der Begriff des Bedürfnisses transzendiert den umgangssprachlich üblicherweise als »ökonomisch« bezeichneten Bereich von Ernährung, Wohnen, Bekleidung, Transport usw. bei weitem und umfasst häufig als »außerökonomisch« verstandene Bedürfnisse, wie das nach sauberer Umwelt, innerer und äußerer Sicherheit, ja sogar die Sehnsucht nach Harmonie und Geborgenheit in der Partnerschaft. 3
Auch der Begriff der Ressourcen ist in der modernen ökonomischen Literatur nicht mehr auf die traditionellen Produktionsfaktoren – (Erwerbs-)Arbeit, Kapital und Boden – beschränkt. Vielmehr werden heute auch die natürlichen (erschöpflichen wie regenerierbaren) Ressourcen oder das menschliche Wissen und die Arbeitsmoral in einer Gesellschaft berücksichtigt.
Eine Welt der Knappheit ist notwendigerweise durch Konflikte um die kostbaren (weil zur Minderung der Knappheit erforderlichen) Ressourcen charakterisiert. Keine Gesellschaft ist ohne Mechanismen und Institutionen zur Regelung dieser Konflikte denkbar. Die Regeln, mit denen knappe Ressourcen auf die allzu zahlreichen Träger der allzu zahlreichen Bedürfnisse aufgeteilt werden können, sind sehr vielfältig. Zu denken ist etwa an die Anwendung des Gesetzes des Dschungels, basisdemokratische Entscheidungsverfahren, den Marktmechanismus oder patriarchalische (matriarchalische) Zuweisungen. Die meisten Gesellschaften praktizieren eine Mischung dieser verschiedenen Allokationsmechanismen mit unterschiedlich starker Ausprägung ihrer Komponenten. Die moderne Wirtschaftstheorie hat sich überwiegend mit dem Markt als Allokationsmechanismus beschäftigt, aber auch die anderen oben erwähnten Mechanismen (und weitere) behandelt.
Für den (sicherlich geringen) Teil der Leserschaft, der an der Relevanz der obigen Ausführungen für die Umweltpolitik zweifelt, sei verdeutlicht: Betrachten wir den Luftraum über einer bestimmten Region als knappe Ressource, um die verschiedene Ansprüche konkurrieren: Firmen möchten die Luft als Aufnahmemedium für ihre Schadstoffe verwenden, Anwohner möchten die Luft einatmen. Die oben genannten Allokationsmechanismen können auch als Institutionen zur Regelung dieses Konflikts eingesetzt werden.
Nach dem Gesetz des Dschungels würde sich die »aggressive« Nutzungsform der Emittenten gegen die »defensive« Nutzungsabsicht der Anwohner uneingeschränkt durchsetzen. 4
Der Allokationsmechanismus der autoritären Zuweisung würde im Beispielsfall bedeuten, dass den Firmen Emissionshöchstgrenzen vorgegeben werden. Damit wäre implizit eine Aufteilung der knappen Ressource zwischen Firmen und Anwohnern fixiert.
Mehr oder weniger am marktlichen Allokationsmechanismus orientierte Lösungen bestünden etwa in Verhandlungen zwischen potentiellen Verursachern und potentiellen Geschädigten 5 oder in der Vergabe von Emissionszertifikaten 6 .
Als basisdemokratische Variante wäre eine Volksabstimmung über die Emissionsniveaus (oder Ansiedlung bzw. Schließung) der betreffenden Firmen denkbar.
Im Zusammenhang mit der Analyse von Mechanismen zur Entscheidung über die Verwendung knapper Ressourcen und die Früchte ihres Einsatzes sind für die ökonomische Theorie insbesondere zwei Fragen interessant:
a) Welche Verwendung der knappen Ressourcen wird in einer Volkswirtschaft insgesamt als Resultat der zahlreichen Entscheidungen von zahlreichen einzelnen Entscheidungsträgern vorgenommen?Hier geht es darum zu erfahren, in welcher Weise die Rahmenbedingungen, unter denen die Individuen ihre Entscheidungen treffen, z. B. die Technologie oder die Rechtsordnung, die allokativen Ergebnisse beeinflussen. Wir bezeichnen diesen Teil der mikroökonomischen Theorie als »positive Analyse«.
b) Wie ist das im ersten oben genannten Schritt festgestellte (oder prognostizierte) Allokationsergebnis aus volkswirtschaftlicher Sicht zu bewerten?Dieses weitergehende Programm der mikroökonomischen Theorie bezeichnen wir als »normative Analyse«.
Viele Ökonominnen und Ökonomen sind besonders davon fasziniert, das tatsächlich von einem bestimmten Allokationsmechanismus erreichte Ergebnis mit einem »optimalen« Ergebnis zu vergleichen. Natürlich ist es für dieses Unterfangen nötig, ein gesellschaftliches Optimalitätskriterium zu entwickeln. Wird bei der Analyse des Marktmechanismus festgestellt, dass das Marktergebnis (»Gleichgewicht«) vom Optimum abweicht, so ist dies für den Ökonomen/die Ökonomin Anlass, über Korrekturmechanismen nachzudenken. 7
Im Folgenden wird ausführlich dargelegt, dass die Existenz von Umweltproblemen (in der ökonomischen Terminologie: »externen Effekten«) eine Abweichung zwischen Marktgleichgewicht und Optimum begründet. Die im Zweiten Teil des Buches thematisierte »Internalisierung externer Effekte« ist nichts anderes als der Versuch, wirtschaftspolitische Korrekturen am Marktmechanismus mit dem Ziel vorzunehmen, Gleichgewicht und Optimum zur Deckung zu bringen.
Natürlich ist der Anspruch, die Politik solle einen optimalen Zustand herstellen, im Bereich der Umweltpolitik – wie in jedem anderen Bereich – aus mancherlei Gründen zu hoch gegriffen. Dennoch lohnt es sich, den Begriff der Optimalität zu operationalisieren und strukturelle Ursachen für Fehllenkungen des Marktmechanismus durch eine Konfrontation des Marktgleichgewichts mit dem Optimum aufzudecken. Wenn auch das Optimum in der Realität wohl nie erreicht werden wird, so könnte es doch eine Orientierungshilfe für die Umweltpolitik liefern, der der Blick für die einzuschlagende Richtung allzu oft (aber doch auch verständlicherweise) durch das Gestrüpp von Alltagsproblemen verstellt wird.
Читать дальше