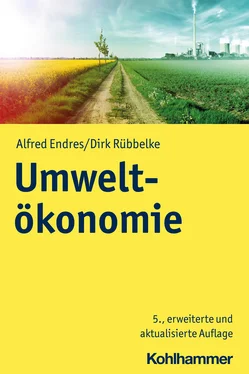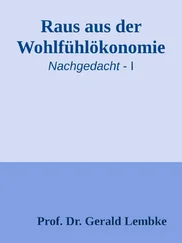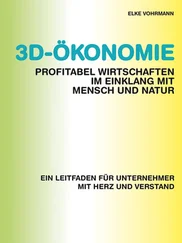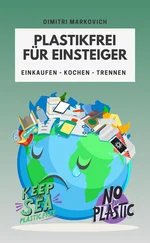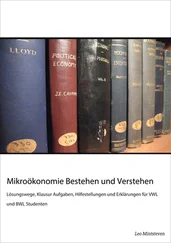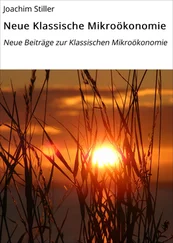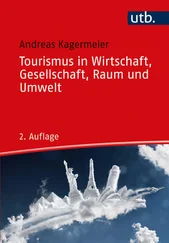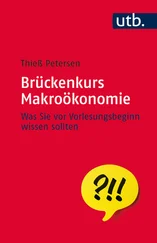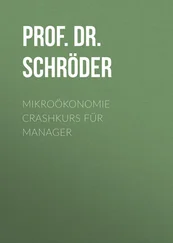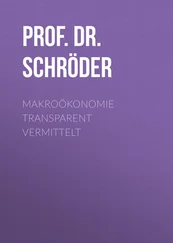Natürlich: Inwieweit eine bestimmte Problematik zum Grundmodell, zu den Weiterungen (oder gar Alternativen) gehört, ist letztlich eine Frage der subjektiven Bewertung. Es sei hier jedem zugestanden, eine andere Einteilung als die hier gewählte für angemessener oder komfortabler zu halten.
Ebenso verhält es sich mit der Antwort auf die Frage, wie die Ökonomie internationaler Umweltprobleme eingeordnet werden soll. Zweifellos könnte sie als Weiterung des Grundmodells gesehen und damit im Vierten Teil platziert werden. Andererseits betritt man jedoch eine »andere Welt«, wenn sich die Betrachtung von der Dichotomie zwischen einer (mehr oder weniger gut informierten) regulierenden Institution und der Schar der Regulierten zur Betrachtung der Interaktion von unabhängigen Akteuren verschiebt. Dies geschieht systematisch bei der Analyse internationaler Umweltpolitik. Hier findet schließlich die Konstruktion des Nationalstaates, der Umweltrecht setzt und durchsetzt, keine Verwendung mehr. Vielmehr wird berücksichtigt, dass internationale Umweltpolitik zwischen souveränen Staaten (mehr oder weniger frei) vereinbart werden muss. Der Verschiebung des Erkenntnisobjekts entspricht ein Wechsel der analytischen Methode. An die Stelle der traditionellen mikroökonomischen Regulierungstheorie tritt die Spieltheorie.
Diese Überlegungen haben den Ausschlag dafür gegeben, die internationalen Umweltprobleme nicht als eine von mehreren Weiterungen des Grundmodells in den Vierten Teil zu allozieren, sondern ihnen den Fünften Teil exklusiv zu widmen. Hinzu kommt die überragende Bedeutung internationaler Umweltprobleme für die aktuelle umwelt- und gesellschaftspolitische Diskussion sowie der (damit korrespondierende) recht große Raum, der der einschlägigen Erörterung in diesem Buch eingeräumt wird. Wegen der hohen Aktualität der Diskussion um die globalen Umweltprobleme haben wir in diesem Teil auch besonders darauf geachtet, dass die wirtschaftstheoretischen Überlegungen nicht für sich stehen, sondern zur Bewertung praktischer internationaler Umweltpolitik herangezogen werden. Dies geschieht insbesondere am Beispiel einer umweltökonomischen Analyse des Klimaschutzabkommens von Paris sowie des EU-Emissionshandelssystems.
Noch leichter als bei den internationalen Umweltproblemen fällt die Entscheidung, natürliche Ressourcen und nachhaltige Entwicklung eigenständig (und damit im Sechsten Teil) zu behandeln, statt sie als Weiterungen des Grundmodells im Vierten Teil zu platzieren. Schließlich ist die hier eingenommene Perspektive sehr deutlich von der vorher in diesem Buch eingenommenen Perspektive zu unterscheiden.
Trotz vielerlei Abweichungen und Differenzierungen besteht die Grundvorstellung in den ersten fünf Teilen des Buches doch darin, dass mit der wirtschaftlichen Aktivität ein unerwünschtes Kuppelprodukt (externer Effekt, Emission) produziert wird, dessen Ausmaß durch ordnungs- oder prozesspolitisches Einwirken des Staates (oder einer Koalition von Staaten) günstig beeinflusst werden soll. Das Leitbild dieser Beeinflussung ist die Internalisierung externer Effekte, – sei es in ihrer reinen Form oder in der »Magerstufe« der standardorientierten Umweltpolitik. Im Sechsten Teil des Buches ergänzen wir dann diese outputbezogene Betrachtung durch eine inputbezogene. Der Umstand, dass jede wirtschaftliche Aktivität Ressourcen aus der Natur entnehmen muss, rückt in den Fokus der Betrachtung. Das Problem besteht in der Erschöpfung des Ressourcenbestandes bzw. in der Beschädigung (wenn nicht sogar der Zerstörung) der ressourcialen Basis der menschlichen Existenz. Die daraus entstehende Frage ist die nach den Bedingungen der Dauerhaftigkeit menschlicher Existenz. Das zugehörige politische Leitbild ist das der nachhaltigen Entwicklung.
Soweit der Überblick über das Programm dieses Buches. Bitte gestatten Sie uns zum Abschluss dieses Anfangs noch einige Bemerkungen zu den Spezifika der vorliegenden Auflage im Vergleich zu ihren Vorgängerinnen. Die ersten vier Auflagen dieses Buches wurden von Alfred Endres in Alleinautorenschaft verfasst und damit auch verantwortet. Nun hat die Lektüre zahlreicher verhaltensökonomischer Artikel den bisherigen Alleinautor davon überzeugt, dass es gut ist, mal einen Schuss Altruismus in seine Entscheidung bezüglich der Autorenschaft der nächsten Auflage einfließen zu lassen. So teilt er denn nun das Vergnügen mit seinem verehrten Kollegen, Herrn Prof. Dr. Dirk Rübbelke von der Technischen Universität Bergakademie Freiberg. Die in dieser Kooperation entstandende Neuauflage unterscheidet sich von der vorangegangenen Auflage insbesondere in folgender Hinsicht:
• Die Literaturhinweise in allen Teilen des Buches sind umfassend aktualisiert worden. Dies ist besonders wichtig für diejenigen Leserinnen und Leser, die das Buch zur Anfertigung von Seminar- und Abschlussarbeiten oder Dissertationen nutzen.
• Das oben bereits angesprochene Kapitel A des Vierten Teils über Umweltschutz als unreines öffentliches Gut wurde neu in das Buch aufgenommen. Dabei wird die Theorie der Kuppelproduktion umweltökonomisch nutzbar gemacht, indem sie zur Analyse von »Zusatznutzen« umweltpolitischer Maßnahmen eingesetzt wird.
• Ebenfalls neu in das Buch aufgenommen wurde das Kapitel F des Vierten Teils, in dem verhaltensökonomische Aspekte des Umweltschutzes berücksichtigt werden.
• Die Analyse der Umweltpolitik bei unvollständiger Konkurrenz war in der Vorauflage auf den Monopolfall beschränkt. Nun findet sich (in Kapitel C des Vierten Teils) auch eine Analyse der Emissionsbesteuerung im Oligopolfall.
• Der Entwicklung der internationalen Umweltpolitik der letzten Jahre folgend wurde die Behandlung des Kyoto-Abkommens stark gekürzt. Spiegelbildlich wird das Klimaschutzabkommen von Paris in der vorliegenden Auflage (in Kapitel B des Fünften Teils) sehr ausführlich behandelt.
• Der europäische Emissionshandel war in den letzten Jahren starken Veränderungen unterworfen und hat erheblich an Bedeutung gewonnen. Dem trägt die Neuauflage des vorliegenden Buches (in Kapitel C des Fünften Teils) Rechnung.
• Natürlich: Das sind allerlei Erweiterungen, die naturgemäß Platz beanspruchen. Damit der Text nicht ausufert, haben wir den für die Erweiterungen notwendigen Platz an anderer Stelle eingespart (leider einsparen müssen). Insbesondere haben wir aus der Vorauflage das Kapitel »Die ›doppelte Dividende‹ der Ökosteuer« gestrichen.
• Bei der Arbeit an der Neuauflage haben die Autoren vielfältige Unterstützung erfahren. Wir möchten uns sehr herzlich bei Frau Annette vom Heede, FernUniversität in Hagen, und Frau Anja Brumme, Frau Dr. Theresa Stahlke und Herrn Dr. Philip Mayer, Technische Universität Bergakademie Freiberg, bedanken, die den Text in mehreren Versionen redaktionell betreut haben.
• Schließlich soll (darf!) hier nicht unerwähnt bleiben, dass sich Herr Professor Dr. Michael Finus (heute: Universität Graz), Frau Professorin Dr. Karin Holm-Müller (heute: Universität Bonn), Frau apl. Professorin Dr. Bianca Rundshagen (FernUniversität in Hagen) und Herr Professor Dr. Reimund Schwarze (heute: Viadrina Universität Frankfurt/Oder) mit zahlreichen nützlichen Hinweisen um frühere Auflagen dieses Buches verdient gemacht haben. Schließlich haben die Ausführungen zur Ökonomie des Umwelthaftungsrechts und des induzierten umwelttechnischen Fortschritts erheblich von der jahrelangen Forschungskooperation zwischen Alfred Endres und Herrn Professor Dr. Tim Friehe (heute: Universität Marburg) profitiert. Die Samariterdienste der genannten Personen wirken wohltuend in den jetzt vorliegenden Text hinein.
Zu guter Letzt noch eine frohe Botschaft für Dozentinnen und Dozenten der Umweltökonomie: Um die Aerodynamik des vorliegenden Textes beim Einsatz in Ihren Lehrveranstaltungen zu verbessern, können Sie die PowerPoint-Folien aller Abbildungen unter https://dl.kohlhammer.de/978-3-17-039458-2herunterladen.
Читать дальше