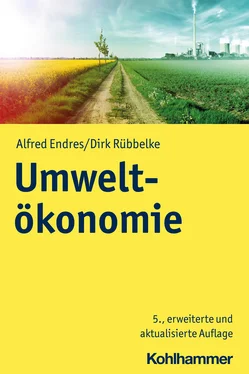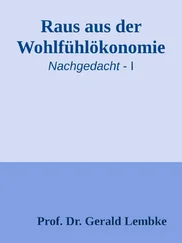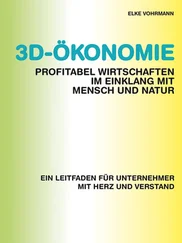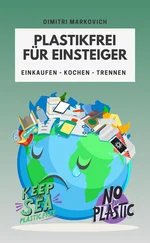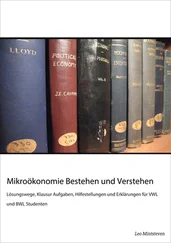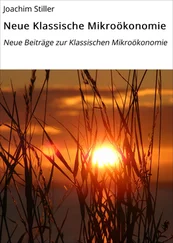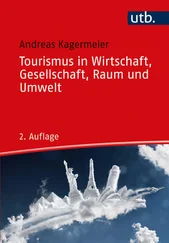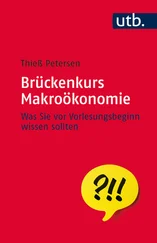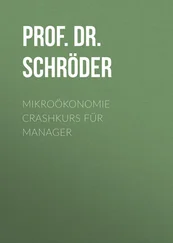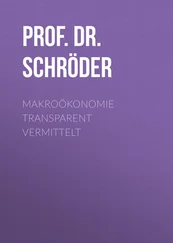Eine Internalisierung externer Effekte in reiner Form ist aus verschiedenen (im Text näher dargelegten) Gründen in der Praxis sehr schwierig. In der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur ist daher auch der Einsatz von Instrumenten, die einem aus wirtschaftstheoretischer Sicht etwas weniger anspruchsvollen Ziel als dem der Internalisierung dienen, ausführlich behandelt worden. Es geht in diesem Zusammenhang darum, zu prüfen, inwieweit umweltpolitische Instrumente geeignet sind, einen vorgegebenen (nicht notwendig dem ökonomischen Optimalitätskriterium genügenden) Emissionsstandard zu erreichen. Die betreffenden Instrumente werden daher als »standardorientierte« Instrumente bezeichnet. 1 1 Entsprechend könnten die Internalisierungsstrategien als »schadensorientierte« Instrumente bezeichnet werden. 2 Trends in der umweltökonomischen Forschung lassen sich fortlaufend aus den Programmen der Jahrestagungen der einschlägigen wissenschaftlichen Vereinigungen ablesen, z. B. der Association of Environmental and Resource Economists (AERE) oder der European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE). Mit einem gewissen Lag gilt das auch für die führenden umweltökonomischen Zeitschriften wie Ecological Economics, Environmental and Resource Economics, Energy Economics, Environmental Economics and Policy Studies, International Review of Environmental and Resource Economics, Journal of Environmental Economics and Management, Resource and Energy Economics, Journal of the Association of Environmental and Resource Economists. Eine thematische Auswertung dieser Zeitschriften präsentieren Kvamsdal et al. (2021). Stärker zukunftsgerichtet (also zu den Herausforderungen, denen sich die Umweltökonomie wird stellen müssen) vgl. Bretschger/Pittel (2020).
Die hier angesprochene Frage wird im Dritten Teil behandelt. Die außerordentlich zahlreichen »pragmatischen« umweltpolitischen Instrumente, die in Wissenschaft und Politik diskutiert werden, werden dabei in drei »Prototypen«, nämlich Auflagen, Abgaben und Zertifikate zusammengefasst. Sie werden insbesondere auf ihre Effizienz, ihre Anreizwirkung bezüglich des umwelttechnischen Fortschritts und in Bezug auf die Genauigkeit, mit der sie das umweltpolitische Ziel erreichen können, untersucht.
Die Darlegungen in den ersten drei Teilen dieses Buches erklären das wohlfahrtsökonomische Fundament der Umweltökonomie, ihre elementaren Bausteine und den Umriss ihrer Architektur. Damit ist das Grundmodell der Umweltökonomie konstituiert.
Natürlich gibt es eine Unzahl von realen Problemen der Umwelt und der Umweltpolitik, die in diesem Modell nicht oder nicht adäquat abgebildet sind. Diesen wird in der Literatur mit entsprechenden (auf das Erklärungsziel der jeweiligen Erörterung ausgerichteten) Weiterungen des Grundmodells Rechnung getragen. Die Frage, welche Repräsentantinnen der kaum zu übersehenden Schar von Varianten in einem umweltökonomischen Lehrbuch Berücksichtigung finden sollen, ist natürlich schwer zu beantworten. Letztlich wird die Auswahl von der Bewertung ihrer politischen Relevanz und wissenschaftlichen Interessanz (hoppla!) durch die Autoren bestimmt. Im Vierten Teil dieses Buches finden Sie einen bunten Strauß von Erweiterungen des umweltökonomischen Grundmodells. Bei der Abfassung dieses Teils haben wir uns von unserer Überzeugung leiten lassen, dass es möglich sei, die Auswahl von Themen, die in einem grundlegenden Lehrbuch behandelt werden, von der aktuellen Forschung leiten zu lassen. Gegenstand und Methoden dieser Forschung lassen sich in vernünftigen Grenzen durchaus jenseits der In-Crowd der aktiven Forscherinnen und Forscher vermitteln, ohne den weniger spezialisierten Lesern die Unverdaulichkeiten des Forschungsdiskurses zumuten zu müssen. 2 2 Trends in der umweltökonomischen Forschung lassen sich fortlaufend aus den Programmen der Jahrestagungen der einschlägigen wissenschaftlichen Vereinigungen ablesen, z. B. der Association of Environmental and Resource Economists (AERE) oder der European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE). Mit einem gewissen Lag gilt das auch für die führenden umweltökonomischen Zeitschriften wie Ecological Economics, Environmental and Resource Economics, Energy Economics, Environmental Economics and Policy Studies, International Review of Environmental and Resource Economics, Journal of Environmental Economics and Management, Resource and Energy Economics, Journal of the Association of Environmental and Resource Economists. Eine thematische Auswertung dieser Zeitschriften präsentieren Kvamsdal et al. (2021). Stärker zukunftsgerichtet (also zu den Herausforderungen, denen sich die Umweltökonomie wird stellen müssen) vgl. Bretschger/Pittel (2020).
Mit den in Kapitel A behandelten Zusatznutzen umweltpolitischer Maßnahmen und den in Kapitel B behandelten Schadstoffinteraktionen geben wir Beispiele für den Umstand, dass zahlreiche ökologische Komplikationen im umweltökonomischen Grundmodell ignoriert werden. Zu Ersterem: Das gleichzeitige Auftreten von verschiedenen Effekten von Umweltschutzmaßnahmen ist eher die Regel als die Ausnahme. So ist eine Verringerung der Verbrennung fossiler Energieträger mit dem Ziel des Klimaschutzes verbunden mit der Reduktion anderer Luftschadstoffe, wie beispielsweise Feinstaub. Zu Letzterem: Unter Schadstoffinteraktionen versteht man das Zusammenwirken verschiedener Emissionsarten bei der Verursachung des Umweltschadens. Exemplarisch wird anhand dieser beiden Phänomene gezeigt, wie man ökologische Spezifika in das ökonomische Modell »einbauen« kann und inwieweit sich damit die Modellergebnisse ändern. Bei einer anderen Klasse von Weiterungen besteht die Abweichung vom Grundmodell darin, dass neben externen Effekten andere Gründe für »Marktversagen« in ein und demselben Modell berücksichtigt werden. Dies ist bei der Umweltpolitik unter den Bedingungen unvollständiger Konkurrenz und bei der Analyse von Umweltpolitik bei asymmetrischer Information gegeben, die in den Kapiteln C und D behandelt werden. Die in den vorgenannten Kapiteln behandelten Probleme von Marktmacht und Unsicherheit wurden in den ersten drei Teilen vollständig ausgeklammert. Anders verhält es sich mit der in Kapitel E behandelten Analyse des induzierten umwelttechnischen Fortschritts. Im ökonomischen Grundmodell wird diese unter der Überschrift »Dynamische Anreizwirkung« schon rudimentär behandelt. Demgegenüber erhält jedoch die dynamische Modellierung der im Vierten Teil des Buches platzierten Passage ein so großes Eigengewicht, dass die entsprechende Modellierung wohl das lehrbuchübliche Grundmodell sprengt und als »Weiterung« bezeichnet werden kann. Diese Einschätzung gilt auch für die in Kapitel E verwendete analytische Methode, die vom Leser mehr technische Kenntnisse verlangt, als die stärker anschaulich gehaltene Darstellung in den ersten drei Teilen.
In dem den Vierten Teil abschließenden Kapitel F werden verhaltensökonomische Aspekte von Umweltproblemen und Umweltpolitik analysiert. Manche Leser/innen werden das wohl eher für eine Alternative zum statt für eine Weiterung des umweltökonomischen Grundmodell(s) halten. Schließlich analysieren wir hier Entscheidungsträger, die über eine völlig andere »DNA in ihren Präferenzen« verfügen als der traditionell (und im Grundmodell ausschließlich) verwendete Homo Oeconomicus. Hier sind z. B. Gerechtigkeitsüberlegungen entscheidungsrelevant, die im Grundmodell der Umweltökonomie keine Rolle spielen. Man kann aber sehr wohl die Auffassung vertreten, dass dies eine Weiterung des Grundmodells sei. Schließlich wird in der Verhaltensökonomie nicht unterstellt, die Entscheidungsträger seien an Gerechtigkeit an der Stelle von Eigennutz interessiert. Vielmehr treten die Gerechtigkeitsüberlegungen ergänzend zu den altbekannten Eigennutzüberlegungen im Kalkül der Entscheidungsträger auf.
Читать дальше