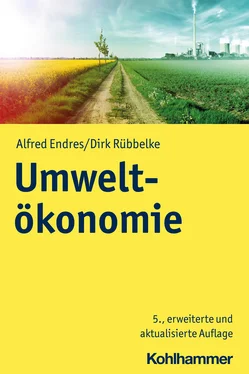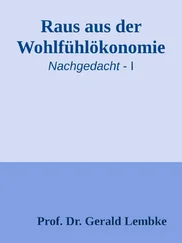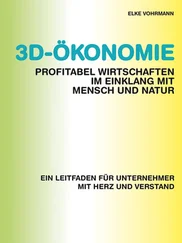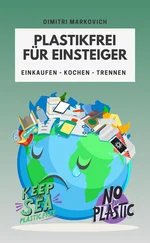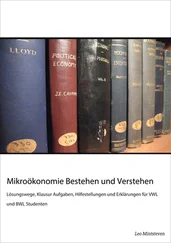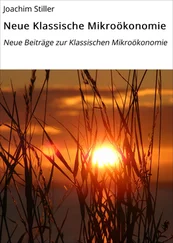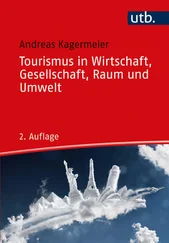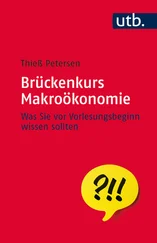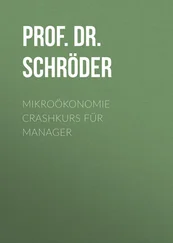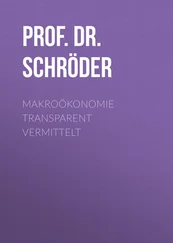Im anschließenden Zweiten Teil werden die wichtigsten Internalisierungsstrategien vorgestellt und gewürdigt. Dabei gehen wir stets davon aus, dass die jeweils in Rede stehende Strategie allein zur Internalisierung des externen Effekts eingesetzt wird. Der simultane Einsatz verschiedener Strategien und/oder die Interaktionen einer Strategie mit anderen umweltpolitischen Regulierungen sind nicht Gegenstand der folgenden Erörterung.
Bei der folgenden Darstellung der Internalisierungsstrategien (und dort, wo nichts anderes gesagt wird, auch in allen anderen Teilen dieses Buches) werden wir zur Vereinfachung davon ausgehen, dass der Umweltschaden von der Menge der verursachten Emissionen eines bestimmten Schadstoffs abhängt. Damit folgen wir der in der vorstehenden Erörterung und (bei weitem überwiegend auch) in der gesamten einschlägigen Lehrbuchliteratur geltenden Konvention. In Wirklichkeit wird der Schaden jedoch auch davon abhängen, an welchem Ort die betrachtete Emission verursacht wird. Eine Berücksichtigung geografischer Gegebenheiten bei der Umweltpolitik kann zu erheblichen Effizienzgewinnen führen. Auf die Modellierung dieses Aspekts wird jedoch im Folgenden verzichtet, um den einführenden Charakter der Darstellung nicht zu sprengen. Näheres z. B. bei Antweiler (2017), Fowlie/Muller (2019), Fraas/Lutter (2012), Krysiak/Schweitzer (2010) und Muller/Mendelsohn (2012).
3Vgl. Becker (1993) sowie z. B. Coyle (2010), Homann/Suchanek (2005), Kirchgässner (2008). Gary Becker wurde im Jahre 1992 für seine Beiträge zur Weiterentwicklung der Ökonomie zu einer allgemeinen Theorie des menschlichen Verhaltens mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft ausgezeichnet.
4Die Nutzung der Luft als Aufnahmemedium für Schadstoffe schränkt die Möglichkeit ein, die Luft in einer für die Atmung günstigen Qualität zu nutzen. Dagegen schränkt das Atmen nicht die Emissionsmöglichkeit ein. Diese Aussagen dürfen natürlich nicht mit der Behauptung verwechselt werden, ein den Anwohnern verliehenes Recht auf das Atmen sauberer Luft schränke die Aktionsmöglichkeiten der Emittenten nicht ein. Mit der Zuweisung eines solchen Rechts wäre jedoch der Rahmen des Allokationsmechanismus »Gesetz des Dschungels« gesprengt. Wenn im Text behauptet wird, unter diesem Gesetz setze sich die Nutzungsabsicht der Verursacher des externen Effektes durch, so wird von der Möglichkeit abgesehen, dass die Geschädigten die Emissionen gewaltsam verhindern.
5Vgl. Kap. A. des Zweiten Teils, unten.
6Vgl. Kap. B.III des Dritten Teils, unten.
7Die Formulierung »Anlass, … nachzudenken« ist bewusst vorsichtig gewählt: Daraus, dass der Markt einen optimalen Zustand nicht herstellen kann, folgt keineswegs, dass ein anderer Allokationsmechanismus dazu in der Lage wäre.
8Manche freilich finden auch die ökonomische Modelltheorie ermüdend und fruchtlos.
9Diese werden bisweilen in einzelnen »Fallstudien« unter Anwendung der allgemeinen Theorie einbezogen.
10Mit diesen Bemerkungen soll auch der weit verbreiteten Meinung entgegengewirkt werden, Ökonomen seien naturgemäß herzlose Verstandesmenschen, denen (eben deshalb!) wesentlicher Einfluss bei der Beantwortung zentraler Lebensfragen der menschlichen Gesellschaft auf keinen Fall eingeräumt werden dürfe. Richtig ist vielmehr, dass einen guten Ökonomen neben einem scharfen Intellekt auch eine hohe Sensibilität auszeichnet. Wer dies für einen Widerspruch hält, sei wie folgt gewarnt: Im Japanischen wird für »Gefühl« und »Verstand« ein und dasselbe Kanji-Zeichen verwendet. (Gefunden bei Todd Shimoda, Ewiger Mond, Berlin, (List Verlag), 2006, S. 74.)
11Das Ergebnis des terminologischen Substitutionsprozesses (Ökonomen lieben Fremdwörter!) kann sich sehen lassen: Da haben wir schon schlechtere Modelldefinitionen gelesen. Themenvorschlag für das abendliche Kamingespräch (kann auch ein Blog sein): Warum weisen Romane und ökonomische Modelle Gemeinsamkeiten auf? Wo endet die Analogie?
12Das Portefeuille mikroökonomischer Lehrbücher ist sehr umfangreich und vielfältig. Da müsste eigentlich für (fast) jeden Geschmack etwas zu finden sein. Vgl. z. B. Breyer (2020), Herdzina/Seiter (2015), Kolmar (2017), Sturm/Vogt (2014), Varian (2016), Von Böventer/Illing (2018). Ein am Firmament der Ökonomie-Lehrbücher besonders hell und klar strahlender Stern ist Endres/Radke (2018). Hier werden die Grundzüge der Mikro- (und Makro-)ökonomie mit besonderem Blick auf das aufbereitet, was in der Umweltökonomie gebraucht wird.
13»Gleichgewicht« von L.J.C. Shimoda gefunden bei Todd Shimoda, Ewiger Mond, Berlin (List Verlag) 2006, S. 164. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Künstlerin.
14Auch die Qualität ist natürlich eigentlich nicht vorgegeben, sondern endogen zu bestimmen. Aus Vereinfachungsgründen verzichten wir jedoch hier auf die Darstellung dieses Aspekts. Modelle, in denen Firmen die Qualität ihrer Produkte festlegen, finden sich z. B. in Antoniades (2015), Bekkers (2016), Feenstra/Romalis (2014).
15Das Wesentliche der Marktform der vollständigen Konkurrenz besteht darin, dass kein einzelner Anbieter oder Nachfrager den Marktpreis beeinflussen kann.
16Die Beschränkung auf jeweils zwei Akteure erfolgt lediglich, um die nachstehende grafische Darstellung so einfach wie möglich zu halten. Die Allgemeinheit der Aussagen wird dadurch nicht berührt. Deshalb ist auch der mögliche Einwand, die hier angenommene Marktform der vollständigen Konkurrenz sei mit der Annahme einer so geringen Zahl von Marktteilnehmern nicht kompatibel, in diesem Zusammenhang uninteressant.
17Die Grenzkostenkurven müssen nicht monoton (und schon gar nicht linear) mit der produzierten Menge ansteigen, wie in der Abbildung eingetragen, sondern können auch einen anderen (z. B. u-förmigen Verlauf) annehmen. Auch monoton fallende Grenzkostenverläufe sind natürlich denkbar, sprengen jedoch das hier zugrunde gelegte Modell der vollständigen Konkurrenz. (Vgl. die Passagen zum natürlichen Monopol, z. B. bei Fritsch (2018), Kerber (2019), Schmidt (2019), Weimann (2009)).
18Genauer gesagt, entspricht die Angebotskurve der Grenzkostenkurve in deren steigendem Teil vom Minimum der (in der Abbildung nicht eingetragenen) Durchschnittskostenkurve an. Diese relativierende Aussage ist bei u-förmigen Grenzkostenverläufen besonders wichtig. Für eine genauere Analyse wäre in diesem Kontext die Unterscheidung zwischen einer langfristigen und einer kurzfristigen Kostenkurve bedeutend. Im Erörterungskontext können wir jedoch auf diese Differenzierung verzichten und uns mit einem Verweis auf die einschlägigen mikroökonomischen Lehrbücher begnügen.
19Die Autoren freuen sich darüber und sind auch ein wenig stolz darauf, mit diesen Zeilen einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, »das kapitalistische Rätsel schlechthin … das der Preisbildung« zu lösen. Zitat: Michel Houellebecq, Karte und Gebiet, deutsche Ausgabe, Köln (DuMont), 2012, S. 98.
20Die hier angesprochene Bereitschaft, für eine geringe zusätzliche Ausstattung mit einem Gut Geld auszugeben, wird als »marginale Zahlungsbereitschaft« bezeichnet.
21Der Leser/ Die Leserin ahnt schon, dass hier die Technik des »Beweises durch Widerspruch« zum Einsatz kommt.
22Für eine ausführliche Darstellung dieses Konflikts wäre die explizite Einbeziehung von Faktormärkten in die Betrachtung notwendig. Wegen der Analogie zu dem eben für den Konflikt zwischen den Haushalten auf dem Gütermarkt Gesagten unterbleibt diese Erörterung hier jedoch aus Platzgründen.
23Mit diesem Term wird der von Hartwick und Olewiler (1998) geprägte Begriff der Equimarginal Condition (S. 200) eingedeutscht.
24Siehe dazu auch Endres/Radke (2018).
25Die hier gemeinten Probleme werden in der wohlfahrtsökonomischen Literatur unter den Stichwörtern Soziale Wohlfahrtskriterien (Pareto-Kriterium, Kaldor-Hicks-Kriterium, Scitovsky-Kriterium) und Soziale Wohlfahrtsfunktion (Arrow-Theorem, Black’sches Theorem) behandelt. Vgl. Sohmen (1976). Dieses Buch ist nun wirklich eine echte Antiquität. Es lotet aber die Untiefen der Wohlfahrtsökonomie so gründlich aus, dass es im Erörterungszusammenhang noch heute lesenswert ist. Neuer (und auch schön): Feldman/Serrano (2006), McCain (2019).
Читать дальше